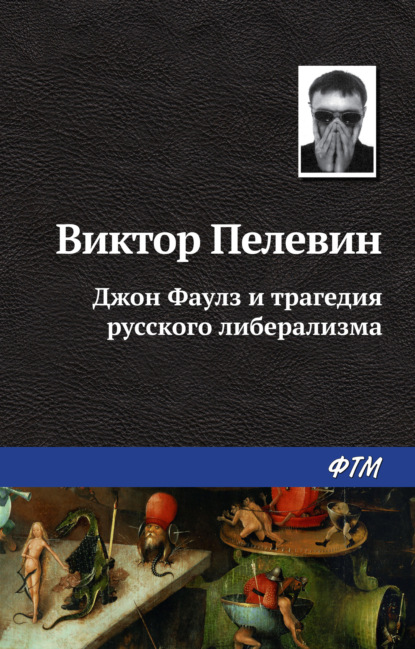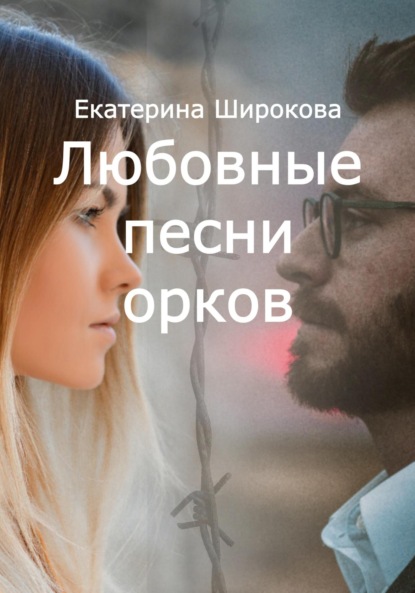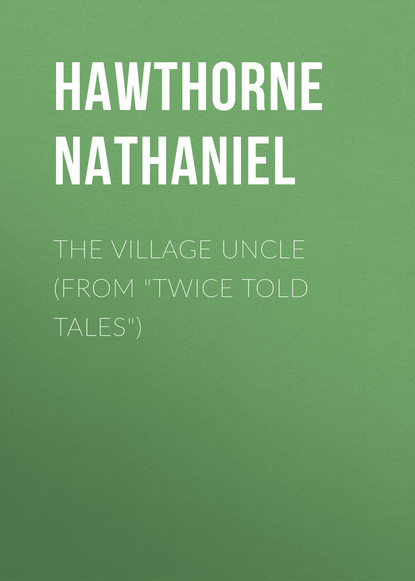Reise Know-How ReiseSplitter: Im Schatten – Mit dem Buschtaxi durch Westafrika

- -
- 100%
- +

Schulkinder vor der Snack- und Spielwarenauslage an einer Hauswand
Selbst hier oben in Chaouen, weit im Norden Marokkos, sind viele Händler aus dem südlicheren Afrika fleißig. Haratin oder Zugereiste? Haratin, die „Freien zweiter Klasse“, nennen Marokkaner die Nachfahren der „schwarzafrikanischen“ Sklaven, die über Jahrhunderte ins Land verschleppt wurden. Marokko braucht manchmal etwas länger. Erst in den 1960er-Jahren verschwand die Sklaverei in Marokko nach und nach. Die Haratin waren es jedoch gewohnt zu schuften und manche brachten es nach ihrer Befreiung schnell zu bescheidenem Wohlstand. Gewöhnlich weiß kein Haratin, woher seine Ahnen stammen. Der Weg zurück ins südliche Afrika blieb somit für immer versperrt. Die neuen Herren hatten ihre Sklaven bewusst voneinander getrennt. So waren die Haratin gezwungen, die Sprache ihrer neuen Heimat zu lernen. Nur in der Gnaoua, einer mystischen Bruderschaft, die den Islam mit Elementen subsaharischer Riten verbindet, ist es den ehemaligen Sklaven mit unterschiedlichen Muttersprachen gelungen, neue Gemeinsamkeiten zu schaffen.

FEELING BLUE: UNTERWEGS IM GASSENLABYRINTH
CHEFCHAOUEN/MAROKKO
Durch Beobachtung von Sonnenstand, Windrichtung und GPS-Daten finde ich im zartblauen Durcheinander von Treppen, Gassen und Tunneln tatsächlich irgendwann den Heimweg zu meiner Unterkunft. Mohamed, der Hüter meiner bescheidenen Behausung im andalusischen Stil, die filigrane Schnitzereien, üppige Mosaiken und eine kühle Brunnenoase im Innenhof bietet, erzählt mir, dass M6 sehr wohlwollend mit der derzeitigen Fluchtwelle umgehe. Seit ewigen Zeiten mit menschlichen Wanderungsbewegungen vertraut und über Jahrhunderte vom Karawanenhandel abhängig, gewährt der König den 50.000 Subsahara-Afrikanern im Land relativ umstandslos Arbeitsvisa mit bis zu fünf Jahren Gültigkeit. Schließlich kam die ethnische Mehrheit der Marokkaner, die auch das Königshaus stellt, selbst vor langer Zeit von der arabischen Halbinsel. Heute arbeiten Menschen aus Sierra Leone, dem Senegal, Guinea-Bissau und von der Elfenbeinküste in den Souks. Als Fischer oder Straßenhändler, oft als Kellner, wahrscheinlich nicht gerade zu Spitzenlöhnen. Aber auch Ingenieure und Ärzte kommen bisweilen. Denn Marokko blickt auf eine lange Geschichte der Migration zurück und ist für afrikanische Verhältnisse heute wohlhabend. Definitiv kein „Shithole-Country“. In Marokko blühten Kunst, Kultur und Architektur schon mehr als 400 Jahre vor der Entdeckung Amerikas.
Dieser bescheidene Wohlstand ist einer der Gründe für die Beliebtheit der marokkanischen Dynastie und die Verehrung von M6. Das marokkanische Königshaus legt traditionell großen Wert auf Bildung. M6 sorgte nach Jahrhunderten endlich für die Gleichstellung der Berber, Tamazight – die Sprache der Berber – wurde 2011 zur Amtssprache erhoben. Trotzdem gibt es Verfassungsartikel, die dem König unumschränkte Macht garantieren. Aus demokratischem Blickwinkel ist M6 also ein Despot. Staatsrechtler sprechen von einem „Hybridregime“ aus demokratischen und autoritären Elementen. Offensichtlich liegt M6 aber viel an der Bekämpfung von Armut, Analphabetismus und Korruption. Er erließ ein Familienrecht, das Frauen vor dem Gesetz zu hundert Prozent gleichberechtigt. Das steht in einer patriarchalischen Gesellschaft zunächst zwar nur auf dem Papier – aber irgendwo muss man ja wohl mal anfangen.
M6 tanzte im Kreise der arabischen Despoten deutlich aus der Reihe, als er in der fortschrittlichen Verfassungsreform von 2011 freiwillig Macht abgab und sich im Arabischen Frühling an die Spitze der marokkanischen Bewegung setzte. Seitdem gedeiht die Pressefreiheit zumindest als zartes Pflänzchen, Demonstrationen sind möglich. Kritik am Königshaus verbietet sich selbstverständlich weiterhin. Immer noch sitzen Bürgerrechtler und Blogger in Haft. Irgendwo muss ja auch mal Schluss sein mit dem demokratischen Firlefanz. Bereits in Marokko zeigt sich, dass es offenbar ein Drahtseilakt ist, nach Jahrhunderten mit archaischen Herrschaftsformen aus dem Stand eine erfolgreiche, moderne Gesellschaft zu etablieren. Ich kann verstehen, dass sich der Monarch hier ein letztes Wort vorbehält. Zumindest bis eine Gesellschaft entstanden ist, die auf der Basis eines guten Bildungsniveaus in der Lage ist, ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Undemokratisch? Vermutlich, mir scheint es jedoch ein gutes Zeichen zu sein, dass M6 von den Marokkanern geliebt und im Gegensatz zu seinem Vater Hassan nicht gefürchtet wird. Mag sein, dass ich hier falsch liege, weil die Kritiker sich nicht aus der Deckung wagen. Doch eins darf man bei allem Wohlwollen für M6 nicht vergessen: Wie ergeht es einem Volk, wenn aus einem „guten“ König ein „böser“ wird oder ein solcher auf ihn folgt?
Das Porträt seiner Majestät gehört natürlich deutlich sichtbar in jedem Geschäft, jeder Imbissbude, jedem öffentlichen Gebäude zum Inventar. Mal traditionell gekleidet, mal in Uniform, mal im Business-Outfit. Mal mit Armee, mal mit Pferden, mal mit Porsche, aber fast immer mit Sonnenbrille – einfach cool. Wie viele Herrscherhäuser in der islamischen Welt sieht sich M6 als direkter Nachfolger des Propheten Mohammed. Mich wundert ein wenig, dass er trotz dieser familiären Nähe zum Begründer des Islam so oft fotografiert werden darf. Fast alle traditionell gekleideten Marokkaner lehnen auch noch so höfliche Fotoanfragen ab. Selbst Motorradfahrer scheinen einen sechsten Sinn zu besitzen und reißen in voller Fahrt, noch hundert Meter vom Fotografen entfernt, den Arm vors Gesicht. Der Islam verbietet die Abbildung des Menschen, sagen mir die Einheimischen. Denn laut Koran kann nur Allah erschaffen. Scheint mir etwas weit hergeholt, insbesondere wenn ich daran denke, wie sich Menschen anderer islamischer Länder mit Begeisterung vor die Kamera werfen. Für den König Marokkos scheinen wohl sowieso andere Regeln zu gelten.

Speisen wie in Tausendundeiner Nacht: Restaurant in Chefchaouen

Café-Dachterrasse bereit für die Nachmittagsgäste

MARRAKESCH/MAROKKO
Zum Tee bei einer alten Liebe
Anfang März spuckt mich ein Nachtbus im Morgengrauen weit entfernt von Marrakeschs Zentrum aus. Morgens um sieben, bei 12 °C, Nieselregen aus bleigrauem Himmel und blassen Farben, weckt die Stadt keine anheimelnden Gefühle in mir. Vor mehr als 25 Jahren war das anders. Liebe auf den ersten Blick. Ich war sofort vernarrt in die Stadt. Die Atmosphäre bei meiner mitternächtlichen Suche nach einem Quartier hat mich damals fast paralysiert. Ich fühlte mich wie ein Schlafwandler im Traum von Tausendundeiner Nacht. Nur mit Petroleumlampen beleuchtete Stände, der wabernde Rauch der Grillfeuer, das anhaltende Stakkato der Trommeln und die intensiven Gerüche des Morgenlands, manchmal wohlriechend fremdartig, manchmal faulig. Ein orientalisches Treiben wie aus alten Reiseberichten lebendig geworden, ein Alltagsgeschehen, von dem ich angenommen hatte, dass es längst nur noch auf Zelluloid existiert. Marrakesch war einer der Orte, die meine Reisesucht angefacht haben. An anderen Orten kann man merkwürdige Gebräuche studieren, eine exotische Tierwelt oder unglaubliche Naturlandschaften bestaunen. Mancherorts kann man einen Blick auf die Zukunft erhaschen. Marrakesch hingegen war das beste Beispiel, dass auch Zeitreisen in die Vergangenheit noch möglich sind.
Heute Morgen jedoch hasten nur vereinzelt fröstelnde Menschen über den riesigen, fast menschenleeren zentralen Marktplatz Djemaa el Fna. Es riecht nach Pferdeäpfeln. Unter tiefhängenden grauen Wolken weichen die ersten Lieferanten auf dem Weg zum Souk den großen Pfützen aus. Eher Skandinavien als Orient. Erst gegen zehn schüttelt die Stadt langsam die nächtliche Kälte ab und erwacht zum Leben. Die Geschäfte, manchmal bessere Verschläge oder gar nur ein Loch in der Wand, öffnen. Handwerker beginnen mit der Arbeit. Die großen Arterien des Souks füllen sich nach und nach mit Männern, die in dicke wollene Djellabas gehüllt sind.
Marrakesch scheint nach dem Konzept Haufendorf entstanden zu sein, hat dieses Konzept perfektioniert und auf die Größe einer Millionenstadt ausgeweitet. Keine Gasse verläuft schnurgerade. Schafe, Ziegen und Hühner, winzige Handwerksbetriebe und die dazugehörigen, nicht immer sehr feinen Gerüche verleihen den ruhigeren Teilen der von einer mächtigen Stadtmauer umgebenen Medina heute noch eine dörfliche Aura. Vier- oder fünfstöckige, kastenförmige Gebäude drängen sich dicht aneinander. Abweisende Fassaden mit winzigen Fenstern changieren in allen erdenklichen Ocker- und Rottönen. Oft mühen sie sich an schmalen Wegen vergeblich, Sonnenlicht und Hitze auszusperren. Alle paar Meter zweigen überdachte Gassen ab, schlagen wilde Haken, verengen sich plötzlich und trotzdem zockeln manchmal Eselskarren hindurch. Niedrige überbaute Durchgänge, schmale Pforten, Treppenstufen in die Dunkelheit. Führen die ins Wohnzimmer der Familie Aboutaleb oder zum nächsten kleinen Platz? Nur ausprobieren hilft. Oft sind die Wege so eng, dass nicht einmal zwei Mofas aneinander vorbei passen. Genau das aber – inshallah, „so Gott will“ – dann doch irgendwie hinbekommen. Möglicherweise durch Nutzung eines Paralleluniversums oder eines Lochs im Raum-Zeit-Kontinuum. Ohne eine Miene zu verziehen oder gar das Gas wegzunehmen, halten die Piloten stoisch aufeinander zu. Männer mit Nerven aus Stahl. Genau in dem Moment, in dem ich mich auf quietschendes Gummi, splitterndes Glas, berstendes Metall und danach auf lautes Wehgeschrei gefasst mache, scheint sich die Zeit zu verlangsamen, der Äther wird zähflüssig und schon sind die beiden unversehrt aneinander vorbei. Sehr gerne sogar im eleganten Damensattel. Speed kills! In Marrakesch höchstens die Fußgänger.
Meine ziellosen Wanderungen führen in überraschenden Windungen durch Teppichläden oder enden plötzlich in einer Sackgasse, die einem Lampenladen als Hinterhalt dient. Solche Standortvorteile werden natürlich geschickt genutzt. Eloquente, lächelnde Verkäufer materialisieren sich aus dem Nichts, schneiden den Rückweg ab. Zum Trost wird dem Opfer Tee serviert, wenn es bereit ist, die Anpreisung der neuesten Sonderangebote über sich ergehen zu lassen. Nicht, dass ich die kunstfertigen, teilweise zwei Meter hohen, fein ziselierten orientalischen Kupfer-Grausamkeiten aus dem Lampenladen mit auf die Reise nehmen könnte. Aber ohne Würdigung der Handwerkskunst direkt auf dem Absatz kehrtzumachen, wäre mehr als unhöflich. Vielleicht käme ja auch die Verschiffung in Frage?
In diesem labyrinthischen Irrsinn kann schon mal ein Teil der Stadt für 200 Jahre verloren gehen. Als Sultan Moulay Ismail, mit Beinamen „der Blutdürstige“ (1645–1727), gehässigerweise die Eingänge zur Nekropole seines gestürzten Vorgängers zumauern ließ, brauchten die Stadtväter zwei Jahrhunderte und die Erfindung der Luftfahrt, um sie im Häusergewirr wiederzufinden. Wohl aus lauter Verzweiflung über so viel Chaos am Boden, kartografierten die Franzosen Marrakesch 1917 aus der Luft und stellten fest: Hoppla, da ist ja ein ganzes Stadtviertel, das wir gar nicht kennen! Und ein paar Maueraufbrüche später hatten sie mitten in der Altstadt eine prächtige Nekropole von der Größe mehrerer Fußballfelder entdeckt, die bis dahin anscheinend niemand vermisst hatte.

Exotisches Sortiment: getrocknete Blüten und gerahmtes Krokodil

Eine der belebten Hauptschlagadern im Souk zur Rushhour

Ambulanter „Freiluft-Zahnklempner“ auf dem Djemaa el Fna
Das Herz dieses ganzen städtebaulichen Wahnsinns ist der Djemaa el Fna, ein riesiger, merkwürdig unsymmetrischer Platz. Findet der abenteuerlustige Fremdling nach Stunden tatsächlich wieder aus dem Gewirr des Souk heraus, riskiert er, von der Weite, Hitze und dem gleißenden Sonnenlicht auf dem Djemaa el Fna erschlagen zu werden. Nach der lichtlosen Medina mit ihren überdachten Plätzen, ständig drängenden Käuferströmen, Touristen und überbordendem Warenangebot scheint es, als wollten die Erbauer der Stadt den Augen ihrer Bürger mitten im wimmelnden Ameisenhaufen des Souk – allein schon durch die gigantische Dimension und Weite des Platzes – eine Oase der Erholung gönnen. Mit der Erholung ist das allerdings so eine Sache, stolpert der Reisende nicht gerade morgens vor zehn über den Djemaa el Fna. Danach wird es heiß und voll. Djemaa el Fna bedeutet im Arabischen „Versammlung der Toten“ oder auch „Platz der Gehenkten“. Früher dekorierten die Almohaden-Sultane den Platz mit den aufgespießten Köpfen der Gehenkten. Heutzutage ist der Platz das genaue Gegenteil einer „Versammlung der Toten“ – sehr lebendig. Nach verzweifelten Zählversuchen und meiner nicht ganz fachgerechten Hochrechnung treiben sich zwischen Einbruch der Dunkelheit und Mitternacht bestimmt zwanzig- bis dreißigtausend Menschen auf dem Platz herum. Fliegende Händler aus dem Senegal, Gaukler, Schlangenbeschwörer und Affen-Dompteure bilden die illustre Staffage. Wasserverkäufer zeigen sich in ihrem exotisch rot-goldenen Outfit, Handleserinnen tun ihre Weisheiten kund. Geschichtenerzähler sind in Fünferreihen von Zuhörern umringt. Ambulante Zahnärzte warten am Campingtisch hinter ihren grausigen Instrumenten auf Laufkundschaft. Also, trag deine Wertsachen am Körper, stürz dich ins Gedränge und pass auf, dass du nicht auf eine schlecht beleuchtete Königskobra trittst!
Den Soundtrack zur Szenerie bildet ein Klangteppich ambitionierter Musiker aus allen Regionen Marokkos und der Sahara, die leider ohne Sicherheitsabstand voneinander die unterschiedlichsten Melodien gleichzeitig spielen. Penetrantes Geflöte konkurriert mit dem Jaulen einseitiger afrikanischer Geigen, unterlegt von einem alles durchdringenden, niemals endenden Bongostakkato – das subsaharische Afrika lässt grüßen. Zudem ist der Platz die Garküche der Nation. Hier wird pochiert, gegrillt, flambiert. Hohe Stichflammen erhellen die Nacht und begnadete Grillmeister hantieren mit beeindruckend großen Tierteilen, während ein buntes Völkergemisch aus Marokkanern, Saharawis, Subsahara-Afrikanern und Touristen an den richtigen Stand für Kefta, Tajine oder Harira gelotst werden will. Um dieses Irrenhaus als Weltkulturerbe irgendwie zu fassen zu bekommen, hat die UNESCO für den Djemaa el Fna eigens das Label „Meisterwerk des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit“ erfunden. Wie diese Art von Kulturgut geschützt werden kann, ist mir jedoch vollkommen unklar. Wohl am besten, indem man den Platz einfach zur rechtsfreien Zone erklärt und die Akteure in Ruhe machen lässt. Die Polizei jedenfalls scheint das Durcheinander nur vom Rand her zu beaufsichtigen, sich aus allen zwielichtigen Aktivitäten herauszuhalten und nur beim gröbsten Unfug einzugreifen.
Heute gilt Marrakesch im Westen als hip. Künstler wurden schon vor dem Ersten Weltkrieg von der Stadt angezogen. Seit Yves Saint Laurent, Andy Warhol und Mick Jagger in den 1960er-Jahren die Stadt für sich entdeckten, kaufen sich immer mehr Prominente in Marrakesch ein. Heute ist die Liste der Celebrities endlos.

Schlangenbeschwörer mit zwei Königskobras und Ersatzschlangen bei der Arbeit
Wie viele Ausländer restaurieren sie die Riads – die traditionellen Wohnburgen mit ihren schattigen Innenhöfen und plätschernden Brunnen – oder erneuern die noch vorhandenen Gärten liebevoll. Die Nachtclubs der Stadt gehören zu den angesagtesten der Welt. Erste Cafés servieren Chai Soja Latte und Organic Food. Museen entstehen, Galerien sprießen aus dem Boden, sodass das Geographische Institut der Universität Mainz schon eine Musealisierung als „neo-orientalistische Stadt des Märchens“ beklagt und von der „Materialisierung des Mythos von Tausendundeiner Nacht“ spricht.
Beim Abendessen auf einer Dachterrasse, mit Blick auf das nächtliche Treiben, treffe ich Seydou aus der Casamance im Senegal. Drei Jahre hat der junge zurückhaltende Kellner bereits in Guangzhous großer afrikanischer Community in Südchina gelebt. Deren Mitglieder schaffen alles, was China billig produziert, irgendwie nach Afrika. Seydous Ziel ist ein Job in Europa, in Frankreich vielleicht. China war ihm viel fremder als das Europa, das er aus dem Fernsehen kennt. Deshalb ist er zunächst nach Afrika zurückgekehrt. Natürlich muss er seine Familie in der Casamance unterstützen. Jetzt ist der attraktive Senegalese mit den großen Augen erst einmal Kellner in Marokko – in voller orientalischer Tracht und mit rotem Fez. Immerhin im ersten Haus am Platz. Wie es weitergeht? „Europa ist derzeit außer Reichweite“, sagt er verschmitzt. Mal sehen. Auf jeden Fall soll ich bei seiner Familie vorbeischauen, falls ich auf dem Weg nach Süden in der Casamance vorbeikomme. Seydou bleibt vorerst Teil des weltweiten Heeres von Wanderarbeitern und Billiglöhnern, die darauf angewiesen sind, immer dort zu arbeiten, wo es Jobs gibt. In Europa wäre er, wie wir so gerne abschätzig sagen, ein Wirtschaftsflüchtling. Wie man an Seydou sieht, kommen die – zur Überraschung vieler „Nationalkonservativer“ daheim – gar nicht alle nach Deutschland! Erstaunlich wenige Flüchtlinge emigrieren wirklich nach Europa, nur etwa 100.000 jährlich. Die meisten Flüchtlinge – aktuell knapp sieben Millionen – befinden sich in der Sub-Sahara-Region, viele davon sind Vertriebene im eigenen Land, die meisten anderen leben in Nachbarländern.

Alleinunterhalter mit einem interessanten Instrument
Seydou jedenfalls gibt mir zu verstehen, dass er in Marokko gern gesehen ist und sich immerhin als Gastarbeiter und nicht als Bittsteller fühlt! Pendler, Wanderarbeiter, Gastarbeiter, Wirtschaftsflüchtlinge: Je nach Hautfarbe, nach Abstand zur Heimat oder politischem Zustand der Heimat, wandelt sich ihr Status im Gastland. Für unbeteiligte Betrachter dagegen verschwimmen die Begrifflichkeiten.
Marrakesch sollte eine letzte Station vor der Tristesse der Sahara sein. Zu Besuch bei einer alten Liebe. Die Stadt hat sich definitiv verändert. Es gibt mehr Touristen, mehr Angebote. Ihre maghrebinische Seele hat sie aber noch nicht verkauft. Hoffentlich hat das den Menschen auch ein klein wenig mehr Wohlstand gebracht. Nach fünf Tagen in der Stadt breche ich am späten Nachmittag zu meiner längsten Etappe auf. Mit der 1.400 Kilometer langen Reise nach Dakhla in der Provinz Sahara lasse ich die letzten grünen Oasen Marokkos hinter mir.
Schnell hat der Bus auf dem Weg nach Süden die Palmerie von Marrakesch verlassen und die steinigen Ebenen erreicht. Auch die werden schon bald von kargen braunen Hügeln abgelöst. Erst als die Nacht hereinbricht rückt die vegetationslose, scharf konturierte Gebirgskette des Anti-Atlas etwas näher. Wenn die Sonne wieder aufgeht, wird der Bus die Provinz Sahara, früher als Spanisch Westafrika oder Rio del Oro bekannt, bereits erreicht haben.

LAÂYOUNE & DAKHLA/MAROKKO, PROVINZ SAHARA ODER DEMOKRATISCHE ARABISCHE REPUBLIK SAHARA (DARS)
Brennend heißer Wüstensand
M6 besuchte gerade einen Hammam, als ihm ein Flaschengeist erschien. „Einen Wunsch hast du frei“, bot ihm der Geist an. „Ich möchte wirklich gerne noch einmal mit meinem verstorbenen Vater König Hassan II. plaudern.“ „Oh, einen Toten zum Leben zu erwecken, das ist ein schwieriger Wunsch“, entgegnete der Flaschengeist, „Hast du nicht noch einen anderen Wunsch?“ „Na ja, ich möchte auch gerne, dass die Westsahara ein Teil Marokkos wird“, sagte M6. „O.K., lehn dich einen Moment zurück, entspann dich. Ich schaue derweil, dass ich deinen Vater auftreiben kann!“
Saharawi-Witz
Langsam kriecht das fahle Märzlicht über den Horizont. Es ist acht Uhr morgens und immer noch saukalt, als der Bus Laâyoune, die größte Stadt der ehemals spanischen Sahara, immer noch mehr als 500 Kilometer von Dakhla, verlässt. In Laâyoune war kaum Zeit für einen Tee im Marmorpalast des modernen Busbahnhofs. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise lassen sich Fahrer und Passagiere eine solch gute Gelegenheit für eine anständige Mahlzeit auf einer Langstrecke nicht entgehen. Ich habe den Eindruck, dass man sich in dieser Unruheprovinz nicht länger als nötig aufhalten will. Der Bus hat sich nach Stopps in Agadir und Tan-Tan spürbar geleert. Das ist angenehm, denn ich kann mich über zwei Sitze fläzen. Trostlose, sandfarbene Ortschaften ducken sich alle paar hundert Kilometer unter dem grauen Dunst des Himmels, fade Bedeutungslosigkeit in einem Meer aus Schotter. Hier und da stehen ein paar Zelte im Nichts, ein Fischer an der Steilküste, selten ein paar stromernde Dromedare. Highlight sind ein paar Wüstenblumen an einer sandigen Böschung. Während die gleichförmige Landschaft am Fenster vorbeizieht, nähere ich mich langsam einem meditativen Zustand, tief in mir ruhend. Wenige Pixel im großen Wüstengemälde. Das Meer, wenn es zu sehen ist, wirkt wenig einladend. Meer und Himmel haben die gleiche milchige Farbe und verschmelzen miteinander, ohne dass der Horizont klar auszumachen ist. Die Kontrollen der Sûreté Nationale, der Staatspolizei, häufen sich inzwischen. Der Bus wird durchsucht, zum ersten Mal will jemand meinen Pass sehen.
Pinkelpause in einem Café im Nirgendwo. Eine kaum frequentierte Tankstelle, durch die der Wüstenwind fegt, ein paar weißgetünchte Zementkästen, die das Café und ein paar winzige Motelzimmer beherbergen. Verschlafene Langeweile bis vielleicht einhundert schwer bewaffnete Polizisten der Sûreté Nationale per Jeep, SUV und in Bussen auf einen Kaffee eintrudeln. Zu den Aufgaben der Truppe, die für Marokkos innere Sicherheit zuständig ist, gehört die Grenzüberwachung und die Terrorismusbekämpfung. Sie besitzt mobile Interventionscorps und arbeitet eng mit den Moroccan Auxiliary Forces, einer paramilitärischen Einheit, zusammen. Ihre Ausrüstung erweckt nicht gerade den Eindruck, als würden sie Hühnerdieben nachstellen. Die Scheiben ihrer schicken SUVs sind vergittert. Die höheren Offiziere haben ihre Augen fast ausnahmslos hinter Sonnenbrillen versteckt. Ein surreales Frühstück zwischen schwer bewaffneten Uniformierten, die uns Busreisende völlig ignorieren, folgt. Der Colt muss nicht an der Bar abgegeben werden. Die Zivilisten senken verschüchtert Stimme und Blick, Gespräche verstummen. Fotos verboten. Mehr Kasernenkantine als Raststätte. Offensichtlich muss dieses Meer aus Sand und Steinen schwer gesichert werden.
Die Provinz Sahara befindet sich offiziell in einer Art Schwebezustand. Hier, in Afrikas letzter Kolonie, schläft ein fast vergessener Befreiungskrieg, während Marokko Fakten schafft. Wie ist es möglich, sich über den Besitz eines derart trostlosen Landstrichs so sehr in die Haare zu kriegen, dass bislang schon über eine Milliarde Dollar in Frieden stiftende UN-Missionen versenkt werden musste?
1884/85 bekamen die Spanier diese fast menschenleere Wüstenregion zugesprochen, die offensichtlich keine der anderen Kolonialmächte haben wollte. Nach vielversprechenden Phosphat-Funden verlangten Marokko und Mauretanien die Entkolonialisierung der Westsahara. Spanien blieb jedoch und so gründete sich 1973 die linksgerichtete POLISARIO und begann den bewaffneten Kampf der Saharawis gegen die spanische Herrschaft. Inzwischen hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag entschieden, dass die spanische Sahara bei Kolonialisierung kein herrenloses Territorium war, sondern sich in einer Treueeid-Beziehung Marokko unterworfen hatte. Mit diesem Urteil in der Tasche setzte der marokkanische König Hassan II. seinen lang gehegten Plan zur Einverleibung des Territoriums in die Tat um. Im November 1975 marschierten über 350.000 Menschen beim sogenannten „Grünen Marsch“, nur kärglich mit Koran und grünem Stern auf roter Fahne bewaffnet, über die Grenze und holten die verlorene Provinz heim nach Marokko.