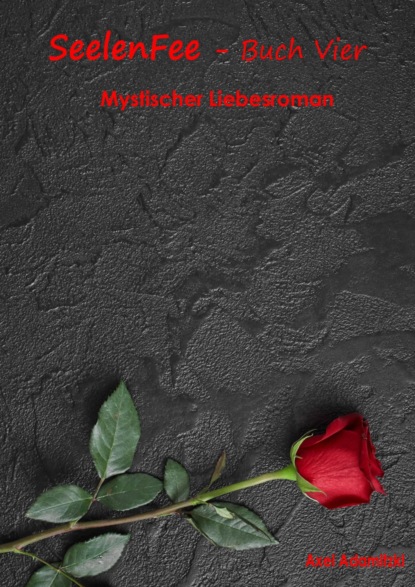SeelenFee - Buch Drei

- -
- 100%
- +
Den Kopf an Elektras Schulter gelehnt, ließ Bella sich streicheln, und immer wieder sagte sie nur: »Es tut mir leid, Leeki, es tut mir alles so furchtbar leid.«
Die eben noch kaum aushaltbaren Schmerzen im Unterleib waren plötzlich erträglich.
Bella war wieder da.
Und erneut hatte sie diesen Moment vor Augen, den Moment vor Stunden, als ihre geliebte Freundin das Krankenzimmer betreten hatte. Zögerlich waren ihre Schritte ins Zimmer gewesen. Sie hatte kaum gewagt, den Blick zu heben.
Stefan Bürgli verstand die Situation sofort, und er ließ sie taktvoll allein, jedoch nicht, ohne vorher noch einmal darauf hinzuweisen, dass jede Aufregung den Heilungsprozess nachhaltig behindern könnte. Er war ihr Arzt, er musste so reden, doch vernahm Elektra seine Worte nur verschwommen hinter einer grenzenlosen Vorfreude.
Und endlich waren sie allein.
Schweigend stand Bella da. Den Kopf noch immer gesenkt verknotete sie aufgeregt die Finger. Ihr Gesicht war schmal geworden. Noch immer trug sie ihr glattes schwarzes Haar halb lang, und noch immer glänzte es wie lackiert; und die Augen, diese dunkelbraunen Augen, in die Elektra stets voller Liebe versunken, nein, mehr noch, entrückt war, jagten jetzt aufgeregt über den Fliesenboden und fanden keinen Halt.
Elektras Blick wanderte bedächtig weiter.
Über einem dunkelroten Sommerkleid, das sie nicht kannte, hatte Bella eine schwarze dünne Strickjacke gezogen, die wunderbar mit den Ballerinas an ihren Füßen harmonierte. Ihre Beine, die eben über den Knien unter dem Kleid verschwanden, waren nackt. Erst jetzt wurde Elektra deutlich, wie sehr sie auch diesen Anblick vermisst hatte. Und die Hüften, die vielen etwas zu breit erschienen, die aber die Weiblichkeit ihrer geliebten Bella vollendet zum Ausdruck brachten, hatten sich nicht verändert, waren nicht mehr und auch nicht weniger geworden – wie gern hatte sie die stets gestreichelt und liebkost.
All das betrachtete sie stumm, all das war wieder wahrhaftig vor ihr … bei ihr. Bella war wieder da.
»Hallo«, sagte sie schließlich. Nur »Hallo«, wobei dieses eine Wort den Raum kaum berührte. Und sie wartete. Kein falsches Wort, dachte sie, sag um Gottes willen kein falsches Wort. Zu fragil war dieser Moment.
»Was … was ist mit dir passiert, Leeki?«
Leeki! Ihr Kosename aus dem Mund ihrer geliebten Bella. Wie sehr hatte sie auch das vermisst. Und er ließ sogleich all ihren Schmerz beinahe gänzlich vergessen. Doch sie wollte jetzt nicht von sich sprechen, sie wollte …
»Du hast mich gesucht?« Was für eine dumme Frage. Viel lieber hätte sie die Arme weit geöffnet und gerufen: Komm her. Doch zu früh … zu fragil.
»Es tut mir alles so leid, Leeki. Ich war entsetzlich dumm.« Und endlich hob Bella den Kopf, die Augen schwammen in einem Meer von Tränen. »Du fehlst mir, Leeki. Alles würde ich dafür geben, unseren Streit ungeschehen machen zu können. Der war so sinnlos, das weiß ich heute. Bitte, glaub mir das, Leeki.«
Ja, sie glaubte ihr, auch weil sie ihr glauben wollte, und auch weil dieser Streit in den letzten Monaten für viel Unbehagen und Ruchlosigkeit gesorgt hatte – in allem, was Elektra gedacht und getan hatte. Wieder einmal, wie nur allzu oft in ihrem Leben, war sie ihrem Schatten gefolgt. Voller Verachtung, dennoch auch voller Lust. Oh, wie sehr hasste sie sich dafür. Auch wenn alle Welt glaubte zu wissen, dass sie so war – nur so, ruchlos und niederträchtig! –, so hatte es doch zwei Menschen gegeben, die mehr von ihr kennengelernt hatten: Rafi und Bella.
Nicht einmal Raymond hatte sie so ganz anders gekannt, obwohl er es verdient gehabt hätte, doch damals … Sie war zu jung gewesen, sie hatte sich selbst noch nicht verstanden – das kam erst viel später. Mit Rafi und Bella.
Und dann waren ihr diese beiden Menschen abhandengekommen. Rafi war tot und Bella …?
»Oder willst du darüber reden, Leeki?«, fragte Bella zögerlich.
Elektra zuckte die Achseln, schüttelte den Kopf, und sie erinnerte sich.
Vor beinahe sechs Monaten, es war Anfang Oktober gewesen, war es zu einem unsäglichen Streit zwischen ihnen gekommen, der Stunden später alles verändert hatte. Bella hatte nicht nur Elektras Anwesen und dann alsbald Kolumbien verlassen, sie war unauffindbar entschwunden. Über mehr, obwohl es sie bis gestern … obwohl es sie hier in dieses Krankenbett gebracht hatte, wollte Elektra jetzt nicht nachdenken. Keine Details, bitte, keine Details. Sie wollte nach vorn blicken, nur nach vorn, was im Moment schwer genug war, nein, was hoffentlich ganz leicht werden würde.
Bella war wieder hier.
»Nein, Bella, das will ich nicht. Lass uns lieber an heute und morgen denken. Wenn du möchtest.«
Bella lächelte kurz und kam einen Schritt näher. »Darf ich?«
Elektra nickte nur.
Und Bella fuhr kaum vernehmbar fort: »Du … du fehlst mir, Leeki. Du fehlst mir so entsetzlich. Ohne dich, nein, ohne uns möchte ich nicht sein. Ich liebe dich.«
Ich liebe dich. Diese drei Worte aus Bellas Mund. Sie ließen für den Moment alles vergessen.
»Komm her. Du fehlst mir doch auch.«
Und im Handumdrehen war Bella dann endlich neben ihr gewesen, und Elektra hatte die Bettdecke gehoben. »Komm ganz nah zu mir, aber vorsichtig.«
So lagen sie jetzt hier. Und bis auf die leisen und beinahe mantraartig wiederkehrenden Worte aus Bellas Mund – »Es tut mir leid, Leeki, es tut mir alles so furchtbar leid« – war es still. Selbst draußen war der Tag allmählich zur Ruhe gekommen.
Jählings nachdenklich geworden, blickte Elektra zur Zimmerdecke, die in der Zwischenzeit im Halbdunkel lag, während sie unaufhörlich ihre geliebte Bella streichelte.
Wie sehr hatte sie von diesem Moment geträumt, immer wieder. Wie sehr hatte sie auf diesen Moment gehofft und ihn sich ausgemalt. Immer und immer wieder. Wie viele schlaflose Nächte voller Tränen, voller Zweifel hatte sie hinter sich gebracht.
All das war vorbei. Bella lag endlich wieder neben ihr, aber …
Aber? Plötzlich schlich sich da tatsächlich ein Aber in ihre Gedanken.
Ein Aber, doch woher kam es?
Natürlich wollte sie nur noch an heute und morgen denken, dennoch spürte sie es deutlich, dieses vermaledeite Aber. Obwohl sie es nicht wahrhaben wollte, obwohl sie versuchte, es zu überhören, es abzuschütteln, ließ es sie nicht entkommen, kam es aus der Vergangenheit hervorgekrochen.
Wo war jetzt die Zuversicht, von der sie glaubte und hoffte, dass sie sie in sich trug, von der sie glaubte und hoffte, dass sie sich jedem Widerstand, auch einem einfachen Aber entgegenstellen würde?
Elektra wartete, doch da kam nichts. Waren all die Tränen umsonst geweint?
Nein, das wollte sie nicht. Und das durfte auch nicht sein.
Natürlich war sie dankbar für ihr neuerliches Glück, und ganz sicher war sie jetzt auch beseelt. Bella war wieder bei ihr, aber irgendwie nicht so, wie sie es erwartet, wie sie es sich ausgemalt hatte.
Irgendetwas hatte sich verändert – in ihr, mit ihr.
Ganz sicher wollte sie auf Bella nicht mehr verzichten, auch wollte sie Bella keine Vorwürfe machen, nicht heute und auch nicht später, denn sie, Elektra, war immer die Stärkere, die Erwachsene gewesen.
Doch war sie das wirklich?
Plötzlich, wie aus einem unbarmherzigen Dunkel heraus, stolperten ihr dann doch ein paar unliebsame Fragen durch den Kopf: Und beim nächsten Mal? Beim nächsten Streit? Was wird da sein? Wirst du wieder so unsagbar hilflos sein? Wirst du wieder nur deinem Schatten folgen? Wird sich alles wiederholen?
Halt! Schluss jetzt, all diese Gedanken sind blanker Unsinn.
»Nein, es wird ganz einfach kein nächstes Mal geben«, flüsterte sie vor sich hin.
Unbedarft hob Bella den Kopf und sah sie an. Und sie lächelte, schien von dem Kampf, der in Elektra tobte, nichts zu spüren.
Oder doch?
»Ja, das verspreche ich dir, Leeki, es wird kein nächstes Mal geben. Nie wieder werden wir uns trennen. Du bist mein Leben, Leeki.«
Ja, so war es, so ist es, so musste es sein, denn auch Bella war ihr Leben.
Und bald schon spürte sie, wie dieses Aber, dieser Widerstand, dieser Schatten, ihr Schatten, mehr und mehr an Kraft verlor, wie er gekränkt und mit hängenden Schultern seinen Platz weit hinten in ihren Gefühlen einnahm, wie er betroffen und schockiert den Kopf senkte.
Vorn lebte sie, Elektra. Leeki.
Endlich wieder.
Allein für Bella. Nur für Bella.
Was Elektra nicht spürte und auch nicht sah, war das weit geöffnete Gehör ihres Schattens, das selbst das kleinste Geräusch, das geringste Missfallen vernahm.
Er horchte und wartete.
29 – Sie musste ihn …
… beschützen. Weil er es allein nicht kann.
Ein Baby beschützte einen Mann, einen erwachsenen Mann, nein, mehr noch … den Vater. Weil er es allein nicht konnte.
Ist das nicht gänzlich absurd?
Und wie sie es tat: Diese schwarzen Augen und das Beben und am Ende das Aussehen einer Hundertjährigen, die alsdann ihre, Silvanas, Hilfe benötigte. Was für eine groteske Reihung von Unmöglichkeiten.
War das alles noch ein einfacher Traum gewesen? Oder war es am Ende einer realen Begebenheit entsprungen? Kein Traum, vergangene Wirklichkeit?
Das Aussehen einer Hundertjährigen. War das der versteckte Hinweis auf Rosas Fieber?
Und war Raymond tatsächlich mit Rosa hinter einem Deich am Meer gewesen? Hatte es dort diese Begegnung mit einer Frau in Weiß gegeben? Und war diese Frau am Ende Elektra gewesen?
Vielleicht, vielleicht war das alles so.
Und was war mit …?
Und endlich wagte sie sich auch an den letzten Teil, an den Teil, der gänzlich widersinnig schien: Georg und die Schatten.
Stumm lag Silvana in dem Bett im Schlafzimmer der Gästewohnung, und sie spürte, wie diese zwei Worte … die Schatten … etwas in ihr veränderten, etwas in ihr erwachen ließen. Die Schatten, lange nicht vernommen, kamen schleppend zurück. Und merkwürdigerweise erschreckte sie das nicht, mehr noch, sie ließen beinahe alles andere unwichtig werden. Zumindest für den Moment.
Und warum Georg? Warum war er es, der alles aufweckte?
Hatte Georg, dieser gänzlich fremde Mann, der mit wenigen Worten und Gesten bereits die Tochter in ihr geweckt hatte, sie so ergreifend beeindruckt? Oder gab es eine ganz andere Erklärung für all das Geträumte?
»Die Schatten, die du schon so lange kennst, sie sind dein Leben«, waren Worte, die sie wohl nie wieder vergessen würde, mehr noch, die ihr Kraft gaben, Kraft für ihr Leben – und die ihr Leben gänzlich verändern sollten.
Irgendwann in den nächsten Tagen würde sie das Gespräch mit Georg weiterführen müssen. Auch wenn er sie merkwürdig ansehen sollte.
Aber jetzt war eine andere Frage viel wichtiger: Wie geht es Rosa?
Eben schien es, als hätte sie das Fieber überwunden, was beinahe unmöglich war. Dennoch verwunderte Silvana das kaum noch, war doch an diesem Baby beinahe alles »unmöglich«.
Angestrengt horchte sie in die Stille. Und dann hörte sie ihn wieder und wieder, ihn, woran all ihre Hoffnung hing: Rosas leisen und regelmäßigen Atem. Sie schlief tief und fest.
Seit etwa zwei Stunden lag die kleine Prinzessin im Nebenzimmer wieder in ihrem Bettchen, auch das war Teil ihres Rituals … Dem Morgen begegnen wir im eigenen Bett.
»Ich lasse die Tür offen, meine Kleine. Ich bin nebenan, nah bei dir«, hatte Silvana noch gesagt, nachdem sie das Baby ein letztes Mal in der Nacht versorgt hatte. Und bald schon war Rosa in einen tiefen Schlaf gefallen. Das Fieber, wie und warum auch immer, schien tatsächlich überstanden. Dennoch … »Schlaf ist die beste Medizin«, war eine profane Weisheit nicht nur ihrer Mutter, die Silvana nun endlich immer ruhiger werden ließ. Für Minuten, nur für wenige Minuten.
Denn plötzlich, wie aus dem Nichts, als ihr noch einmal dieser andere, dieser sehr merkwürdige Hinweis – »Später, wenn alles vorbei ist, dann bade darin. Sie nehmen alles Gift von dir« – durch den Kopf ging und sie sich zu erinnern versuchte, was das war, worin sie baden sollte, vernahm sie ein erstes Zittern, das von einem zum nächsten Augenblick gewaltiger wurde. Es durchdrang sie, umklammerte sie blitzartig und unverrückbar, wie es schien, und nahm ihr beinahe den Atem.
Was … was ist das?
Ist das das Gift? Wirkt es jetzt? Aber welches Gift?
Hastig brach sie all ihre Gedanken ab. Dieses Zittern wurde schlimmer und schlimmer.
Was ist das?, wiederholte sie lautstark im Kopf.
Aber noch bevor sie eine Antwort fand, ließ dieses Zittern wieder nach.
Sie versuchte durchzuatmen, doch das ging nicht. Ein weiteres, abscheulich tiefgehendes Ungemach ergriff sie: ein Schwindelgefühl! Alles drehte sich plötzlich. Schneller und schneller wandte sich die Wirklichkeit aus ihrem Dasein, entglitt sie ihr, und dann kam es, das eigentliche Übel: Schweiß, kalter übel riechender Schweiß!
Unsagbar viel kalter Schweiß, seimig und moderig, drängte augenblicklich aus jeder Pore, lief ihr sogleich in breiten Bächen über die Haut und tropfte, nein, ergoss sich zäh auf das Laken. Es war schaurig, und es ließ nicht nach. Sie versuchte, ihn sich abzuwischen, mit der Hand, mit der Bettdecke, aber es war sinnlos. Mehr und mehr Schweiß strömte nach, und bald schon war der Raum gänzlich erfüllt von einem faulig beißenden Gestank, der sich auf alles legte, was sich ihm darbot – unverrückbar, unabänderlich –, auf das Bett und die Stühle, auf die geöffnete Tür zum Nebenzimmer und ebenso auf ihre Gedanken und all die unbeantworteten Fragen.
Und auch das Schwindelgefühl wurde stärker und stärker.
Das Bett, es begann zu wandern, erst träge, bald schneller und schneller, so schien es ihr. Die Wände, sie drehten sich und kamen auf sie zu. Die offene Tür zu Rosas Zimmer wurde kleiner und kleiner und schoss plötzlich, groß wie der aufgerissene Rachen einer Riesenechse, auf sie zu und beugte sich über sie.
Sie verlor den Bezug zur Wirklichkeit. Gänzlich. In ihren aufgerissenen Augen gab es nur noch Angst.
Ich muss nach Hause, dachte sie nur noch, ich muss sofort nach Hause. Nur dort bin ich sicher. Was für ein verloren törichter Gedanke. Aber er lenkte ab, so schien es.
Sie warf die Bettdecke zur Seite und wollte aufstehen, sich diesem Schauder dieser Illusionen, etwas anderes konnte es nicht sein, entgegenstellen, um sich dann augenblicklich fortzustehlen. Nach Hause.
Doch das ging nicht, sie kam nicht hoch. Auch war sie noch immer beinahe nackt. Nackt!
Und jetzt?
Sie warf den Kopf herum, wollte sich umschauen, versuchte es, aber ihr Blick betrog sie, fing nichts ein, an dem sie sich hätte festhalten können. Die Wirklichkeit löste sich mehr und mehr auf.
Sie war hilflos, und sie war nackt.
Nein, das durfte nicht sein. Sie würden gleich kommen, Paula und Sibylle und der Arzt. Und auch Ray. Niemand durfte sie so sehen. Kein Blick durfte auf ihre entsetzlich hilflose Nacktheit fallen.
Sie ließ den Kopf auf das Kissen fallen und schloss die Augen, und sie versuchte, sich zu erinnern: Wo hatte sie ihre Sachen abgelegt?
Im Bad. Ein erster klarer Gedanke. Doch niemals würde sie es dort hinschaffen. Die Wände, der Boden, alles tanzte bedrohlich.
Dann deck dich zu, hoch bis unters Kinn.
Sie war nackt und sie war … Rasch riss sie die Augen auf. Nein!, noch immer war nichts von Bestand, nicht die Zimmerdecke, nicht die Wand zu ihrer Rechten, auch nicht die Wand zu ihrer Linken. Alles bewegte sich. Wellenartig kam ihre Umgebung auf sie zu, ging von ihr weg und kam wieder zurück. Und alle Farben verschwammen, lösten sich auf, verschmolzen zu einem grässlich stumpfen Braun.
Was passiert hier?
Sie schloss erneut die Augen, horchte angestrengt nach innen. Nichts. Nein, stopp! Da war etwas: Schafgarbenblüten, löste sich plötzlich aus der Tiefe ihrer Erinnerungen … Schafgarbenblüten! Nur ein Wort. Mel hatte davon gesprochen. Im Traum. »Ein Bad mit Schafgarbenblüten. Wenn alles vorbei ist«, hatte sie gesagt.
Silvana verschwendete keinen zweifelnden Gedanken daran, ob das wahrhaftig helfen würde, zu grotesk war das alles – sie glaubte einfach daran.
Ein Bad in Schafgarbenblüten war eine Hoffnung.
Aber woher nehmen?
Sie überlegte kurz, nur kurz, dann schüttelte sie den Kopf. Resigniert und verloren. Nein, es gab keine Hilfe. Schafgarbenblüten blieben ohne Hoffnung.
Schließlich wollte sie nur noch lachen, ihre Hilflosigkeit durch ein Lachen offen legen, denn sie begriff, sie war gefangen im Trugbild eines Wortes. Und sie wollte es hinausschreien, doch die Lippen, der Mund, die Zunge, sie gehorchten ihr kaum. Ihr Lachen und ihr Schreien mischten sich zu einem entsetzlichen Krächzen.
Dieses eine Wort – Schafgarbenblüten –, der vermeintliche Schlüssel zurück ins Leben, war dann auch bald bedeutungslos.
Dunkelheit, wohltuende Dunkelheit trat auf sie zu, ließ Wände, Türen und Farben verschwinden – brachte Ruhe.
O ja, komm näher, mein Freund, wärme mich und lass mich alles vergessen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.