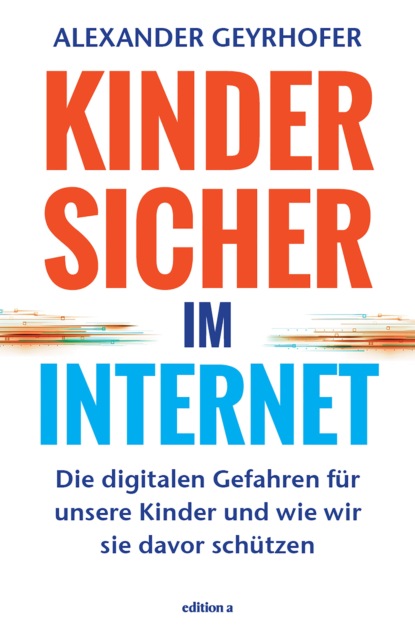- -
- 100%
- +
Dann bekommt es sein erstes Laufrad. Mitsamt Schutzausrüstung. Ein Sturzhelm. Dazu Ellbogenschützer. Auch das erste Fahrrad ist gesichert. Mit Stützrädern. Später werden sie abmontiert.
Bei mir und meinen Kindern war es nicht anders. Auch ich bin besorgt hinter ihnen hergelaufen, als sie allein die ersten, wackeligen Meter zurückgelegt haben. Ich habe sie vorerst am Gepäckträger gehalten. Das Gleichgewicht fürs Radfahren zu halten, will eben erlernt sein.
Beim Skifahren, Snowboarden und anderen Sportarten schlagen wir oft andere Wege ein. Da schicken wir unseren Kleinen zu Profis, die sie den Umgang mit den Sportgeräten lehren. Dazu auch gleich alle Sicherheitsvorkehrungen, die man eben so braucht. Im Straßenverkehr, wo bekanntlich besonders viele Gefahren lauern, ist es genauso. Zu Beginn zeigen noch wir ihnen, worauf es ankommt. Etwa beim Queren einer Straße auf dem Schutzweg. Oder auch, wo sonst Gefahren auf dem Schulweg lauern. Hier kommen auch schon die Verkehrserzieher der Polizei ins Spiel. Sie machen Schulbesuche. Später folgen Fahrradprüfung, Mopedführerschein. Dann der Führerschein. Der L17 womöglich, wo wir selbst mit der Jugend viele Kilometer abspulen. Dreitausend mindestens. Graue Haare, die uns dabei auf dem Beifahrersitz spontan wachsen, sind keine Seltenheit. Das alles, weil wir letzten Endes unsere Kinder beschützen, sie auf die Gefahren auf dem Highway vorbereiten wollen.
Nun die Frage der Fragen:
Warum lassen wir unsere Kinder dann auf diesem anderen Highway, dem Datenhighway, allein? Wo ist da auf einmal unsere Verantwortung abgeblieben?
Vermutlich zählen Sie als Leserinnen und Leser dieses Buches zu den sogenannten Digital Immigrants. So wie ich. Zu jenen Menschen also, die nicht mit der digitalen Welt aufgewachsen sind. Die erst hineinwachsen mussten. Oftmals nicht ohne große Mühen.
Können wir uns als digitale Zuwanderer so einfach der Verantwortung entziehen? Sind wir, weil es nicht von vornherein unsere Welt gewesen ist, davon befreit, andere Bewohner zu beschützen? Gelten Ausreden wie »Ich kenne mich da nicht aus.«? Dürfen wir eigene Verpflichtungen ohne weiteres auf andere abwälzen? Auf den Schulbetrieb zum Beispiel?
Beantworten wir auch nur eine dieser Fragen mit Ja, so zählen wir zu ihnen: den digitalen Verweigerern. Den digitalen Außenseitern.
Kritische Situationen gibt es für Kinder auch in ihrer Internet-Existenz immer und überall. Sie damit allein zu lassen, ist grundfalsch. Wie sonst auch, benötigen Heranwachsende immer wieder Ansprechpartner. Jemand, dem sie uneingeschränkt vertrauen können. Wie solch kritische Situationen im World Wide Web aussehen können, möchte ich Ihnen in den folgenden Kapiteln in allen Einzelheiten offenlegen.
Immer wieder bin ich auf Eltern oder Lehrkräfte getroffen, die es mir offen ins Gesicht gesagt haben: »Facebook? WhatsApp? Keine Ahnung. Da kenne ich mich nicht aus. Interessiert mich auch nicht. Ich will mich erst gar nicht damit befassen.« Allesamt Menschen, die täglich mit Kindern zu tun haben.
Solche Signale erreichen dann nicht nur mich in einem einmaligen Gespräch. Sie werden im Gegenteil an die Kinder dieser Menschen, an ihre Schutzbefohlenen ausgesendet. Tag für Tag. So werden aus anfangs vielleicht noch kleinen Problemen rasch größere. Weil niemand da ist, der sich ihrer annimmt.
Würde ich mit meinem Auto in die Tischlerei fahren, wenn die Motorkontrollleuchte blinkt? Sicher nicht. Kinder tun das ebenso wenig. Sie haben feine Antennen dafür, wer im Problemfall für ihre Anliegen da ist. Und vor allem, wer nicht. Wenn wir das doch sein wollen, bleibt nur dieser eine Weg:
Auf in Richtung Medienkompetenz!
Kinder müssen immer dafür gerüstet sein: für den Worst Case. Sie müssen genau wissen, an wen sie sich im Notfall wenden können. Seien es die Eltern. Seien es die Lehrer. Ein Onkel. Eine Tante. Pate oder Patin, Freunde der Familie. Wer sich in der Medienlandschaft auskennt und zugleich das Gefühl vermittelt, ein immer offener, vertrauenswürdiger Gesprächspartner zu sein.
Natürlich gibt es auch zu diesem Thema Studien. Eine davon, für den gesamten EU-Bereich erstellt, ergab beispielsweise in punkto Mobbing: Kinder und Jugendliche erwarten sich da am ehesten Hilfe unter ihresgleichen, in der Peergroup. Bleibt diese Unterstützung aus, werden Erwachsene zu Rate gezogen. Wenn es denn welche gibt, die in Frage kommen. Denn die (oft nicht unberechtigte) Angst davor, Eltern etwa könnten überreagieren, verhindert diesen Schritt. Etwa, weil verlangt würde, den Facebook-Account zu löschen, weil der Internetzugang gesperrt oder das Smartphone überhaupt einkassiert würde.
Was ist der nächste Schritt?
Oft genug dieser: das Outing in einem x-beliebigen Internetforum. Auch dort haben sich längst jene dunklen Charaktere eingenistet, mit denen unsere Kinder besser nicht in Kontakt kämen. Erinnern wir uns nur an das besonders tragische Beispiel von Amanda Todd, das Mädchen aus dem kanadischen Vancouver. Amanda wurde nur 15 Jahre alt. Zu Tode gemobbt. In einem achtminütigen, bewegenden und um die Welt gehenden Video erzählte sie auf Karteikarten ihr Schicksal, nahm Abschied. Danach beging sie Selbstmord.
Ihre Geschichte entstammt nur auf den ersten Blick einer fernen Welt. In Wirklichkeit ist es eine Allerweltsgeschichte. Ebenso gut hätte sie in Österreich oder Deutschland spielen können. Und sie hat auf besonders tragische Weise klargemacht:
Kinder müssen aktiv auf das Internet vorbereitet werden. Auf seine Vorteile.
Und auf seine Gefahren.
Kinder müssen wissen, was es mit der Anonymität im Netz auf sich hat. Kinder müssen wissen, dass es Phänomene wie dieses gibt: Genderswapping. Dass dies nichts anderes bedeutet, als dass Männer sich als Frauen und Frauen sich als Männer ausgeben.
Doch damit nicht genug: Kinder müssen auch wissen, dass sie niemals schuld sind, wenn sie Opfer einer Straftat im Internet werden. Kinder müssen wissen, dass ihnen keine Gefahr droht, wenn sie sich jemandem anvertrauen. Dass sie deshalb nicht ihren Zugang zu Social Media verlieren. Weil Social Media und Co. ein wichtiger Teil ihrer Entwicklung sind. Weil Social Media und Co. zu ihnen gehören wie vieles andere auch. Weil Social Media und Co. ebenfalls zur sozialen Entwicklung eines modernen Menschen zählen. Weil das außer Streit stehen muss. Strittig sein sollte allein, wie wir damit umgehen.
SMARTPHONES – SEGEN ODER FLUCH?
Können, sollen, dürfen, müssen wir unsere Kinder, weil wir sie doch beschützen wollen, vom Gebrauch von Handys ausschließen? Oder sollen wir sie walten und schalten lassen, wie sie wollen? Ist das eine zeitgemäß und das andere sinnvoll?
Geht es uns da nicht allen gleich, mal mehr, mal weniger?
An manchen Tagen verfluchen wir das Ding, wünschen es irgendwo hin, nur nicht in unsere Nähe. Weil es uns belastet, weil es an uns hängt, wie ein Klotz am Bein. Wie festgekettet. Weil es uns zu Sklaven macht. Und zugleich möchten wir es nicht missen, können uns ein Leben ohne nicht so recht vorstellen.
Nicht so recht? Nein, gar nicht.
Ein überaus zwiespältiges Verhältnis, das wir zu unserem ständigen Begleiter aufgebaut haben. Doch es ist allgegenwärtig. Die Zahlen belegen das auch. In beinahe jedem Haushalt im gesamten deutschsprachigen Raum gibt es mindestens eines davon. Oftmals jedoch mehrere.
Das Mobiltelefon.
Wir sollten es ausschließlich zum Telefonieren benutzen. Das sagen in der Regel bloß jene, von denen wir schon als digitale Außenseiter gehört haben.
Telefonieren als beliebteste Handy-Funktion ist im Ranking mittlerweile weit abgeschlagen, rangiert erst an sechster Stelle. Davor WhatsApp, Musik hören, fotografieren, Youtube und andere Streamingdienste, Internetsurfen.
Dann erst der Zweck, für den es irgendwann einmal entwickelt wurde: telefonieren.
Wir wissen es natürlich, vergessen es aber im Alltag allzu gerne: Unsere Kinder leben nach, was wir vorleben. Nonverbale Kommunikation. Sei es in Text, Bild, Video oder Ton. Sich unterhalten im Sinne von unterhalten werden, sich informieren. Dass diese sogenannten Instant Messenger, die uns digitale Kommunikation in Echtzeit ermöglichen, auch als Tatwerkzeug missbraucht werden, steht auf einem anderen Blatt Papier. Dazu kommen wir noch ausführlich (siehe Cyberbullying).
Bleiben wir noch beim Smartphone an sich. Bei seiner bloßen Existenz. Dass unsere Sprösse eines Tages eines besitzen und benutzen, ist kaum zu verhindern. Irgendwann bricht bei so gut wie jedem Elternteil die Mauer des Widerstands ein. Ich selbst, als Vater von vier Kindern, weiß nur allzu gut, welche Probleme im Umgang mit dem Handy auftauchen können. Auch ich musste lernen.
Es ist notwendig, strikte Regeln für den Umgang mit dem Smartphone festzulegen. Vor dem erstmaligen Gebrauch. Darum mein Tipp an Eltern, als Diplomsozial- und Gewaltpädagoge, aber auch einfach nur als Vater:
Zögern Sie die Erlaubnis für das Handy hinaus, solange es nur irgendwie geht.

Aus der Praxis
Bei Mateo, meinem jüngsten Sohn, gelang es meiner Frau und mir, den Besitz eines Handys bis in die Neue Mittelschule hinein zu verschleppen. In Zeiten wie diesen fast schon ein kleines Wunder. Mitte des ersten Schuljahres kam Mateo eines Tages nachhause, sagte: »Papa, es sind noch genau zwei Schüler in unserer Klasse, die kein Smartphone besitzen. Du willst hoffentlich nicht, dass ich der Letzte bin.«
Damit hatte er mich geknackt. Ich ließ mich erweichen. Wir marschierten los und kauften sein erstes Handy. Je länger ich über seine Worte nachdachte, desto mehr wurde mir bewusst, unter welch sozialem Druck er gestanden haben musste. In seinem Alter, mit zehn, noch kein Smartphone sein eigen zu nennen und somit auch nicht über WhatsApp kommunizieren zu können, bedeutet:
Du bist nicht dabei.
Das war er bis dahin tatsächlich nicht. Mangels Handy war er eben in keiner der vielen WhatsApp-Gruppen seiner Klassenkameraden dabei. Und natürlich auch nicht in jener der Jugendfeuerwehr. Er stand nicht nur im Eck, nein, er war obendrein von vielerlei Information ausgeschlossen.
Das Phänomen FOMO
Die Angst junger, sich in der Entwicklung befindlicher Menschen, etwas zu verpassen, wie auch die Sorge, andere könnten beliebter und aktiver sein als man selbst, ist allgegenwärtig. Der Psychologe Andrew K. Przybylski von der englischen University of Essex gab diesem Phänomen einen Namen:
FOMO. Die Abkürzung steht für fear of missing out.
Przybylskis Untersuchungen ergaben, dass vor allem junge Männer diesbezüglich sehr anfällig sind. Bei ihnen ist die Befürchtung, nicht an wichtige Informationen zu gelangen und die tollsten Erlebnisse zu versäumen, besonders stark ausgeprägt. Je jünger, desto schlimmer das Gefühl, nicht dazuzugehören.
Worum es dabei geht?
Unter anderem auch um Autonomie. Je intensiver das Phänomen FOMO auftritt, desto mehr haben Jugendliche das Bedürfnis, sich auf Facebook einzuloggen. Insbesondere noch knapp vor dem Zubettgehen. Und unmittelbar nach dem Aufstehen. Weil sie wissen »müssen«, was gerade so abgeht.
Am FOMO-Phänomen Leidende nutzen deshalb das Smartphone nicht zwangsläufig länger als andere. Dafür ecken sie viel öfter in der analogen, nicht-virtuellen Kommunikationswelt an, weil sie für das Smartphone bedeutend mehr Aufmerksamkeit aufbringen als für ihr Gegenüber, mit dem sie sich gerade unterhalten.

Aus der Praxis
Wieder von meinem Sohn Mateo. Beim Kauf seines ersten Handys haben wir diverse Regeln vereinbart. Bei Bruch einer dieser Regeln stand folgende Konsequenz im Raum: Entzug des Gerätes auf bestimmte Zeit.
Das in der Praxis auch umzusetzen, ist – Sie können es sich bestimmt lebhaft vorstellen – alles andere als einfach. Härtester Elternalltag. Doch so schwer es sein mag, so wichtig ist es. Als Eltern dürfen wir nicht müde werden, die Einhaltung solcher Vereinbarungen einzufordern und auch gegebenenfalls zu handeln.
Folgende drei Regeln haben Mateo und ich vereinbart:
1. Bis zur Beendigung seines 13. Lebensjahres darf ich den Handyinhalt bei Bedarf kontrollieren. Meinem Sohn genügte das Wissen allein, dass ich könnte, wenn es denn sein müsste. Bestimmt schreit der eine oder andere Pädagoge genau hier auf. Dennoch bin ich, in Abwandlung der drei klassischen Steigerungsstufen, die wir aus der Sprache kennen, überzeugt: Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Kommunikation ist am besten.
Das bedeutet: Will ich mein Kind so weit bringen, Werte und Normen zu respektieren, die mir wichtig sind, muss ich sie ihm auch entsprechend mitteilen. Kommunikation eben. Dass ich als Erziehungsberechtigter neben der moralischen auch noch eine juristische Verantwortung (Haftung mit Privatvermögen et cetera) habe, versteht sich wohl von selbst.
Wichtig auch: Ab 14 Jahren sind Jugendliche bekanntlich strafmündig. Für Mateo hat das bedeutet: Du darfst ab diesem Zeitpunkt eigenständig den PIN deines Handys ändern. Damit übertrage ich dir die alleinige Verantwortung für dein Handeln.
2. Ab 19 Uhr liegt das Handy in der Küche auf dem Handyparkplatz. Mit der logischen Konsequenz: Nachts darf das Telefon nicht im Schlafraum sein (aus Prinzip, ganz abgesehen davon, dass etwaige Klingeltöne den wichtigen Schlaf meines Kindes stören würden).
3. Bei Missbrauch des Handys als Tatwerkzeug ist es auf längere Zeit weg. Tatwerkzeug bedeutet zum Beispiel: Teilnahme an Cybermobbing und Ähnlichem.

DAS SMARTPHONE IN DER SCHULE
Wird es angesichts der ewigen Streitsucht in der heimischen Politik jemals so etwas wie Einigkeit geben? Und zwar dann, wenn es um unsere Kinder geht? Zum Beispiel um bundesweite Regelungen in Sachen Smartphone und Schule?
Die Antwort steht in den Sternen. Sehr irdisch hingegen sind die Probleme, die das Thema Handy und Unterricht Tag für Tag aufwerfen. Was gar nicht geht, ist das: wegschweigen.
Teil meines Arbeitsalltages ist es auch, von Schulen kontaktiert zu werden. Dies geschieht besonders häufig dann, wenn es zu Missbrauch mit Mobiltelefonen gekommen und guter Rat teuer ist. Nicht, dass ich mich dazu aufschwingen möchte, generell darüber zu urteilen, wie gut oder schlecht Mobiltelefone sind. Das ist weder meine Berufung noch meine Aufgabe. Worin ich allerdings, als Polizist und auch Vater, sehr wohl meine Aufgabe sehe, ist, der Problematik ein Gesicht zu geben. Und bestmöglich zu informieren.
Vor ziemlich genau 20 Jahren wurde das Problem von Mobiltelefonen in Schulen virulent. So kam es auch in meinem Heimatbundesland Oberösterreich zu einem sogenannten Handyerlass2. Heute weht ein gänzlich anderer Wind. Weil die Schulen selbst längst mit einer Vielzahl elektronischer Geräte im Unterricht arbeiten. Ein generelles Handyverbot kann also nicht die Lösung sein. Außerdem widerspräche es geltendem Recht. Werfen wir dazu einen Blick in den Paragraphendschungel.

Handyverbot – Was sagt das Gesetz?
Gemäß § 4 Abs. 4 der Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 24. Juni 1974 betreffend die Schulordnung, BGBl. Nr. 373/1974 idgF., dürfen Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den Schulbetrieb stören, von Schülerinnen und Schülern nicht mitgebracht werden. Derartige Gegenstände sind dem Lehrer auf Verlangen zu übergeben. Abgenommene Gegenstände sind nach Beendigung des Unterrichtes beziehungsweise der Schulveranstaltung oder der schulbezogenen Veranstaltung dem Schüler zurückzugeben, sofern es sich nicht um sicherheitsgefährdende Gegenstände handelt. Sicherheitsgefährdende Gegenstände dürfen nur dem Erziehungsberechtigten – sofern der Schüler eigenberechtigt ist, diesem – ausgefolgt werden, wenn deren Besitz nicht sonstigen Rechtsvorschriften widerspricht.
Was bedeutet das im Klartext? Für die Praxis? Wie sieht es aus mit Hausordnungen in Schulen?

Hausordnung – Was sagt das Gesetz?
Gemäß § 44 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ordnung von Unterricht und Erziehung in den im Schulorganisationsgesetz geregelten Schulen (Schulunterrichtsgesetz – SchUG), BGBl. Nr. 472/1986 idgF., kann der Schulgemeinschaftsausschuss, soweit es besondere Verhältnisse erfordern, eine Hausordnung erlassen. In der Hausordnung können je nach Aufgabe der Schule (Schulart, Schulform), dem Alter der Schülerinnen und Schüler sowie nach den sonstigen Voraussetzungen am Standort (Zusammensetzung der Klasse, schulautonome Profilbildung, Beteiligung an Projekten beziehugsweise Schulpartnerschaften, regionale Gegebenheiten) schuleigene Verhaltensvereinbarungen für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Erziehungsberechtigte als Schulgemeinschaft und Maßnahmen zur Förderung der Schulqualität festgelegt werden, wobei das Einvernehmen aller Schulpartner anzustreben ist.
Die Kernaussagen sind rasch zusammengefasst:


Nutzung einschränken? Wenn ja, wie weit?
Die neun Landesschulräte in Österreich, aber auch die 16 Bundesländer in Deutschland, sind sich da weitgehend einig: kein generelles Handyverbot, jedoch mit regional sehr unterschiedlichen Auslegungen im Detail.
Dass die Geräte im Unterricht ausgeschaltet sein müssen, ist gängige Praxis. Wo sie verwahrt werden müssen (zum Beispiel im Spind), ist Ermessenssache der Schulen. Auch gibt es die unterschiedlichsten handyfreien Zonen. Sie erfüllen unterschiedliche Zwecke. Zum einen als Schutzmaßnahme für die Jugendlichen, um allfälliges Suchtverhalten einzudämmen. Oder auch, um die gute, alte, persönliche Kommunikation zu fördern. Ob, wo und in welchem Ausmaß solche Regeln eingeführt werden, bleibt den Schulen selbst überlassen.
Allgemein gilt: Ein generelles Handyverbot ist rein rechtlich nicht machbar, eingeschränkte Nutzung jedoch sehr wohl. Wie pädagogisch sinnvoller, angemessener und im Schulbetrieb verträglicher Umgang mit Handy und Co. zu handhaben sind, liegt letzten Endes in den Händen von Direktion und Lehrpersonal. Wichtig ist dabei immer, das Bewusstsein der Jugend zu schärfen. Vor allem auch, wenn es um so heikle Bereiche wie Datenschutz, Mobbing und Gesundheit geht.
Gar nicht sinnvoll – auch darin herrscht weitestgehend Einigkeit – wäre ein generelles Handyverbot etwa bei schuleigenen oder schulbezogenen Veranstaltungen (von der Wintersportwoche bis zur Teilnahme an Wettbewerben). Beim Einsammeln der Geräte (zum Beispiel nachts) sieht es anders aus. Wichtig dabei immer auch: Notfalls, bei Beschädigung durch Lehrkräfte zum Beispiel, kann es Schadenersatzansprüche geben, die über die Finanzprokuratur abzuwickeln sind. Auch der Umgang mit derartigen Situationen sollte schulintern und im Vorfeld von Veranstaltungen geregelt sein.
Störsender gegen Prüfungs-Schummler?
Und bei der Matura? Bei Diplomprüfungen? Anderen Klausuren? Dürfen Schulen zu High-Tech-Abwehrmaßnahmen greifen und Störsender installieren, die den Einsatz von Schummel-Software gar nicht erst ermöglichen?

Störsender – Was sagt das Gesetz?
Für Reife- und Diplomprüfungen an Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS), Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen (BMHS) etc. gilt: Laut den neu erlassenen Prüfungsordnungen obliegt es der Schulleitung, notwendige Vorkehrungen zur ordnungsgemäßen Durchführung der Klausurarbeiten zu treffen, sprich: diverse Maßnahmen gegen den Einsatz unerlaubter Hilfsmittel (Kontrolle der Wörterbücher & Formelsammlungen etc.).
Aber: Der Einsatz von Störsendern, um den unerlaubten Einsatz von Handy und Co. zu vereiteln, ist strikt untersagt. Das hat weder mit Landes- oder Bundesschulgesetzen zu tun. Hier kommt ein anderes Regelwerk zum Greifen:
Das Telekommunikationsgesetz.
Wer es genau wissen will – hier die Quellen:
Darüber hinaus bleibt § 1 Abs. 4 der Leistungsbeurteilungsverordnung, BGBI. 371/1974 idgF., betreffend dem Verbot der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel bei der Leistungsfeststellung im Rahmen des Unterrichts unberührt. Und: Der Erlass »Benützungsverbot von Handys im Unterricht« A3-105/198 vom 12.10.1998, sowie der Erlass »Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den Unterricht stören (zum Beispiel Handys)« A3-33/2-1998 vom 30.01.1998 treten hiermit außer Kraft.

Aus der Praxis
Begeben wir uns nach Wien. In eine jener Schulen, die sich ein Zertifikat als sogenannte Medienfreundliche Schule (IKT/ECDL)3 erarbeitet hat.
Was zieht dieses Zertifikat nach sich?
Es bedeutet unter anderem, dass es im Unterricht keine klare Regelung darüber gibt, wie mit Smartphones umgegangen wird. Was in der betreffenden Schule logischerweise zur Folge hatte, dass in den Klassen alle ihr Handy zwar auf Lautlos gestellt, aber stets bei sich hatten.
Was geschah?
Immer wieder wurden heimlich Fotos und Videos von Lehrkräften gemacht, bearbeitet, geteilt und ins Netz gestellt. Heftigste Cybermobbing-Attacken gegen die Lehrkräfte folgten.
Als ich davon erfuhr, war ich sehr erstaunt. Es gab tatsächlich Schulen ohne Handy-Regelungen. Wie blauäugig kann man sein, davon auszugehen, dass die Jugendlichen durchwegs die Reife besitzen, kein Schindluder mit dem Smartphone zu treiben? Dass sie genau wissen, was sie dürfen und was nicht, und sich auch daran halten?
Wie bedenklich, ja, gefährlich Handys in der Schule sein können, zeigen folgende zwei Beispiele, mit denen ich persönlich konfrontiert wurde – alle beide aus Schulen mit eher schwammigen Regelungen in punkto Mobiltelefon:
Beispiel Nummer 1: Eine alltägliche Szene in einer Neuen Mittelschule in Oberösterreich: Zwei Buben geraten in der Pause in Streit. Heftige Wortwechsel. Rempeleien. Dann beginnt der Unterricht wieder. Der eine zückt das Handy, wartet auf den passenden Moment. Als sein Kontrahent von vorhin in der Nase bohrt, drückt er den Auslöser. Das Foto steht Sekunden später in der WhatsApp-Gruppe. Selbst wenn er wollte, kann er nun den Lauf der Dinge nicht mehr beeinflussen. Der Nasenbohrer wurde massiv gemobbt. Ein geradezu klassisches Beispiel dafür, wie Handys zu Tatwerkzeugen werden.