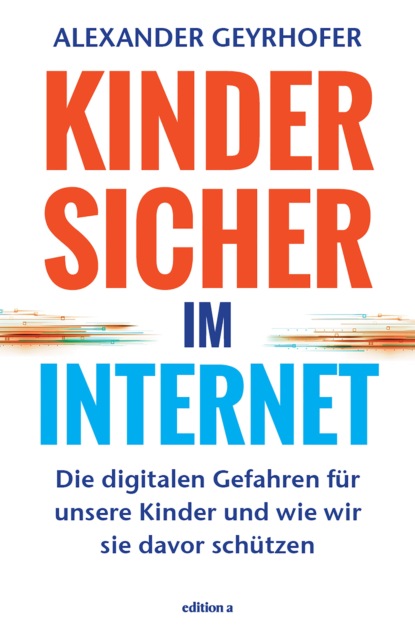- -
- 100%
- +
Beispiel Nummer 2: Ein Gymnasium in Tirol. Auch hier eine Alltagsszene: Der elfjährige Kevin geht auf die Toilette. Große Notdurft. Kevin ist nicht überaus beliebt im Klassenverband, eher der Außenseitertyp. Zwei Mitschüler schleichen unbemerkt in die Nebenkabine, filmen über die Klowand hinweg. Auch sie teilen ihre Trophäe augenblicklich über WhatsApp. Auch hier ist Geschehenes nicht mehr rückgängig zu machen. Auch Kevin wurde aufs Übelste gemobbt. Allerdings hatte er noch Glück im Unglück, denn aufgrund sofortiger Intervention durch alarmierte Erwachsene konnte verhindert werden, dass der Film die WhatsApp-Gruppe verließ und in der ganzen Schule reihum ging.
Natürlich ist die Frage berechtigt: Hätte ein Handyverbot oder eine anderweitige, jedenfalls klare Regelung diese beiden Mobbingattacken verhindert? Nicht zwingend. Doch das Risiko wäre bestimmt minimiert gewesen – allein schon, weil klare Regeln in den Köpfen der Kinder präsent sind, sie bei Verstoß jederzeit mit Konsequenzen (Handyentzug et cetera) rechnen müssen und das auch ganz genau wissen.

Im Allgemeinen gilt dabei: Aufnahmen an öffentlichen Plätzen sind üblicherweise unbedenklich und können auch nicht ohne weiteres untersagt werden. Aber: Sobald der Abgebildete nachteilig abgebildet ist (zum Beispiel Oben-ohne-Fotos am Strand), ist das Foto in jedem Fall schützenswert, darf also keinesfalls veröffentlicht werden.
Das Recht aufs eigene Bild betrifft immer nur die ungewollte Veröffentlichung eines Fotos, nicht das Fotografieren an sich.4
Im privaten Bereich setzt der Schutz des eigenen Bildes sehr viel früher ein. Das gilt zum Beispiel auch für private Veranstaltungen (Partys bei Freunden et cetera). Öffentlich gemachte Fotos dürfen die Abgebildeten auf keinen Fall wie auch immer bloßstellen oder herabsetzen. Ein persönliches Empfinden von Bloßstellung – nur weil der Fotograf nicht die eigene Schokoladenseite getroffen hat, weil man sich hässlich findet – reicht hingegen nicht aus. Die Bloßstellung muss möglichst objektiv nachvollziehbar sein (runtergelassene Hose im Vollrausch et cetera). Außerdem muss der Betreffende klar erkennbar sein. Ein Bild vom Hinterkopf wird also kaum ausreichen, um dagegen vorzugehen.

School-Shooting: Handy als Todesfalle
Besonders dramatische Folgen, ohne gleich den Teufel an die Wand malen zu wollen, haben Smartphones in Schulen bereits nach sich gezogen, wenn es (vor allem aus den USA bekannt) zu sogenannten School-Shootings kam. Sie werden fälschlicherweise immer wieder als Amokläufe bezeichnet, haben jedoch mit Amok nichts zu tun. Das Wort steht nämlich für einen »plötzlichen und blindwütigen Angriff«. Was bei dem typischerweise sorgsam geplanten Amoklauf nicht der Fall ist.
Warum sind Handys in solchen Extremsituationen eine Gefahr? Dienen sie nicht im Gegenteil der Sicherheit?
Die Erfahrung hat gezeigt: In derartigen Krisensituationen herrscht nach einer ersten Angriffswelle des Täters gespenstische Stille im Schulgebäude. Schüler und Lehrer suchen nach Verstecken, verbarrikadieren sich, verhalten sich mucksmäuschenstill, um nicht gefunden zu werden. Auch leise Geräusche, wie etwa das Vibrieren eines auf Lautlos gestellten Handys, haben dazu geführt, dass Menschen gefunden und erschossen worden sind. Also gilt für solche Fälle die klare Empfehlung: Alle Handys ausschalten und nicht bloß auf Lautlos stellen.
WENN DAS HANDY ZUR SPIELKONSOLE WIRD
Gewaltverherrlichende Spiele gibt es auch fürs Handy zuhauf und gratis. Das kann für alle Beteiligten empfindliche Folgen haben. Wie Jung und Alt gemeinsam zu einem sinnvollen Umgang mit dem Handy finden – eine Schule zeigt es vor.
Man möchte meinen, alle wüssten das längst – doch die Praxis zeigt mir immer wieder: Das Gegenteil ist der Fall. Immer noch ist vielen Eltern nicht bewusst, wie bedenklich manche Spiele sind, die es als freie Downloads für Mobiltelefone gibt. Eines davon ist dieses:
Whack your teacher 18+. Schlag deinen Lehrer also. Geben Sie den Titel einfach auf Google ein. Und schon sind Sie dabei. Box10.com heißt der Hersteller, der das etwas andere Spiel anbietet. Kostenlos, versteht sich. Einziges Ziel: die Lehrer ermorden. Eine durch und durch gewalttätige Sache also, die im Mantel eines Zeichentrickspiels daherkommt.

Gewaltspiele – Was sagt das Gesetz?
Ob als Elternteil, Erzieher oder Lehrer – hier gelten natürlich die Jugendschutzgesetze der jeweiligen Bundesländer, worin es übereinstimmend heißt:
Die Aufsichtspersonen haben dafür zu sorgen, dass die ihrer Aufsicht unterstehenden Jugendlichen die Jugendschutzbestimmungen einhalten. Die Erziehungsberechtigten haben bei der Übertragung der Aufsicht sorgfältig und verantwortungsbewusst vorzugehen.
Erwachsene dürfen Jugendlichen die Übertretung der Jugendschutzbestimmungen nicht ermöglichen oder erleichtern. Sie haben sich so zu verhalten, dass Jugendliche in ihrer körperlichen, geistigen, sittlichen, seelischen und sozialen Entwicklung nicht geschädigt werden. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass den in ihrem Einflussbereich befindlichen Jugendlichen keine jugendgefährdenden Informationen, Unterhaltungen, Darbietungen oder Darstellungen, insbesondere über elektronische Medien zugänglich werden.
Doch worum handelt es sich im Konkreten bei Medien oder Datenträgern, Gegenständen oder Dienstleistungen, die unserer Jugend gefährlich werden können? Dazu weiter im Gesetzestext:
1. Inhalte von Medien im Sinn des § 1 Abs. 1 Z1 des Mediengesetzes und Datenträgern sowie Gegenstände und Dienstleistungen, die Jugendliche in ihrer Entwicklung gefährden könne, dürfen diesen nicht angeboten, vorgeführt, an dies weitergegeben oder sonst zugänglich gemacht werden. Eine Gefährdung ist insbesondere anzunehmen, wenn sie:
2. kriminelle Handlungen von menschenverachtender Brutalität oder Gewaltdarstellungen verherrlichen oder
3. Menschen aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Orientierung oder des Geschlechts diskriminieren oder
4. pornographische Darstellungen beinhalten.
Ein glasklarer Fall, was Whack your teacher 18+ angeht. Menschenverachtender und Gewalt blind verherrlichender kann ein Spiel kaum sein. Glasklar sagt der Gesetzgeber auch, was im Falle des Falles – also bei Missachtung – zu tun beziehungsweise mit welchen Konsequenzen zu rechnen ist. Es handelt sich dabei um Verwaltungsübertretungen mit Folgen nicht bloß für Erwachsene, die sie zulassen, sondern auch für strafmündige Jugendliche (ab 14 Jahren also)5:
Strafbestimmungen für Erwachsene: Geldstrafen bis zu 7.000 Euro. Bei Uneinbringlichkeit Ersatzfreiheitsstrafen bis zu sechs Wochen Gefängnis.
Strafbestimmungen für Jugendliche: Sozialstunden oder auch Geldstrafen bis zu 300 Euro.
Natürlich macht man sich in den Schulen genau darüber bereits seit Jahren Gedanken. Viele der Lösungsansätze, auf die ich bisher gestoßen bin, machen durchaus Sinn. Keinen Sinn würde mit Sicherheit ein generelles Handyverbot an Schulen machen – ganz abgesehen davon, dass dies gesetzlich gar nicht halten würde (wir haben davon gehört).
Was bleibt also als probates Mittel?
Die Schulordnung. Wichtig ist hierbei: Jeder Schüler, jeder Elternteil muss darüber Bescheid wissen. Und auch: Ihre Einhaltung muss vom gesamten Lehrkörper ausnahmslos eingefordert werden. Andernfalls trägt so eine Regelung keine Früchte. Ein leuchtendes Beispiel dafür, wie es funktionieren kann, durfte ich im Innviertel kennenlernen:

Aus der Praxis
Dort wurde im Werkunterricht ein Handysafe gebaut. Ein Kasten, der im Prinzip aussieht wie das mehrreihige Schlüsselbrett eines Hotelportiers. Mit durchnummerierten Stellplätzen pro Handy. Installiert wurde der Handysafe im Klassenzimmer. Gleich neben der Tür.
Dazu schriftlich festgehalten und von jedem Schüler unterschrieben eine Vereinbarung, die das Verhalten rund um das Smartphone regelt. Die besagt mitunter: Vor Unterrichtsbeginn steckt jeder sein zuvor ausgeschaltetes Gerät in den Safe. Alle im Raum, ob Lehrer, ob Schüler, können mit einem Blick überprüfen, ob Anzahl der Handys und Anzahl der Anwesenden übereinstimmen. Der Unterricht kann beginnen. Wird das Smartphone dafür benötigt, ist es auf Aufforderung rasch zur Hand. Zum Beispiel bei Teamarbeiten, um im Internet zu recherchieren.
Natürlich könnten Sie als findige Leser nun anmerken: Was ist, wenn jemand bloß einen Dummy in den Handysafe steckt? Oder ein Altgerät, das eigentlich längst in der Ö3-Wundertüte hätte landen sollen?
Solche Fälle gab es laut Schulleitung auch. Allerdings vereinzelt. Und nur zu Beginn der Aktion. Wie auch, dass ein Handy nicht ausgeschaltet war und plötzlich zu klingeln begann. Für diese Eventualitäten gab es ebenfalls eine Vereinbarung im Rahmen dieses mit »Die handyfreundliche Schule« übertitelten Vertrages:
»Bei Verstoß gegen den Schüler-Lehrer-Vertrag (Dummy oder Läuten) muss der/die Betreffende am Folgetag Kuchen für alle mitbringen.«
Anfangs, wurde mir versichert, war der Kuchenverzehr noch einigermaßen rege, doch schon bald pendelte sich das Maß auf zweimal im Jahr ein. Gerade so oft, dass die Leckerbissen für alle eine willkommene, süße Abwechslung waren.
Übrigens: Rein rechtlich ist diese Vereinbarung ebenfalls auf der sicheren Seite. Sie erfolgte von allen Seiten freiwillig und im Rahmen der Hausordnung.
DAS PHÄNOMEN SEXTING
Ein Nacktbild für den liebsten Menschen auf der Welt – was ist schon dabei? Er oder sie kennt mich ohnedies nackt? Wenn die Liebe zerbricht, folgt oftmals das bitterböse Erwachen. Weil wir viel zu sorglos mit Bildern unserer selbst umgehen.
Haben Sie diesen Begriff zuvor schon einmal gehört?
Natürlich, das Wort legt gleich einmal nahe, womit es zu tun hat. Per Definition handelt es sich bei Sexting nämlich darum:
Private Kommunikation über sexuelle Themen per Mobile-Messaging.
Das klingt noch einigermaßen harmlos. Es könnten ja die rein privaten Angelegenheiten zweier erwachsener, eng vertrauter Menschen sein.
Im engeren Sinne heißt Sexting »Dirtytalk« zur gegenseitigen Erregung.
Das trifft es immer noch lange nicht, denn die Wahrheit ist: Sexting ist ein Phänomen, dessen Folgen sehr viel weitreichender sind, als die meisten annehmen würden.
Saferinternet Österreich, eine von der EU geförderte Initiative für den sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien, hat dazu eine Studie gemacht. Fünfhundert Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren wurden mit diesen Fragen konfrontiert:
»Kennst du jemanden, der Nacktaufnahmen von sich an andere verschickt hat?«
Jeder Zweite (51 Prozent) sagte: Ja.
»Hast du selbst schon Nacktaufnahmen geschickt bekommen?«
Jeder Dritte (31 Prozent) sagte: Ja.
»Hast du selbst schon Nacktaufnahmen von dir gemacht?«
Jeder Sechste (16 Prozent) sagte: Ja.
Bei den Burschen war überhaupt fast jeder Vierte (23 Prozent) der Meinung, dass Nacktfotos zum Flirten dazugehörten. Die Mädchen übten sich da in viel größerer Zurückhaltung – nur drei Prozent sahen das so. Innerhalb einer Beziehung jedoch – wenn man sich vertraut – waren bei den Mädchen ein Drittel (34 Prozent) und bei den Burschen fast die Hälfte (43 Prozent) der Meinung, dass das schon in Ordnung wäre.

Aus der Praxis
Anna ist 15 Jahre alt und sehr verliebt. Ihr Freund Konstantin ist zwei Jahre älter. Sie sind seit ein paar Monaten fix zusammen, wie es so schön heißt. Sie lieben einander über alles.
Als Konstantin für einige Zeit beruflich – er ist Lehrling – ins Ausland muss, reißt die Kommunikation natürlich nicht ab. Über WhatsApp wird heiß geflirtet. Und nicht nur das. Es kommt zwischen den beiden zum Dirtytalk.
Anna lässt sich nach anfänglichem Zögern von Konstantin überreden, Nacktbilder von sich an ihn zu schicken. In sehr verfänglicher Pose. Sie zeigt sich mit gespreizten Beinen. Sowohl Geschlechtsbereich als auch Brüste des Mädchens sind klar zu erkennen. Auch Annas Gesicht ist gut zu sehen.
Monate später kommt es, wie es eben bei so jungen Liebenden meist kommt: Die Beziehung geht in die Brüche. Anna lernt sehr rasch einen anderen Burschen kennen und verliebt sich nun Hals über Kopf in ihn. Konstantin kommt damit so gar nicht klar. Was tut er? Grenzenlos enttäuscht, aber auch wütend vor Eifersucht, eröffnet er auf Facebook ein Fake-Profil. Mit dem richtigen Namen seiner Ex-Freundin Anna. Doch damit nicht genug. Als Profil-Bild stellt er Annas Nacktfoto ins Netz. In kürzester Zeit trudeln jede Menge Likes ein. Dazu natürlich entsprechende Kommentare. Bis Anna davon Wind bekommt, vergehen einige Tage.

Sexting – Was sagt das Gesetz?
In vielen Ländern ist die Gesetzeslage eindeutig: In Österreich beispielsweise handelt es sich hierbei um den Straftatbestand der pornografischen Darstellung Minderjähriger nach § 2071 StGB (Strafgesetzbuch), im landläufigen Sprachgebrauch also darum: Kinderpornografie.
In diesem Fall war es verhältnismäßig einfach, den Täter dafür zur Verantwortung zu ziehen und auch dafür zu sorgen, dass das Fake-Profil aus dem Netz genommen wurde. Völlig unklar blieb jedoch, wie viele User sich das Bild in der Zwischenzeit womöglich heruntergeladen hatten (womit sie sie ebenfalls strafbar gemacht hätten) und wofür sie dieses Bild dann verwendeten.
Aber was tun, wenn man nicht weiß, wer der Täter ist?

Aus der Praxis
Mit diesem Fall wurde ich selbst konfrontiert. Ein erst 14 Jahre altes Mädchen aus der Steiermark war das Opfer. Bis über beide Ohren in einen Schulkollegen verknallt und blind vor jugendlicher Verliebtheit, ließ sie sich von ihm überreden, Gegenstände in ihre Vagina einzuführen – und sich dabei auch noch zu filmen. Dann schickte sie dem Angebeteten das Video. Mit fatalen Folgen.
Der Schulkollege sandte das Video via WhatsApp seinem besten Freund. Der wiederum an eine Klassenkollegin der 14-Jährigen. Blitzartig war das Video im gesamten Klassenverband bekannt, letzten Endes sogar in der gesamten Schule. Der einzige, jedoch schwache Trost für das am Boden zerstörte Mädchen: Es war auf dem Video nicht erkennbar. Doch die Gerüchte, um wen es sich handelte, hielten sich natürlich hartnäckig.
Die verzweifelte Mutter der Schülerin rief mich an. »Was soll ich tun?«
»Anzeigen. Und zwar sofort.«
So geschah es dann auch. Zusätzlich startete die Direktion eine Aufklärungskampagne für alle Schülerinnen und Schüler. Immerhin handelte es sich vor dem Gesetz genau darum: Kinderpornografie.

Wie sensibilisiere ich mein Kind?
Klar, schon das Anfertigen von Nacktbildern ist höchst problematisch, und das Verschicken übers Netz ein No-Go. Dennoch reizt es Jugendliche, genau solche Bilder zu machen, immer wieder enorm.
Was tun? Wie vorbeugen?
Aus meiner Erfahrung weiß ich:
Es macht immer Sinn, Jugendliche mit Sexting zu konfrontieren.
Sei es in Gesprächen, sei es auch in konkreten Übungen. Wenn sie schon glauben, unbedingt Nacktfotos von sich machen zu müssen, so sollten sie unbedingt genau darüber Bescheid wissen, wie diese Bilder bearbeitet werden können. Und zwar so, dass sie keinesfalls zu erkennen sind.
Generell gilt natürlich: Nacktaufnahmen sollten sofort wieder gelöscht werden, nachdem sie zum Beispiel dem Freund, der Freundin gezeigt wurden. Prinzipiell fallen so gut wie alle Nacktbilder Minderjähriger unter den sogenannten Kinderpornografie-Paragrafen 207 a StGB6. Ausnahmen gibt es da nur ganz wenige. Und:
Niemals Nacktbilder von sich verschicken! Egal, wie groß die Liebe sein mag!
Snapchat – inzwischen auch vielen Erwachsenen bekannt – ist bei Jugendlichen eine besonders beliebte Applikation, um Nacktbilder zu versenden. Das System bei Snapchat gibt bekanntlich vor, dass Aufnahmen vom Empfänger nur für einige Sekunden (in der Regel zehn) angesehen werden können (+ 1 sofortige Wiederholung).
Doch was, wenn der Empfänger einen Screenshot davon macht?
Zwar bekommt der Absender darüber eine Information, doch das ändert nichts daran, dass das Bild unterwegs und anderswo gespeichert ist. Ob dieses Bild nun vom Empfänger wieder gelöscht wird oder nicht, ist außerhalb des eigenen Einflussbereichs. Außerdem müssen die Jugendlichen sich darüber im Klaren werden, dass Snapchat-Bilder (auch ohne Screenshot) niemals gänzlich verschwunden, sondern bloß fürs Auge der 0815-User versteckt sind. Findige Hacker hingegen können sich durchaus Zugriff verschaffen7.





Die Präsentation der eigenen Person im Netz ist etwas, worüber wir gar nicht oft genug mit den Jugendlichen sprechen können. Immerhin – das ist ja mittlerweile nichts Neues – machen enorm viele Firmen sogenannte Backgroundchecks über künftige Mitarbeiter. In Österreich sind es 80 Prozent aller Betriebe, und in anderen Ländern ist dieser Wert ähnlich hoch.
Denn natürlich wollen Chefs von Bewerbern vorab wissen: »Wie präsentiert er sich in den Sozialen Medien? Was für ein Bild gibt er ab? Immerhin sollen sie später auch den Betrieb repräsentieren.« Längst gibt es mittlerweile auch eigene Websites8, die für Firmen genau das anbieten:
Auf Mausklick alle im Netz verfügbaren Informationen über x-beliebige Personen.
Das folgende Beispiel ist zwar nicht unmittelbar in Verbindung mit Sexting zu sehen, doch es zeigt aus meinem eigenen, privaten Umfeld auf, wie sorglos viele (vor allem auch junge) Menschen mit ihrem Auftritt im Internet umgehen:

Aus der Praxis
Es geht hierbei um den Sohn einer guten Freundin unserer Familie. Er schickte mir über Facebook eine Freundschaftsanfrage. Natürlich bestätigte ich. Danach musterte ich sein Profilbild.
Was bekam ich zu sehen?
Eine wunderschöne, saftig grüne Wiese. Fast schon idyllisch. Wäre da nicht … ja, wäre da nicht diese eine volle Bierflasche gewesen, die mitten im Gras stand. Und daneben lagen drei leere Flaschen.
Ich rief den jungen Mann augenblicklich an.
»Klausi«, sagte ich. »Nur eine kurze Frage an dich. Bist du nicht gerade auf Jobsuche? Also…hättest du dich bei mir beworben, ich würde dich nicht mal zum Vorstellungsgespräch einladen.«