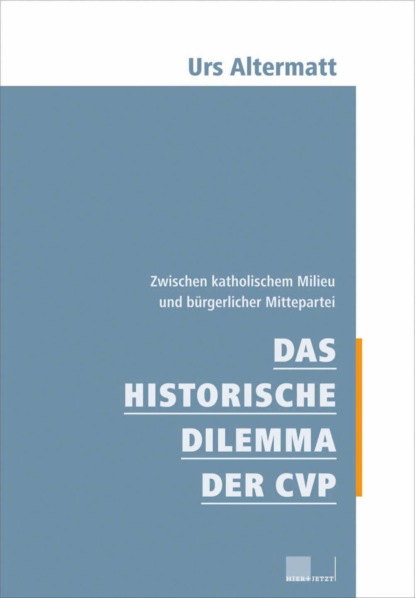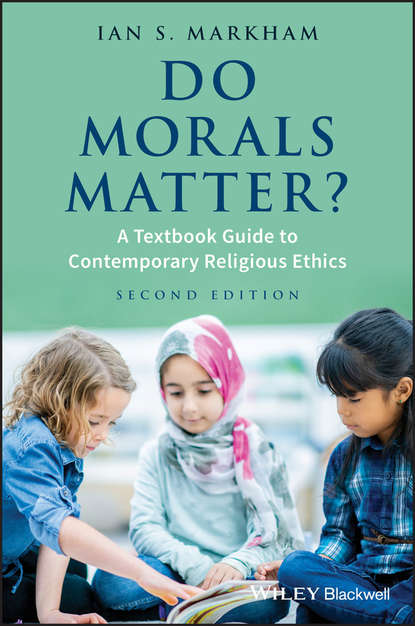- -
- 100%
- +
Allerdings blieb die 1971 feierlich proklamierte Formel von der «dynamischen Mitte» im Alltag der konkreten Politik eine Formel ohne deutliches Profil, da sich die Partei in der Regierung nach rechts und nach links an ihre Koalitionspartner anpasste. Unter dem Druck der Rezession verflüchtigten sich die Konturen der «dynamischen Mitte» als eigenständiger «dritter Weg». Von der Scharnierstellung blieb in den Zeiten der Polarisierung oft wenig übrig, vielfach nur die Dynamik auseinander strebender Parteiflügel. Kritische Beobachter warfen der Partei schon kurz nach den Reformen von 1970/71 vor, sie trage ihr Herz auf der linken Seite, mache aber die Politik mit der rechten Hand – nach dem Motto: links fühlen, rechts handeln und in der Mitte regieren.
So paradox es tönt: Mit dem politischen Erfolg in der Regierung setzte als Folge des unscharfen Profils eine schleichende Erosion bei den Wählern ein, die die Stellung der CVP als Mehrheiten bildende Regierungspartei aushöhlte. Die eigentliche Zäsur brachte dann der Verlust einer der beiden bisherigen Bundesratssitze, da nun ihre Rolle in der Landesregierung an machtpolitischem Gewicht verlor. 2003 stieg die CVP nach 84 Jahren von der ersten in die zweite Liga der Regierungsparteien ab. Wie der verlorene Bundesratswahlkampf gegen die FDP 2009 (Urs Schwaller gegen Didier Burkhalter) zeigt, handelte es sich dabei nicht nur um einen vorübergehenden Unfall. Der Wiederaufstieg ist beschwerlich.6
1.3 AUFSTIEG, BLÜTEZEIT UND EROSION
Die CVP-Fraktion der Bundesversammlung ist zusammen mit der belgischen Schwesterpartei die älteste christlichdemokratische Parlamentsgruppe Europas mit ungebrochener Tradition.1 Wie ich bereits im vorausgegangenen Kapitel erläutert habe, reichen ihre Ursprünge in die Anfangsjahre des Bundesstaats von 1848 zurück und sind im Kontext der Kulturkämpfe der Zeitepoche von 1830 bis 1880 zu sehen.2
Kurze Parteigeschichte
Die Konflikte um die politische und kulturelle Hegemonie im Bundesstaat liessen nach 1848 auf der einen Seite die Parteifamilie des radikal-liberalen Freisinns und auf der anderen Seite die katholisch- beziehungsweise reformiert-konservativen Parteigruppierungen entstehen.3 Ende des 19. Jahrhunderts löste der Klassenkampf die kulturkämpferischen Konflikte ab, und die Parteien der sozialistischen und kommunistischen Linken entstanden. Damit waren die parteipolitischen Grundstrukturen geschaffen, die die Schweiz bis Ende des 20. Jahrhunderts prägten. Seit den 1990er-Jahren macht die nationale Parteienlandschaft tief greifende Transformationen durch. Auf der rechten Seite des Spektrums etablierte sich die national-konservative «Schweizerische Volkspartei» (SVP) als stärkste Partei.4 Mit der damit verbundenen Polarisierung europäisiert sich das schweizerische Parteiensystem in eine Linke, in eine Rechte und in eine Mitte.
In der Bundesversammlung konstituierte sich die christlichdemokratische Fraktion im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts unter der Bezeichnung «katholisch-konservativ», allerdings bestand sie in losen Organisationsformen seit der Gründung des Bundesstaats im Jahr 1848. Von 1848 bis 1872 existierte in den Eidgenössischen Räten eine kleine Gruppe konservativer Parlamentarier, die sich als Gesinnungsgemeinschaft verstand und von Fall zu Fall auch als Aktionsgemeinschaft auftrat. Freilich besass sie noch keine Geschäftsordnung und noch kein formelles Programm. Diskussionen vor wichtigen Parlamentsgeschäften waren dem Zufall überlassen. In den 1850er- und 60er-Jahren beklagten katholisch-konservative Presseorgane den desolaten Zustand der Fraktion.5
Die 1874 eingeführte Erweiterung der direkten Demokratie machte eine straffere nationale Parteiorganisation zur Mobilisierung der Kräfte notwendig. Wegen ausgeprägter föderalistischer Reflexe der Stammlandkantone bereitete jedoch der gesamtschweizerische Zusammenschluss der Kantonalparteien Schwierigkeiten, sodass verschiedene nationale Gründungsversuche – 1874, 1878, 1881 und 1894 – an internen Rivalitäten zwischen den Stammlanden und dem Diasporakatholizismus scheiterten. Erst 1912 kam es zur endgültigen Gründung der Landespartei.6
Viel zu reden gab der Name der Partei, worin die strategischen Unsicherheiten der Eliten über den Zweck und das Wählerpotenzial der zu gründenden Parteiorganisation manifest wurden.7 In Anlehnung an die Traditionen politischer Begriffe im 19. Jahrhundert tauften die Christlichdemokraten ihre Partei am Gründungskongress von 1912 «Konservative Volkspartei», denn sie wollten mit dem Etikett «konservativ» eine politische Katholikenpartei bilden, die gleichgesinnten Protestanten offen stand. 1957 benannten sie die Partei in «Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei» (KCVP) um, um die Bedeutung der Arbeiter- und Angestelltenflügel im Namen zum Ausdruck zu bringen. Als 1970 in den gesellschaftlichen Transformationen der späten 60er-Jahre der Begriff «konservativ» in Misskredit geraten war, strich die KCVP diese Etikette aus dem offiziellen Parteinamen und wählte in Anlehnung an ihre westeuropäischen Schwesterparteien den heutigen Namen «Christlich-demokratische Volkspartei der Schweiz».8
A propos «christlich-demokratisch»: Während diese Namensbezeichnung in Europa vor dem Ersten Weltkrieg höchst umstritten war, tauchte sie in den schweizerischen Namensdebatten schon im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts auf, fand aber keine Mehrheit, da ihr zur damaligen Zeit eine zu progressive Konnotation anhaftete. Sich «Volkspartei» zu nennen, war den Christlichdemokraten wichtiger – anfänglich im 19. Jahrhundert, um ihre demokratische Opposition gegen das radikal-liberale Regierungssystem zu unterstreichen; nach dem Ersten Weltkrieg, um als Juniorpartnerin der freisinnig-bürgerlich geprägten Landesregierung ihre breite soziale Verankerung in der Bevölkerung und ihre Ausgleichsrolle zwischen dem Liberalismus und Sozialismus zu betonen.
Aufstieg und Blütezeit der CVP von 1919 bis 1971
Im eidgenössischen Parlament bildeten die Christlichdemokraten vor dem Ersten Weltkrieg eine Minderheitsgruppierung, denn in der Periode des Majorzwahlsystems dominierte der Freisinn die beiden Kammern, die katholisch-konservative Opposition zählte nicht mehr als ein Viertel der Sitze.
Nach der Einführung des Proporzes brach die bisherige absolute Mehrheit der freisinnigen Parteifamilie 1919 zusammen. Die FDP erhielt 28,8, die Sozialdemokraten 23,5, die CVP 21,0 und die BGB 15,3 Prozent der Wählerstimmen.9 Vom Ende des Ersten bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg blieb der Platz der Christlichdemokraten im Parteiengefüge ausserordentlich stabil. 1919 erhielten sie – wie erwähnt – 21,0, 1928 21,4 und im Kriegsjahr 1943 20,8 Prozent des Wähleranteils. Damit behielt die Partei von 1919 bis 1943 hinter den Sozialdemokraten und dem Freisinn konstant den dritten Rang, vor der viertplatzierten Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei.10
Analog zur westeuropäischen Entwicklung erzielten die Christlichdemokraten in den beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ihre grössten Wahlerfolge. Allerdings vermochte die CVP im stabilen Mehrparteien-System nie die Wahlerfolge ihrer Schwesterparteien in Westdeutschland, Österreich oder Italien zu erreichen, die in den späten 40er- und in den 50er-Jahren zeitweise über Mehrheiten um 50 Prozent verfügten. Auch nach 1945 behielten die Christlichdemokraten ihren traditionellen Wähleranteil von etwas mehr als 20 Prozent. Das beste Wahlresultat erzielten sie 1963 – während des Zweiten Vatikanischen Konzils – mit 23,4 Prozent. Ihre Wahlerfolge hingen in den 50er-Jahren mit der allgemeinen Konsenspolitik zusammen, die eine Partei des Ausgleichs brauchte. Der wirtschaftliche Aufschwung, der den Ausbau des sozialen Wohlfahrtsstaats mit der Alters-, Hinterlassenen-, und Invalidenrente zuliess, beschleunigte den Weg der CVP zur Zentrumspartei.
Mitte der 1960er-Jahre erhielt die ausserordentliche Stabilität, die das Parteiensystem bisher ausgezeichnet hatte, erste Risse, ohne dass diese vorerst zu nachhaltigen Umstürzen führten. Die Einbrüche ins Parteiengefüge erfolgten aus drei politischen Richtungen. Zunächst gewann die «nonkonformistische» Opposition des vom Regierungskartell ausgeschlossenen liberal-sozialen Landesrings der Unabhängigen an Stimmen, der in den Nationalratswahlen von 1967 mit 9,1 Prozent seinen Höhepunkt erreichte. In den späten 60er-Jahren bildeten sich als Reaktion auf die zunehmende Fremdenangst im Zusammenhang mit den steigenden Ausländerzahlen (1970: 15,9 Prozent) rechtspopulistische Anti-«Überfremdungs»-Parteien, die 1971 einen Überraschungserfolg erzielten, mit 4,3 Prozent die Republikaner und mit 3,2 Prozent die Nationale Aktion. In der zweiten Hälfte der 80er-Jahre stiessen links-alternative und grüne Kleinparteien dazu, wobei die Grünen den nachhaltigsten Erfolg erzielten.11
Diese Oppositions- und Protestbewegungen von rechts und von links führten zum Schrumpfen der vier Traditionsparteien. Der Rückgang der Christlichdemokraten bewegte sich bis Ende der 80er-Jahre parallel zu den Verlusten der vier Regierungsparteien. Wer der CVP damals einen Niedergang voraussagte, wurde nicht ernst genommen.
Neue Parteienlandschaft seit den neunziger Jahren
Seit den 1990er-Jahren veränderte sich die Parteienlandschaft fundamental.12 Ausgangspunkt war der aussergewöhnliche Aufstieg der SVP, die sich unter der Führung des Zürcher Nationalrats Christoph Blocher zu einer national-konservativen Partei wandelte. Die SVP vermochte ihren jahrzehntelangen Stimmenanteil von rund 11 Prozent von 1991 bis zu den Nationalratswahlen 2007 auf 28,9 Prozent zu steigern. Erst 2011 kam dieser Aufstieg – vorläufig? – zum Stillstand und führte zu leichten Verlusten. Dies machte die SVP innerhalb weniger Jahre zur grössten Partei der Schweiz. Als Folge dieser Entwicklung polarisierte sich die Parteienlandschaft. Es entstand in den Worten des Politologen Claude Longchamp ein «tripolares» Parteigefüge.
In einer gegenläufigen Bewegung zur SVP verloren zwischen 1995 und 2011 vor allem die «bürgerlichen» Traditionsparteien FDP und CVP dramatisch Wähler. Bei den Wahlen 2003 sank die CVP auf das historische Tief von 14,4 Prozent. Ein solches verzeichnete auch die FDP, die auf 17,3 Prozent einbrach. 2007 vermochte sich die CVP bei 14,5 Prozent zu stabilisieren, während die FDP mit 15,8 Prozent erneut verlor. 2011 war es umgekehrt: Die CVP büsste erneut ein und landete bei 12,3 Prozent.
Die Analyse des Bundesamts für Statistik unter der Leitung von Werner Seitz zeigt auf, dass CVP und FDP von 1979 bis 2011 um die 9 Prozent einbüssten.13 Aus den Wahlen von 2011 gingen die Parteien der sogenannten «neuen Mitte» als relative Wahlsieger hervor: Die Grünliberalen (GLP) steigerten sich auf 5,4 Prozent, und die 2008 aus der Abspaltung von der SVP hervorgegangene «Bürgerlich-Demokratische Partei» (BDP) erreichte auf einen Schlag 5,4 Prozent. 2007 und 2011 musste auch die SP ein Wahlresultat unter der 20-Prozent-Marke verzeichnen. In der längeren Perspektive befanden sich die Grünen im Aufwind, die 2007 auf 9,6 Prozente zulegten, dieses Resultat jedoch 2011 mit 8,4 Prozent nicht zu halten vermochten. In den Wahlen von 2011 kam – wie Claude Longchamp und sein Team festhalten – der Polarisierungszyklus, der mit der EWR-Abstimmung 1992 begann, zum Ende.14 Das Drei-Pole-Parteiensystem mit flexiblen Koalitionen blieb bestehen.
Einbrüche
Wie Werner Seitz und Madeleine Schneider in ihrer Wahlanalyse feststellen, veränderte sich die regionale Verankerung der CVP nicht wesentlich.15 Noch immer tragen die Kantone Luzern, St. Gallen und Wallis am meisten zur nationalen Stärke bei. Die stärksten Kantonalparteien stellten 2011 das Wallis (39,9%), der Jura (33,2%) und Luzern (27,1%). Allerdings verloren seit 1979 Luzern, Schwyz und St. Gallen über 20 Prozent der Wähler. In welchen Regionen und Kantonen erfolgten die nachhaltigsten Einbrüche der Christlichdemokraten? Gibt es in der zeitlichen Abfolge besondere Entwicklungen?
Die Stagnation der CVP manifestierte sich – erstens – in den städtischen Ballungszentren ausserhalb der traditionellen Hochburgen. Seit den 1970er- und 80er-Jahren wechselten in den städtischen Agglomerationen der Kantone Zürich, Basel und Bern zahlreiche Sozialaufsteiger katholischer Konfession, die als schweizerische «Secondos» nicht mehr von den moralischen und gesellschaftlichen Bindekräften des katholischen Milieus ihrer familiären Herkunftskantone gehemmt wurden, zum bürgerlichen Freisinn und zur Linken über, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wählbar geworden waren. Als Resultat des veränderten Wahlverhaltens bisheriger Stammwähler in der klassischen Diaspora wurde das bevölkerungsreiche Mittelland von Zürich bis Lausanne für die CVP zum wahlpolitischen Ödland. In den grossen, von ihrer Geschichte her protestantisch geprägten Mittellandkantonen Zürich, Bern und Waadt, wo die Katholikenpartei aus historischen Gründen nie eine starke Position besessen hatte, schrumpfte ihr ohnehin kleiner Anteil zusammen. Von den insgesamt 78 Sitzen dieser drei Kantone im Nationalrat hielt sie 2011 nur noch 3; 1963 waren es von 84 immerhin noch deren 8 gewesen. Selbst in Zürich, wo die Christlichsozialen in einem langsamen, aber stetigen Aufstieg in die Regierung gelangt waren, liefen jüngere Wähler der Partei davon. Für die Generationenthese stellt Zürich das beste Beispiel dar, da die Zwingli-Stadt im Jahr 2009 mit 112 000 Katholiken den grössten Anteil aller Schweizer Städte aufweist.
Eine zweite Beobachtung: In den 1980er-Jahren erfasste der Erosionsprozess auch in unterschiedlichem Ausmass die alten Kulturkampfkantone St. Gallen, Aargau, Thurgau, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Genf. Der neue Kanton Jura blieb eine Ausnahme, da sich dort die Christlichdemokraten als aktive Gründungspartei des Kantons profiliert hatten. Die jurassische CVP erhielt 1979 37,7 Prozent und konnte diesen Stand über die Jahrzehnte hinweg halten (2011: 33,2%). Damit begannen die Christlichdemokraten in jenen Gebieten zu verlieren, in denen sie seit über hundert Jahren als Partei des politischen Katholizismus fest verankert waren. Aus historischer Perspektive wogen die Sitzverluste in diesen Kantonen schwerer als diejenigen in den früheren Diasporakantonen Zürich, Waadt und Bern, denn mehr als anderswo verdeutlichten sie den Zusammenbruch parteipolitischer Loyalitäten.
Als Beispiele verweise ich auf die Kantone St. Gallen, Aargau und Solothurn. In St. Gallen stellte die CVP 1963 6 von 13 Nationalratssitzen, im Aargau 3 von 13 und in Solothurn 2 von 7. 1983 sah das Bild folgendermassen aus: St. Gallen 5 von 12, Aargau 4 von 14 und Solothurn 2 von 7. Der eigentliche Einbruch in diesen Kantonen erfolgte mit unterschiedlichen Zeitrhythmen und lokalen Besonderheiten im letzten Jahrzehnt des 20. und im ersten des 21. Jahrhunderts. 2003 eroberten die Christlichdemokraten im Kanton St. Gallen nur noch 3 von 12, im Aargau 2 von 15 und im Kanton Solothurn 1 von 7 Nationalratssitzen. 2011 sah die Statistik wie folgt aus: St. Gallen 3 von 12, Aargau nur noch 1 von 15 und Solothurn dank geschickten Listenverbindungen 2 von 7 Sitzen. Alles in allem büssten die Christlichdemokraten seit 1963 fast 50 Prozent ihrer Nationalratsmandate in den alten Kulturkampfkantonen der Schweiz ein. Am besten hielten sich mandatsmässig die Christlichdemokraten Solothurns.
Und schliesslich der dritte Punkt: Die katholischen Stammlandkantone Schwyz, Luzern, Zug, Obwalden, Nidwalden, Uri, Freiburg und Wallis waren für die CVP seit dem 19. Jahrhundert als Reaktion auf die bittere Niederlage im Bürgerkrieg von 1847 Hochburgen, ja Bollwerke der Partei. Seit den Nationalratswahlen von 1999 verlor die Partei auch in diesen Kantonen in dramatischer Weise Wählerstimmen. 2011 stellte die CVP nur noch 10 von total 34 Nationalräten in den Stammlandkantonen.
Wie in den Kulturkampfkantonen war primär die national-konservative SVP Nutzniesserin dieser Entwicklung. 1991 hatte die SVP in den Zentralschweizer Kantonen sowie in Freiburg und im Wallis insgesamt lediglich einen Nationalratssitz inne. 1995 waren es zwei und 1999 bereits deren vier. Bei den Nationalratswahlen vom Herbst 2003 steigerte sich die SVP mit insgesamt acht Mitgliedern und 2007 mit neun. Im Jahr 2011 verlor sie zwei Sitze, was auf eine gewisse Instabilität der Wählerbasis hinweist. Dennoch: Die Wählerverluste in den alten Stammlanden alarmierten die Eliten. Am besten hielt sich die CVP des stark urbanisierten Kantons Luzern, in Zug errang sie immerhin einen von drei Sitzen.
Herbe Verluste in der Kleinen Kammer
Im Ständerat konnte die CVP jahrzehntelang von der Tatsache profitieren, dass die kleinen Stammlandkantone ebenfalls zwei Senatoren entsenden wie die Grosskantone Zürich, Bern und Waadt. Deshalb blieb der Ständerat bis heute eine stark christlichdemokratisch gefärbte Kammer.
Doch der Rückgang in ihren Stammlanden zeigte sich auch bei den Ständeratswahlen. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts stellte die Partei in den ehemaligen Sonderbundskantonen alle vierzehn Ständeratsmandate.16 Da zwei der acht Sonderbundskantone Halbkantone sind, die jeweils lediglich einen Ständerat stellen, beläuft sich die Sitzzahl dieser acht Kantone im Ständerat auf insgesamt vierzehn.
Das erste Doppelmandat ging der CVP schon 1955 in Luzern verloren. Seit den 70er-Jahren büsste die CVP in den Urschweizer Kantonen immer wieder Ständeratssitze ein, 2011 sogar beide in Schwyz.
Ähnliche Verluste verzeichnete die Partei in anderen Kantonen. So verlor die CVP 1995 ihren Ständeratssitz im Aargau und 2011 in St. Gallen. Ausserhalb der Sonderbundskantone errang die Partei 2011 nur noch in folgenden Kantonen Ständeratssitze: Appenzell Innerhoden, Graubünden, Jura, Solothurn, Thurgau und Tessin. Seit den 1970er-Jahren ist der Abwärtstrend auch in der Kleinen Kammer eindeutig, auch wenn die CVP derzeit immer noch die stärkste Gruppe stellt.
Verschwinden der katholischen Meinungspresse
Wie lässt sich das Schrumpfen der Wählerbasis der CVP um über einen Drittel im Zeitraum von 1983 bis 2011 erklären? Diese Frage versuche ich mit einigen Thesen zu beantworten, die sich zum Teil an die Wahlstudien des Bundesamts für Statistik (BFS), der Swiss Electoral Studies (Selects-FORS), des GfS-Forschungsinstituts und anderer anlehnen und diese mit Bezug auf die CVP ergänzen.17
Zunächst ist festzuhalten, dass politische Ereignisse die Wahlen beeinflussen, die von der Wahlforschung zuweilen erst im Nachhinein gewürdigt werden. Die berühmte Abstimmung von 1992 über den Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) war eine solche Zäsur, die dem Aufstieg der SVP das entscheidende Momentum gab. Die superpatriotischen Europa-Skeptiker liefen der CVP scharenweise davon. Der populistische Protest der SVP gegen das Berner Politestablishment sprach vielen Unzufriedenen in den alpinen und ländlichen Randgebieten aus der Seele. 1992 war das politische «Marignano» der CVP, die in der Europafrage zwischen Progressiven und Konservativen tief gespalten war. Im Wahlkampf von 1995 ging die bisher einigermassen funktionierende bürgerliche Allianz zwischen FDP, CVP und SVP in die Brüche.18
Ein zweites Argument: Der steigende Wohlstand der Konsum- und Freizeitgesellschaft, der seit den 50er-Jahren unaufhaltsam voranschritt, erhöhte nicht nur die soziale, sondern auch die geistige Mobilität der Schweizerinnen und Schweizer, die unter dem Einfluss von Radio und Fernsehen und von Forumszeitungen ihre Denk- und Lebensweisen einander anpassten. Als Folge lösten sich die traditionellen Parteibindungen auf. Das Prinzip der Konsumgesellschaft hielt auch in der Politik Einzug. Die Parteien wurden zu Warenhäusern, in denen man sich nach Gutdünken bediente. Als Konsequenz wurden die Wähler und Wählerinnen beweglicher, mobiler und stimmungsabhängiger; sie wurden zu Wechselwählern. Wie Mark Ruff auch für Westdeutschland festgestellt hat, entstand nach 1945 so etwas wie eine einheitliche nationale Kultur, in der sich die regionalen, konfessionellen und klassenmässigen Fragmentationen der Vorkriegszeit auflösten.19
In der Schweiz äusserte sich die ideologische Nivellierung in einer fortschreitenden Entkonfessionalisierung des Alltags, was zunächst kaum bemerkt wurde. Eine zentrale Rolle spielten die elektronischen Medien wie Radio und Fernsehen und die Boulevardpresse, die mit dem «Blick» 1959 in der Schweiz Einzug hielt.20 Säkulare Ideen über Demokratie und Religionsfreiheit und über das Verhältnis der Geschlechter stiessen in den Binnenraum des katholischen Kirchenvolkes vor. Die Katholiken übernahmen die Wertvorstellungen ihrer Umwelt, die sich mit den Verlautbarungen der Kirche nicht deckten. Wie in Deutschland versuchten die Katholiken in der Schweiz mit einer Kombination von wirtschaftlichem Modernismus und kulturellem Konservativismus das Überleben ihres Sozialmilieus zu retten, was indessen fehlschlug. Damit verlor der Katholizismus als Weltanschauung seine Homogenität und seine bisherige Abwehrstellung gegen die Moderne. In einem gewissen Sinn bedeutete die kulturelle Anpassung an die dominante Leitkultur eine «Protestantisierung» des schweizerischen Katholizismus.21
Dieser Prozess lässt sich gut an der Entwicklung des katholischen Pressewesens illustrieren, das im 19. Jahrhundert in der ganzen Schweiz aufgebaut worden war und ein breites Netz von lokalen Zeitungen als Unterstützung der katholischen Sondergesellschaft herausgebracht hatte.22 Von dem Konzentrationsprozess in der Schweizer Presse, der Ende der 1960er-Jahre einsetzte, waren neben den sozialdemokratischen die katholisch ausgerichteten Zeitungen besonders stark betroffen, denn sie vermochten ihren steigenden Kapitalbedarf nicht mehr zu decken und litten darunter, dass sie von Grossinserenten zunehmend übergangen wurden. Rund um das Luzerner «Vaterland», das führende Blatt der CVP-nahen Zeitungen in der deutschen Schweiz, entstand im Verlauf der 1970er- und 80er-Jahre ein Kopfblattsystem, das sich auf seinem Höhepunkt vom Wallis bis in die Ostschweiz erstreckte.
Neben diesen strukturellen Veränderungen im Zuge der Pressekonzentration sah sich die katholische Presse in ihrem Selbstverständnis herausgefordert. Carl Mugglin meinte 1973 rückblickend auf seine «Vaterland»-Redaktionstätigkeit in den Jahren 1953–1963: «Damals war alles noch schön eingeteilt: Auf der einen Seite die Kirche, auf der anderen Seite die Partei.»23 Die junge Journalistengeneration stellte dieses Denken in Frage. 1964 wurde das Seminar für Journalismus an der Universität Freiburg gegründet. Die Arbeitsgemeinschaft der katholischen Presse führte bis 1970 jährlich Fortbildungskurse durch.
All diese Kooperationsinitiativen vermochten jedoch laut David Luginbühl nicht zu verhindern, dass die partei- und konfessionsorientierten Tageszeitungen verschwanden, indem sie mit regionalen Rivalen fusionierten wie 1991 das «Vaterland» in Luzern oder eingestellt wurden wie 1997 die «Ostschweiz» in St. Gallen. In der Westschweiz konnte sich die Freiburger «La Liberté» halten, öffnete sich aber politisch zur Forumszeitung.
Das Ende der katholischen Presse bedeutete einen nachhaltigen Einschnitt. Der CVP fehlten fortan Presseorgane, die sich in der Vielfalt der Presse durchzusetzen vermochten und als Meinungsmacher auch zur Stabilisierung des eigenen Lagers dienten.
Endgültiges Ende des Kulturkampfes
Für die CVP war wegweisend, dass in den 1960er- und 70er-Jahren der Kulturkampf des 19. Jahrhunderts endgültig zu Ende ging. 1963 stellte man im Kanton Zürich die katholische der evangelisch-reformierten Landeskirche gleich. 1973 wurden in einer hitzigen nationalen Volksabstimmung die konfessionellen Ausnahmeartikel, die die Jesuiten diskriminiert und die Errichtung von Klöstern erschwert hatten, aus der Bundesverfassung gestrichen.24 1999 wurde das Wahlverbot für Geistliche und 2001 schliesslich der sogenannte Bistumsartikel aufgehoben. Damit fielen die letzten klassischen Postulate des politischen Katholizismus weg, die der Katholikenpartei ein Jahrhundert lang die Raison d’être gegeben hatten.
Fast ein Jahrhundert hatten die kirchentreuen Katholiken für die Abschaffung der gegen die katholische Kirche gerichteten Ausnahmebestimmungen gekämpft. Die heute übliche Sicht der säkularisierten Gesellschaft unterschätzt dieses Postulat als Petitesse und übersieht die jahrzehntelange emotionale Mobilisationswirkung, die diese konfessionellen Diskriminierungen ausgeübt hatten. Die Volksabstimmung von 1973 förderte im Übrigen überraschende Resultate zu Tage, die auf das unterschwellige Fortwirken konfessioneller Ressentiments hindeuteten. So lehnten sechs Kantone die Aufhebung der Ausnahmeartikel ab, nämlich Zürich, Waadt, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Neuenburg und Bern. Gesamtschweizerisch lautete das Resultat 54,9 Prozent Ja- und 45,1 Prozent Nein-Stimmen.