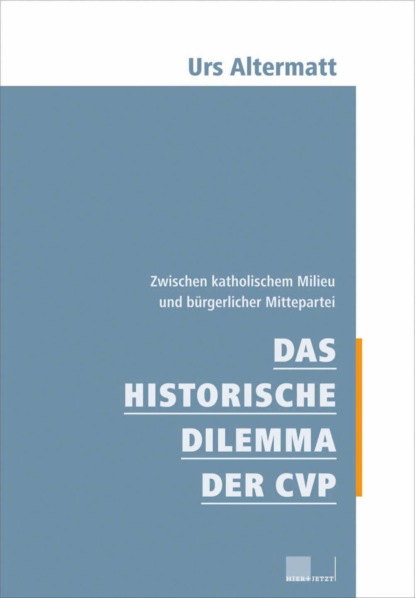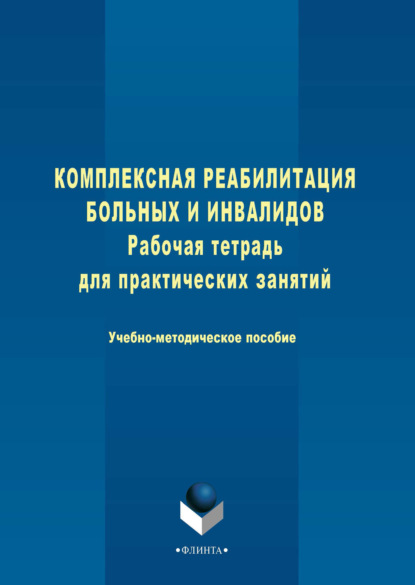- -
- 100%
- +
Auflösung des katholischen Sozialmilieus
Die Modernisierung nach dem Zweiten Weltkrieg beendete die klassische Epoche des Milieukatholizismus, der in der Schweiz wie in anderen Ländern Westeuropas von 1850 bis 1950 die Mentalität und Kultur der Mehrheit der Katholiken geprägt hatte. Nach Mitte der 1960er-Jahre wurden die traditionellen Sozialmilieus, nicht nur das katholische, durchlässiger; die soziokulturellen Abgrenzungen lösten sich auf.25
Dank der religiösen Bindung der kirchentreuen Katholiken wies die CVP über Jahrzehnte hinweg eine stabile Stammwählerschaft auf, die der Partei auch dann noch die Stange hielt, als die katholische Kirche im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils Krisen durchmachte. So blieben Katholiken, die sich der Kirche entfremdet hatten, oft noch treue Katholiken im wahlsoziologischen Sinn und wählten christlichdemokratisch, wodurch die CVP bis gegen Ende der 1980er-Jahre ihren Wähleranteil bei 20 Prozent zu halten vermochte. Der eigentliche Einbruch erfolgte erst am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts.26
Mit der Verzögerung von einer Generation wirkte sich die gesellschaftliche Säkularisierung auf die Wahlresultate der CVP aus. Während ein Teil der älteren Generation in den 80er-Jahren der Partei noch die Treue hielt, nahm die CVP-Sympathie unter den jüngeren Schweizerinnen und Schweizern stark ab.
Diese Entwicklung verstärkte sich mit dem Rückgang des regelmässigen sonntäglichen Kirchgangs und widerspiegelt die Abnahme kirchengebundener Katholiken. 1991 gingen erstmals junge Katholiken zur Wahl, die in urbanen Agglomerationen lebten und in ihren Familien und Schulen wenig oder nichts mehr von der früheren katholischen Lebenswelt und ihren Werten erfahren hatten. Weder in der Familie noch in den Vereinen und schon gar nicht in der Schule lernten sie kennen, was früher mit dem Begriff «katholische Weltanschauung» bezeichnet worden war; und zur Kirche gingen sie nach der Schulzeit mehrheitlich kaum noch. Diese jungen Menschen beurteilten die Parteien nach anderen Kriterien als ihre Väter und Mütter – mehr utilitaristisch als wertorientiert, mehr situativ als traditionell. Mit anderen Worten kann man in der Generationenfolge einen wichtigen Faktor des Niedergangs der CVP sehen. Der CVP sterben ihre Wähler aus, und es stossen nicht genügend neue dazu.27
Die CVP entkonfessionalisierte sich, doch – und das ist das Dilemma der Partei – die öffentliche Wahrnehmung nahm diese Wandlungen nicht zur Kenntnis. Im kollektiven Gedächtnis blieb die CVP eine Katholikenpartei, obwohl sich die Partei selbst säkularisiert hatte und kulturkämpferische Ressentiments hüben und drüben im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts nach aussen praktisch verschwanden. Mentalitätsstrukturen verändern sich äusserst langsam. Deshalb gelang es der Partei nicht, im evangelischen Volksteil wirklich Fuss zu fassen. Darin besteht eines der historischen Dilemmata. Mit den Statuten- und Programmreformen von 1970/71 öffnete sich die CVP konfessionell, doch die in jahrhundertealten konfessionellen Klischees blockierte Gesellschaft stellt die CVP nach wie vor in die katholische Ecke.
Gemäss der Wahlstudie des Bundesamts für Statistik zu den Nationalratswahlen 2011 wählten 25 Prozent der katholischen Wähler die CVP. Verglichen mit dem gesamthaften Wähleranteil der CVP von 12,3 Prozent stimmten immer noch überproportional viele Katholiken christlichdemokratisch. Bei den Reformierten erreichte die CVP 4 Prozent der Stimmen, bei der Kategorie «Andere» 7 Prozent. Weitere 3 Prozent fallen auf die Gruppe mit dem Vermerk «konfessionslos». Das Wählerprofil der CVP bleibt katholisch.28
In der politischen Landschaft der Schweiz behielt die Partei auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts das Image einer Katholikenpartei. Allerdings – und das ist die Kehrseite – verabschieden sich zunehmend katholische Stammwähler von der CVP, werden Wechselwähler oder wählen andere Parteien – gut ein Viertel der Katholiken SVP. Bei den Nationalratswahlen von 2011 gaben laut der BfS-Studie 26 Prozent der wählenden Katholiken ihre Stimme der SVP, 15 Prozent der FDP und 16 Prozent der SP.
Der schleichende Exodus der Konservativen
Die konservative Wende erfasste seit den 1990er-Jahren auch die Schweiz, obwohl dies zahlreiche Politbeobachter damals kaum bemerkten und unter dem Stichwort Populismus einordneten. Da sich die CVP in den «langen 60er-Jahren» (1958–1974) leicht nach links bewegte und sich von ihrer «konservativen» Vergangenheit bei den Parteireformen von 1970 distanzierte, öffnete sich ein neues Dilemma: Die bisherigen konservativ eingestellten Wählerschichten in den Stammlandkantonen entfremdeten sich von der Partei. Von der CVP begannen sich Katholikenkreise abzuwenden, die von der Partei eine dezidierte Ausrichtung im Sinn der christlich-konservativen Morallehre erwarteten. Ende 1994 gründeten katholische Integralisten mit der «Christlich-Konservativen Volkspartei der Schweiz», die sich später – typischerweise – in «Katholische Volkspartei» umbenannte, eine neue katholisch-konservative Partei, die eine bedeutungslose Splitterpartei verblieb, jedoch ein Symptom für die Krise der CVP darstellte.29
In den 1990er-Jahren wanderten konservative Wähler zur SVP. Der national-konservativen SVP gelang es, wert- und strukturkonservative Segmente der katholischen Bevölkerung anzusprechen und der CVP zu entziehen. In den katholischen Stammlandkantonen gewann die SVP Stimmen bei «katholikalen» und rechtskonservativen Gruppen.
Es wäre daher falsch, die Krise der CVP nur mit der Säkularisierung des Katholizismus und der Lockerung der Parteibindungen im katholischen Milieu in Zusammenhang zu bringen. Viel stärker, als man annimmt, haben die Wählerverluste der christlichdemokratischen Partei mit tief gehenden Umgruppierungen in der Parteienlandschaft zu tun.
Mitte der 70er-Jahre gingen die Boomjahre der Nachkriegswirtschaft zu Ende, sodass es zu politischen Verteilkämpfen kam. Als Zentrumspartei hatte die CVP Schwierigkeiten, sich im polarisierten Umfeld thematisch zu profilieren. Die Mitteposition, die in den Jahren des Wirtschaftswunders attraktiv gewesen war und der Partei einen Spielraum für Allianzen nach rechts und nach links geboten hatte, entpuppte sich nun als Nachteil, weil das Parteiprofil undeutlich wurde.30
Um das Dilemma der CVP besser zu verstehen, ist ein Blick in die Parteigeschichte notwendig. In der Zwischenkriegszeit von 1919 bis 1939 verortete sich die «Konservative Volkspartei» als Säule des «Bürgerblocks» im rechten Bereich des nationalen Parteienspektrums und steuerte einen pointiert antisozialistischen Kurs, auch wenn ihr aufstrebender christlichsozialer Flügel gelegentlich einen Mittelinks-Kurs einschlug. Nach 1945 bewegte sich die Partei nach dem Vorbild ihrer westeuropäischen Schwesterparteien langsam in die Mitte. 1970 positionierte sich die CVP als gemässigt reformerische Kraft im bürgerlichen Lager und wurde mit dem Slogan «dynamische Mitte» in der öffentlichen Meinung wahrgenommen.31
Mit dem demonstrativen Abschied vom konservativen Erbe 1970/71 gaben die Christlichdemokraten ein Terrain frei, das sie vom 19. Jahrhundert bis in die 1950er-Jahre unangefochten – zusammen mit der bernisch geprägten Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei – besetzt gehalten hatten.32 Die durch die moderne Zeit verunsicherten konservativen Bevölkerungsgruppen, die in Volksabstimmungen über die Migrations- und Asyl- sowie über die Europa- und Aussenpolitik wiederholt Achtungserfolge errangen, irrten zunächst desorganisiert als Protestler gegen den modernen Zeitgeist umher, denn die rechtspopulistischen und ausländerfeindlichen Ein-Themen-Parteien von James Schwarzenbach und Valentin Oehen boten den Katholisch-Konservativen keine dauerhafte politische Heimat. Immer noch geprägt von einem christlichen Humanismus, wollten sie eigentlich keine Rassisten sein und hatten daher moralische Hemmungen, in diese rechtsradikalen Parteien einzutreten, selbst dann, wenn sie gelegentlich in Volksabstimmungen mit diesen stimmten.
In den 90er-Jahren fanden diese heimatlosen Konservativen einen Parteiführer, dem sie auf dessen national-konservativen Pfaden folgen und damit ihrer Opposition gegen die Modernisierung und die «classe politique» Ausdruck verleihen konnten.33 Der Unternehmer und evangelische Pfarrerssohn Christoph Blocher wandelte die Zürcher und später die gesamtschweizerische SVP in eine national-konservative Partei um, die Fremdenfeindlichkeit mit Fragen der nationalen Identität verband.
Als entscheidendes Element kam hinzu, dass Teile der christlichdemokratischen Basis dem europafreundlichen Kurs der CVP in den 90er-Jahren nicht folgten und in der EWR-Abstimmung vom 6. Dezember 1992 Blochers Parole übernahmen. Da die neue SVP ohne Scheu populistische Mittel gegen die «classe politique» anwandte und enorme Finanzmittel zur Verfügung hatte, verstärkte sich ihre Wirkung als Protestpartei. Als Retterin einer unabhängigen Schweiz wuchs die SVP rasch über ihre bisherigen Hochburgen in der ursprünglich protestantisch geprägten deutschen Schweiz hinaus und konnte in katholischen Regionen Fuss fassen, wo sie bisher erfolglos gewesen war. Die Erosion der CVP hängt – und dies ist ein wesentliches Element – mit der Geschichte des politischen Konservativismus zusammen, der sich unter der Fahne der SVP neu sammelte. In einem gewissen Sinn gelang der SVP, was die Konservativen schon im 19. Jahrhundert erfolglos angestrebt hatten: die Gründung einer überkonfessionellen konservativen Partei. Darin liegt das strukturell Neue des Parteiensystems, das in der Regel zu wenig Beachtung findet.
Wie überall in Europa zersplitterte sich die Mitte. Mit der neu gegründeten BDP, die eine Restpartei der alten BGB darstellt, erhielten die CVP – wie auch die FDP – 2011 eine Konkurrentin, was in der politischen Mitte zu einer komplizierten Gemengelage führt, zumal auch die Grünliberalen dort ihre Wähler abholen.
Verlust des Vermittlermonopols
Seit 1970 positioniert sich die CVP im Zentrum des politischen Parteienspektrums, in der Ära der Zauberformel-Regierung von 1959 bis 2003 besass sie eine zentrale Ausgleichsfunktion. Da die Ausgleichspolitik zur Identität der CVP gehört, ist ihr Politikstil bereits seit 1900 auf Kompromiss und nicht auf Konfrontation ausgerichtet. Mit ihrer sozioökonomisch heterogenen Wählerschaft suchte die Partei Allianzen nach allen Seiten. Bisher gelang es der CVP nicht, diese Vermittlerfunktion in eine Zunahme der Wählerstimmen umzufunktionieren. Die CVP bleibt die klassische Koalitionspartnerin für andere Parteien, verliert aber dadurch an Profil.34
In den Wahlen von 2011 verstärkte sich die Fragmentierung des Parteiensystems. Im Nachhinein bilden die Jahre von 1995 bis 2011 eine «Sattelzeit», in der eine neue Parteienarchitektur entstand. Das mit der ersten Proporzwahl 1919 beginnende 20. Jahrhundert ging 1999 zu Ende. Im Zusammenhang mit der CVP ist bedeutungsvoll, dass sich 2011 eine «neue Mitte» mit der CVP (und der EVP) als Absteiger und der BDP und GLP als Aufsteiger etablierte.
Die von den Christlichdemokraten im Nationalrat initiierte Fraktionsgemeinschaft CVP/EVP/GLP/BDP war insgesamt erfolgreich, zahlte sich aber für die CVP nicht aus. Im Gegenteil: Mit den «neuen» Mitteparteien, die sich bisher im programmatischen Profil wenig voneinander unterschieden, erwuchsen der CVP Konkurrenten, die sich alle auf irgendeine Weise als «Mediatoren» im Konkurrenzkampf der Parteilager anbieten.35 Im Kräfteparallelogramm der Parteien erhielt die CVP Konkurrenz. Als klassische Mittepartei zog sie keinen Gewinn aus der Polarisierung, von der seit den 1990er-Jahren die Polparteien SVP und SP profitierten.
Ebenso negativ wirkte sich der neue Trend zur Mitte aus. Je länger desto mehr hängt die Zukunft der CVP davon ab, ob es der Partei gelingt, ihre politische Kernkompetenz, die «Nachfrage nach politischer Mediation»36 für die Wähler als Anziehungsfaktor herauszustreichen. In der Vergangenheit politisierte sie erfolgreich als Vermittlerin in der Sozialpolitik. Nun stellt sich die Frage, ob sie ihre Kompromissqualitäten auch bei den neuen Themen – Umweltschutz, Migration, Europa – anwenden kann. Der Atomausstieg, die sogenannte Energiewende, erfordert von den Parteien die Bereitschaft zum Kompromiss zwischen Wirtschaft und Umweltschutz. Mit Bundesrätin Doris Leuthard als Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation besetzt die CVP in der Landesregierung eine Schlüsselposition. Laut Claude Longchamp besteht die Gefahr, dass die GLP den Christlichdemokraten in den urbanen Ballungsgebieten von Zürich, Bern, Basel und Lausanne und die BDP auf dem Land die Wählerinnen und Wähler der jüngeren Generation und der neuen Mittelschicht entzieht.37
Auf mittlere Sicht gesehen muss sich die politische Mitte neu definieren und konstruieren, denn das Wählerreservoir reicht nicht für vier Parteien. Diese Regruppierung wird schlussendlich – so meine Einschätzung – nur über Fusionen oder Zusammenbrüche (siehe Landesring der Unabhängigen) laufen. Mit ihrer protestantisch geprägten Wählerschaft wäre die reformiert-konservative BDP für die CVP eine ideale Partnerin, zumal beide Parteien eine ländlich-kleinstädtische Verankerung aufweisen und sich konfessionell ergänzen.
1.4 STAMMLANDE VERSUS DIASPORA: ZWEI KATHOLIZISMEN, ZWEI POLITIKEN
Nur dreizehn Jahre, von 1957 bis 1970, führte die CVP einen Namen, der eigentlich auf treffende Weise die soziale Identität der Partei umschrieb, wenn man die Partei nicht – fälschlicherweise – auf das Schlagwort «Katholikenpartei» reduzieren will: «Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei».
Durch das ganze 20. Jahrhundert charakterisierte der innerparteiliche Antagonismus zwischen dem konservativen und dem christlichsozialen Flügel die Parteigeschichte. Die Begriffe «konservativ» und «christlichsozial», die übrigens auch die CSU Bayerns für sich in Anspruch nimmt, gehen in ihren Ursprüngen auf die Sozialgeschichte des Schweizer Katholizismus zurück. Dahinter verbergen sich zwei Schwerpunktspole, die die Partei noch im 21. Jahrhundert in sich trägt. Auf dieses Faktum spielte der Zuger Nationalrat Gerhard Pfister wahrscheinlich an, als er in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» 2012 erklärte: «Im Moment haben wir den Status einer Sonderbundpartei, das müssen wir ändern.»1
In der Tat: Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren in der Volkspartei Interessenkonflikte zwischen den Katholiken in den «Stammlanden» und in der «Diaspora» prägende Faktoren. Hat der Politgeograf Michael Hermann Recht, wenn er in einer Zeitungsanalyse die CVP als «eine Partei aus Flügeln, jedoch ohne Rumpf» bezeichnet hat?2
Konfession als Bindemittel zweier Welten
Die Verfassung von 1848 brachte die Niederlassungs- und Religionsfreiheit für die Christen aller Bekenntnisse, für die Juden erst 1866 beziehungsweise 1874.3 Dank der rasanten Industrialisierung führte die Personenfreizügigkeit zu einer fortschreitenden Binnenwanderung. Bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts lebten mehr Katholiken ausserhalb der früheren Sonderbundskantone Luzern, Freiburg, Wallis, Uri, Ob- und Nidwalden, Schwyz und Zug.
Die Kulturkämpfe der 1840er-Jahre bewirkten eine Verkonfessionalisierung der Politik, was zur Folge hatte, dass sich die kirchentreuen und politisch aktiven Katholiken der gesamten Schweiz zusammenschlossen. Während die altkonservativen Eliten der Sonderbundskantone die Stärkung der Stammland-Bollwerke als oberstes Ziel verfolgten, nutzte die junge Schule des «Studentenvereins», der als einziger Verein die Sonderbundskatastrophe von 1847 überlebt hatte, die liberal-demokratischen Freiheitsrechte, um das weitgehend zerstörte Vereins- und Zeitungswesen wieder aufzubauen.
Aus diesen sozialen und politischen Entwicklungen entstanden zwei Katholizismen, die bis zum Ersten Weltkrieg die katholisch-konservative Politik prägten: der Stammland- und der Diasporakatholizismus. Nach ihrer Niederlage mussten sich die Eliten der Sonderbundskantone den politischen Realitäten anpassen. Der Luzerner Politiker Philipp Anton von Segesser und die Urschweizer Landammänner waren der Meinung, die katholisch-konservative Politik erlange nur dann gestaltende Kraft im Bundesstaat, wenn katholische Kantonalstaaten als modernisiertes «corpus catholicum» mit ihrem Gewicht die schweizerische Politik mitbestimmten. Daraus folgerten sie einerseits eine klare Opposition zum freisinnig dominierten Bundesstaat und andererseits die politische Rückeroberung der katholischen Sonderbundskantone, die sie «Stammlande» nannten.4
Hinter dem Begriff «Stammlande» verbarg sich die politische Strategie der im Bürgerkrieg geschlagenen und von den Posten des Bundesstaats weitgehend ausgeschlossenen Sonderbündler, ihre regionale Identität im Bundesstaat zu erhalten. In der national-liberalen Geschichtsschreibung wurde dieses Stammland-Konzept zu lang als hinterwäldlerischer und rückwärtsgewandter Hyperföderalismus gedeutet.
Als Diasporakatholizismus bezeichnete man die Glaubens- und Lebenswelt der Katholiken ausserhalb der Stammlande. Wie der Kirchenhistoriker Franz Xaver Bischof schreibt, nimmt der aus dem Griechischen stammende Begriff «Diaspora» auf die zahlenmässigen Konfessionsverhältnisse Bezug und steht für «jede unter einer andersgläubigen Mehrheit lebende religiöse Minderheit».5 In der Terminologie der katholisch-konservativen Eliten bezog sich allerdings Diaspora nicht in erster Linie auf die zahlenmässige Stärke des katholischen Volksteils, sondern auf die Stellung des parteipolitischen Katholizismus in den Kantonen. Wichtiger als die konfessionelle Minderheitensituation war die Tatsache, dass die Katholisch-Konservativen ausserhalb der Stammlande in keinem Kanton eine stabile Regierungsmehrheit besassen und als Minderheitspartei Oppositionspolitik betreiben mussten.
Neben den klassischen Diasporakatholizismen in den ursprünglich protestantischen Kantonen Zürich, Bern (mit dem 1815 dazu gekommenen katholischen Nordjura und dem Laufental), Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Waadt, Neuenburg und Genf (mit den 1815 zugeteilten katholischen Gemeinden) zählten auch die Katholizismen der konfessionell gemischten (d. h. paritätischen) Kantone Glarus, Graubünden, Aargau, Thurgau und St. Gallen sowie die ursprünglich katholischen Nicht-Sonderbundskantone Tessin und Solothurn (mit dem reformierten Bucheggberg) dazu. Je nach ihrer zahlenmässigen Stärke waren hier die Katholisch-Konservativen als Minderheit in der Regierung vertreten oder standen völlig ausserhalb der kantonalen Regierung.
Mit der Industrialisierungswelle am Ende des 19. Jahrhunderts wanderten Innerschweizer, Freiburger und Walliser als erste Migranten in die industrialisierten Zentren des Mittellandes aus. Sie waren für die protestantischen Einheimischen «Fremde», was in der Geschichtsschreibung lange übersehen worden ist. Die dem politischen Katholizismus verbundenen Einwanderer bauten in der Diaspora katholische Vereine und Parteien auf, die einen sozialreformerischen, das heisst christlichsozialen Kurs einschlugen. Im Unterschied dazu konnten sich die Parteien in den Stammlanden auf eine gewerblich-agrarische Wählerbasis mit einer ausgeprägt bürgerlich-konservativen Elite stützen.
Diese unterschiedlichen Strukturen hatten zur Folge, dass in der Landespartei zwei Katholizismen mit unterschiedlichen Zielen und Strategien entstanden. Als Bindemittel wirkte die katholische Konfession, die den weltanschaulichen Zusammenhalt vermittelte, der die soziökonomischen und kulturellen Gegensätze zu überwinden half. Dabei entwickelten die Vorgängerparteien der CVP spezielle neokorporativistische Ausgleichsmechanismen, die die Eliten steuerten, um die Einheit der Landespartei zu erhalten.
Vom Ende der hundertjährigen Alleinherrschaft in den konservativen Stammlanden
In der konkreten Politik waren die im Bürgerkrieg unterlegenen Katholisch-Konservativen nach 1848 bestrebt, die von der Siegerpartei aufgezwungenen radikal-liberalen Regimes so rasch als möglich abzulösen. Traumatisiert durch den Bürgerkrieg und die Willkür der freisinnigen Bundesgewalt, verbanden sich katholische Konfession und Regionalismus zu einer Allianz, die die Machtstellung der Katholisch-Konservativen im Zeichen eines gegen Bundes-Bern gerichteten Affekts über mehr als ein Jahrhundert am Leben erhielt.
Mit Hilfe der katholischen Kirche gelang es so der katholisch-konservativen Bewegung, die Herrschaft in den Landsgemeindekantonen Uri, Schwyz und Ob- und Nidwalden in kürzester Zeit zurückzugewinnen. Berühmt geworden ist der Fall des liberalen Nidwaldner Nationalrats Johann Melchior Joller, der nach inszenierten Spukgeschichten in seinem Stanser Haus aus seiner Heimat emigrierte und in die päpstliche Armee in Rom eintrat.6 In Freiburg erfolgte der Umschwung 1856 und im Kanton Luzern im Jahr 1871.
Als die neue Bundesverfassung 1874 in Kraft trat, waren die Regierungen aller Sonderbundskantone wieder in den Händen der katholisch-konservativen Partei, die ihre Kantone zu Bollwerken im Bundesstaat ausbauten, in denen sich die katholisch-konservativen Kräfte zurückziehen und sich regenerieren konnten. Die Erfolge hatten ihre Kehrseite und förderten den defensiven Réduitgeist, der sich nicht nur gegen Zentralisierungen des Bundesstaats wandte, sondern aus Angst vor zentralistischen Organisationen sogar die Gründung einer eigenen Landespartei hemmte.
Erst die kulturelle Integration der Katholiken in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erschütterte die katholisch-konservativen Hegemoniestellungen. In den 1990er-Jahren gelang der SVP der Einbruch in die Stammlande, indem die Nationalkonservativen die in Jahrzehnten gewachsene Abwehrhaltung gegen jedwelche Zentralisierung in einen Protest gegen das Europa Brüssels umfunktionierten und im kollektiven Gedächtnis an den Kampf der Alten Eidgenossen gegen fremde Vögte appellierten. Damit lockte die SVP Teile der Katholisch-Konservativen, die durch das Bindemittel des katholischen Milieus nicht mehr genügend zusammengehalten wurden, in die nationalkonservative Partei.
Mit Verspätung auf die Mittelland-Schweiz entfaltete die Moderne auch in den katholisch-konservativen Stammlanden ihre Erosionskräfte.7 In Freiburg büsste die Partei 1966 im Grossen Rat und 1981 in der Regierung die absolute Mehrheit ein, und 1982 folgte als erster Innerschweizer Kanton das wirtschaftlich aufstrebende Zug. Um die Mitte der 1980er-Jahre besassen die Christlichdemokraten noch in den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Wallis und Appenzell Innerrhoden die absolute Mehrheit.
Doch schon 1987 verlor die Luzerner CVP die Mehrheit im Kantonsparlament, während sie diese in der Regierung bis 2005 halten konnte. Ende der 90er-Jahre brachte der SVP-Aufstieg auch die Parteienlandschaft in der Urschweiz durcheinander. In Schwyz verlor die CVP 1988 die Mehrheit im kantonalen Parlament, 2004 in der Regierung.
Diesen Verlusten in den Kantonsregierungen gingen Rückschläge bei den doppelten Ständeratsvertretungen voraus.8 Den Anfang machte der Kanton Luzern mit der Wahl des freisinnigen Christian Clavadetscher im Jahr 1955. Das war eine Zäsur, denn bis in die Mitte des 20.Jahrhunderts hatte die CVP in den ehemaligen Sonderbundskantonen alle vierzehn Ständeratsmandate inne, eine Regel, von der es temporäre Ausnahmen gab. Gerade weil die CVP in den Stammlanden über hundert Jahre stabile Hochburgen besass, stellte der Verlust der Doppelmandate in der Kleinen Kammer ein Alarmzeichen dar, das als Fanal für das Ende einer Ära gedeutet werden konnte.
1971 büssten die Christlichdemokraten einen Ständeratssitz in Zug ein, 1979 in Freiburg und 1991 in Schwyz. 1998 verloren sie in Obwalden das einzige Ständeratsmandat. Der Tiefpunkt war erreicht, als die Christlichdemokraten 2011 wegen innerparteilicher Streitigkeiten den einzigen ihnen verbliebenen Ständeratssitz im Kanton Schwyz an die SVP abgeben mussten. Zum ersten Mal seit 1848 stellt die CVP Schwyz keinen Ständerat. Der Kanton Wallis ist der letzte Kanton, in welchem die Christlichdemokraten mit ihren beiden Flügeln 2011 die zwei Ständeratssitze halten konnten. Nur dank der kleinen Urschweizer Kantone konnte die CVP 2011 im Ständerat ihre relative Stärke von 13 Sitzen aufrechterhalten.
Nachhaltiger Aufstieg der Christlichsozialen in den paritätischen und Diasporakantonen