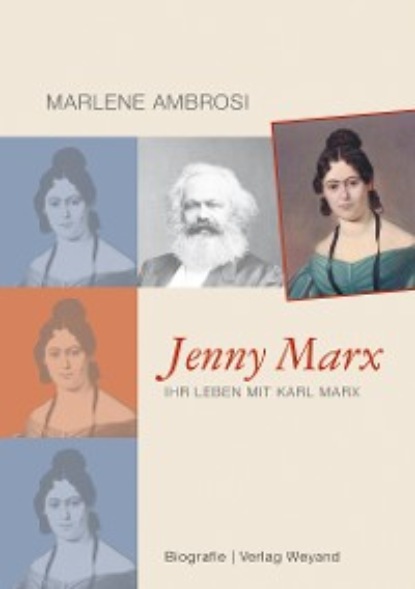- -
- 100%
- +
2 Krosigk, Jenny Marx, S.16
3 Krosigk, Jenny Marx, S.17
4 Gemkow, Aus dem Leben einer rheinischen Familie, S.510
5 Gemkow, Aus dem Leben einer rheinischen Familie, S.512
6 Gemkow, Aus dem Leben einer rheinischen Familie, S.512
Politische Sozialisation in der Grenzstadt Trier
Ludwig von Westphalen war dienstbeflissen und loyal, aber er gehörte nicht zum Typus des bornierten, stockkonservativen Staatsbeamten; im Gegenteil, er glaubte, dass es für seinen Staat gut sei, sich nicht der gesellschaftlichen Entwicklung entgegenzustellen, sondern den Bürgern Mitspracherechte zuzugestehen. Hatten nicht die Befreiungskriege gezeigt, wozu Preußen imstande war, wenn die Bevölkerung sich mit ihrem Staat solidarisierte? Das Untertanentum mit der Knute zu zementieren, schien ihm unvernünftig und ein Grund für die Unzufriedenheit zu sein, gerade beim Bürgertum, dem Träger des modernen Gemeinwesens. Mit dieser Einstellung war er vermutlich nicht alleine, aber einflusslos. Der preußische König ließ seinen Herrschaftsanspruch nicht in Frage stellen. Friedrich Wilhelm III. (1770 – 1840), Ehemann der legendären Königin Louise, verfolgte eine restaurative Politik mit absolutistischen Tendenzen und verschärfte diese anlässlich der Unruhen im Jahre 1830. Mit Zar Alexander I. und Metternich ging er konform in der Verfolgung aller freiheitlichen Bewegungen.
Die Rheinprovinz und insbesondere deren Regierungsbezirkshauptstadt Trier waren für die preußische Regierung angesichts dieses Herrschaftsverständnisses keine leicht zu regierende Region. Hinzu kam die schlechte wirtschaftliche Lage. Die Befreiungskriege 1813/14 hatten einen hohen Tribut bei der Zivilbevölkerung gefordert. Blüchers Stabschef, der spätere Generalfeldmarschall Gneisenau, berichtete, er habe noch nie so ausgemergelte und ausgehungerte Gestalten gesehen wie in der Trierer Gegend, mit einer Ausnahme, nämlich französische Kriegsgefangene in russischen Lagern. Mit diesen Bildern vor Augen wurde Oberbürgermeister Wilhelm von Haw bei der preußischen Regierung mit der Bitte vorstellig, die wirtschaftliche und finanzielle Misere in seiner Stadt zu mildern. Die von ihm zur Bekämpfung der Armut der „untersten Volksklasse“ geforderten 1.500 Taler wurden nicht bewilligt, man stellte lediglich 600 Taler zur Verfügung. Der Oberbürgermeister beschrieb 1830 die Stimmung in seiner Stadt: „Oft muß man hören, dass die Einwohner als französisch gesinnt, als der preußischen Regierung abgeneigt beschrieben werden und beschuldigt werden. Eine so unvernünftige Beurteilung, die wir von vielen uns ganz fremden Beamten, die das Land nicht kennen, die Denkart der Einwohner nicht verstehen und unter denen manche durch einen perfiden Gegensatz sich geltend zu machen suchen, erlitten haben, ist eine empörende Misshandlung. Wer zu denken, zu vergleichen und zu verurteilen vermag, der weiß, dass in Hinsicht auf die Volksstimmung die übergänge nicht zu erzwingen und wesentliche Veränderungen nur von der Dauer der Zeit zu erwarten sind. Umgeben von Tumult, Aufruhr und Empörung, hat die Rheinprovinz ungeachtet aller Keime der Unzufriedenheit die öffentliche Ruhe und Ordnung bewahrt. Im Vertrauen auf die Gerechtigkeit und die Einsichten des Königs werden wir eine bessere Zukunft ruhig abwarten. Lindere man den Druck der unerträglich gewordenen Steuern, dann werde ich mich innig freuen, und alle rechtlichen mit mir, beteuern zu können, dass die Rheinländer und namentlich die Trierer mit wahrer Liebe für die Person des Königs Ergebenheit und Anhänglichkeit für die Regierung vereinigen, daß man auf ihre unverbrüchliche Treue und unbeschränkte Zuneigung zählen dürfe.“ 1 Falsche Anschuldigungen von Beamten, die unfähig waren, die Situation der Bevölkerung zu verstehen, wurden hier verbrämt angeprangert. Und solange die empörenden, ruinierenden Steuern auf den Einwohnern lasteten, konnte man nicht verlangen, dass der König und mit ihm die Preußen beliebt waren. Die Politik der Herrschenden, getrieben von der Angst vor der eigenen Bevölkerung und einzig auf den Machterhalt einiger Cliquen zielend, wurde von vielen rigoros abgelehnt. Die „Trier’sche Zeitung“ setzte sich für Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit ein und trotz scharfer Zensur war sie für den Oberpräsidenten der Rheinprovinz „eins der radikalsten Blätter deutscher Sprache.“ 2 über Jahre hinweg unterstützten die Redakteure die kritische Haltung der Bürgerschaft und forderten politische und soziale Reformen ein.
In Trier befürchteten die preußischen Behörden wiederholt Unruhen, denn aus Sicht des Historikers Gemkow gab es „Vorzeichen ... bereits in Form von Drohungen und Missmut bei den Unterprivilegierten. Der Regierungsbezirk Trier galt hinsichtlich des Lebensstandards der Bewohner als der schlechteste, erbärmlichste im preußischen Hoheitsgebiet. Die seit Jahren zunehmende Not der unteren Schichten, die drückenden Mahl- und Schlachtsteuern, die wachsende Zahl an gerichtlichen Pfändungen und Versteigerungen, an Konkursen und Verpfändungen in der Stadt – bis in die Mittelklasse hinein – machten die Einwohner 1830 empfänglich für revolutionäre Einflüsse. Mannigfache regierungs- und preußenfeindliche Aktivitäten in Trier ließen die Behörden sogar einen politischen Aufstand befürchten.“ 3 In solch einer preußischen Behörde war Jennys Vater federführend; neben Hospitälern und Wohltätigkeitsanstalten fielen in sein Ressort Gendarmerie und Gefängnisse. Der liberale, königstreue Beamte hoffte in einem Brief an Friedrich Perthes, den Vetter seiner Frau, auf die „Weisheit und vaterländische Huld“ des Königs, „dass aus der gegenwärtigen Verwirrung der gleichsam aus ihren Angeln gehobenen politischen Welt die wahre Freiheit im unzertrennlichen Bunde mit der Ordnung und Vernunft, gleich einem Phönix aus der Asche hervorgehen werde.“ 4 Westphalen hielt es für einen Fehler, die noch von der französischen Verwaltung eingeführte Personal- und Mobiliarsteuer durch eine viermal höhere Klassensteuer zu ersetzen, denn damit werde die Verelendung nur gesteigert. In einem Rechenschaftsbericht von 1829 monierte er, „daß (es) der mittleren und geringen Klasse der Landbewohner an Arbeitsverdienst und Erwerbsmitteln fehle.“ 5 Es bleibe demzufolge nur eine Gruppe von ländlichen Bewohnern übrig, der es gut gehe, nämlich die obere Klasse, die durch einige Großbauern und adlige Großgrundbesitzer repräsentiert werde. Er machte auf „wirklich vorhandenen großen Nothstand“, zunehmende Verarmung und großen Geldmangel, auch bei der Mittelschicht, aufmerksam und verwies auf die äußeren Anzeichen der prekären Lage. Viele Häuser waren trotz schöner Fassaden baufällig und 30 größere Häuser standen nach dem Abzug der Franzosen leer. Es gab keine Wasserleitungen, höchstens einen Hausbrunnen, und das Schmutzwasser wurde in die Straßenrinnen gekippt. Ratten und Ungeziefer und demzufolge Krankheiten und Epidemien blieben nicht aus. 1849 und 1865/66 forderten Cholera-Epidemien viele Todesopfer in Trier.
Die Wirtschaft stagnierte. Man zögerte, in der Grenznähe Industriebetriebe anzusiedeln, denn wozu investieren, wenn man nicht wusste, wann sich die preußische Armee mit französischen Truppen in diesem Gebiet wieder bekriegen würde? Um die Truppen im Bedarfsfall schneller aufmarschieren lassen zu können, wurde 1860 eine Eisenbahnverbindung zwischen Luxemburg, Trier und Saarbrücken gebaut.
Der einstmals schwungvolle Weinhandel lag am Boden und führte zu einer Verelendung der Winzer. Ludwig Gall (1791 – 1863), Regierungssekretär, Erfinder und Sozialtheoretiker, prangerte das Elend in Trier in seinem 1825 erschienenen Buch „Was könnte helfen?“ an und machte Vorschläge zur Verbesserung. Gall half konkret, indem er 1854 zur Verbesserung des Weines das heute nicht mehr zulässige Verfahren der „Nasszuckerung“ propagierte und damit den Winzern an der Mosel ihre Existenz sichern half. Ludwig von Westphalen wird Gall gekannt haben.
Die Arbeitslosen, Winzer und Tagelöhner aus dem Umland drängten in die Stadt und vergrößerten die Zahl der Armen. 1834 wurde die Straßenbettelei verboten, aber diese Anordnung ließ sich nicht durchsetzen, die Not war zu groß. Das Elend zeigte sich auch daran, dass viele Kinder die Schule nicht besuchen konnten, weil sie nicht in Lumpen im Unterricht erscheinen sollten. Holzdiebstahl und Forst- und Feldfrevel nahmen zu und mit dem Zuzug des Militärs stieg die Prostitution erheblich an. 6 Das Militär, das 10 – 15% der Bevölkerung ausmachte, war ein besonderer Kostenfaktor, da die Stadt für dessen Verpflegung und Einquartierung zumindest teilweise zuständig war. 7 Von der Bevölkerung gehörten 21% zur Mittelschicht und nur 1% zur Oberschicht. 78% der Stadtbevölkerung vegetierten am Existenzminimum, ein Viertel davon lebte von Fürsorge und Almosen. Von 16.973 Einwohnern (mit Frauen und Kindern) erfüllten 1846 nur 728 Männer über 25 Jahren die Bedingungen für das Zensuswahlrecht, das ein Jahreseinkommen von mindestens 300 Talern vorschrieb. Da sich für den Mittelstand zunehmend eine Verelendung abzeichnete, stieg die Aussicht auf soziale Unruhen in einer breiten Bevölkerungsschicht.
Die Ungerechtigkeit des Systems bereitete Vater Westphalen Sorgen und er verschwieg seine Befürchtungen zu Hause bei der aufgeweckten jungen Jenny, bei Sohn Edgar und dessen Freund Karl im nachmittäglichen Kreise nicht. Jenny hatte den Vater einige Male auf seinen Inspektionsreisen begleitet und wurde dabei auf die bittere Not der Menschen aufmerksam. Das Elend der Landbevölkerung, der Bauern und Winzer, hinterließ bei ihr einen bleibenden Eindruck; ihr „Mitleiden“ mit den Unterdrückten, die Tag und Nacht schufteten und dennoch am Existenzminimum dahinvegetierten, war geweckt. Obwohl es nicht schaden konnte, wenn eine zukünftige Herrin wusste, aus welchen Verhältnissen ihre Bediensteten stammten, sie also Gutes tat, wenn sie den elenden Geschöpfen Kost und Logis gab, sollte der Einblick in die Lebensverhältnisse der unteren Klasse keinesfalls zu einer Forderung nach Veränderungen führen. Aber wie sollte Jenny sich systemkonform entwickeln, wenn der eigene Vater mit ihr und den beiden jungen Männern offen über die Missstände in einem Staat sprach, welcher es zuließ, dass ganze Bevölkerungsgruppen darbten? Nur wer Leistungen und Güter produziere, so hieß es in der von ihnen diskutierten Lehre von Henri comte de Saint-Simon (1760 – 1825), sei für die Gesellschaft von Nutzen und solle angemessen nach Leistung entlohnt werden. Die Verteilung des Sozialprodukts solle gerecht erfolgen, war eine seiner Forderungen. Die Vorstellungen des Vorvaters der wissenschaftlichen Soziologie und des utopischen Sozialismus´ fielen auf fruchtbaren Boden bei Jenny, Edgar und Karl, die die Kluft zwischen Arm und Reich in der Stadt und der Umgebung täglich beobachten konnten. Bei jedem Gang durch Trier und jeder Wanderung oder Fahrt in die Umgebung konnten sie Armut, Verwahrlosung und Bedürftigkeit registrieren.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis die jungen Leute sich als Vertreter des „Jungen Deutschland“ sahen, einer literarischen Bewegung dieser Zeit, die demokratische Freiheitsrechte und soziale Gerechtigkeit einforderte. Dennoch waren die Eltern nicht übermäßig beunruhigt: Vater Westphalen war das Vorbild und er war kein Oppositioneller, kein Antimonarchist, nur ein kritischer, denkender Beobachter. Jennys und Karls Lebenswege schienen vorgezeichnet: Jenny würde einen Mann von Adel heiraten und Kinder bekommen, Karl nach einem Studium seine Fähigkeiten in den Dienst des preußischen Staates stellen und vielleicht die gesellschaftlichen Missstände in Trier und im Rheinland verbessern helfen.
1 Böll, Aufsätze,Kritiken,Reden, S.90/91
2 Monz, Karl Marx, Grundlagen der Entwicklung zu Leben und Werk, S.107
3 Gemkow, Edgar von Westphalen, S.407/408
4 Gemkow, Edgar von Westphalen, S.408
5 Krosigk, Jenny Marx, S.17
6 Monz, Karl Marx. Grundlagen der Entwicklung zu Leben und Werk, S.86
7 Monz, Karl Marx. Grundlagen der Entwicklung zu Leben und Werk, S.86
Verliebt, verlobt, getrennt
Die Jahre 1830 und 1831
Jenny von Westphalen stand im Mittelpunkt der Familie. Die junge Frau bezauberte durch ihre Intelligenz und nahm durch ihr Interesse an aktuellen Themen und gesellschaftlichen Problemen für sich ein. Offene Parteinahme für die Armen oder Aufmüpfigen entschuldigte ihr Umfeld mit jugendlicher Unreife. Nur mit dem ältesten Bruder gab es immer wieder Reibereien. Ferdinand machte aus seiner Regierungstreue und seiner Ergebenheit zum preußischen König keinen Hehl und stieß damit auf Unverständnis und Widerspruch bei seiner jüngeren Schwester. Der Karrierejurist, sehr adelsbewusst, zeigte sich zudem den im väterlichen Haushalt lebenden Frauen gegenüber recht überheblich. Die „Damen benehmen sich ganz artig, jedoch lasse ich mich mit ihnen nicht vertraulich in wichtige Unterhaltung ein, u. setze ihnen in der Regel ein ernstes etwas phlegmatisches Antlitz entgegen“ 1 , schrieb er seiner Braut. Stiefmutter Caroline, ihre Schwester Christiane Heubel, die seit 1817 im Westphal’schen Haushalt lebte, und Jenny hätten gerne mit ihm über seine zukünftige Frau, Louise von Florencourt, geplaudert und ihm Einrichtungstipps für seine neue Wohnung in Bitburg gegeben, aber er unterband jegliche Vertraulichkeit. Ferdinand war nicht bereit, sich „mit diesen gleichgültigen abstoßenden Personen … in Unterhaltungen über das einzulassen, was mir das Liebste und Edelste auf der Erde ist und was wäre es dann auch, wenn sie in Dein Lob u. in mein Glück Deinetwegen mit einstimmten, müsste ich mir ja doch stets sagen, dass es nicht aus ihren Herzen kam. So erwiedre ich denn auf ihre Abneigung mit Kälte und Trockenheit.“ 2 Zum Eklat ließ er es wegen des Vaters, dessen angenehmes Wesen allgemein betont wurde, nicht kommen. Ferdinands Mutter, Ludwigs erste Frau, hatte des Vaters Sanftmut, seine seltene Herzensgüte und die immer gleiche Gemütsstimmung gerühmt, und diese Meinung teilte Caroline, die zweite Frau. „Ein herrlicher Charakter, durch den ich hienieden einen Himmel genieße, alle Stürme des Lebens tragen wir mit Liebe untereinander, denn oft hat freilich das Schicksal unsanft an uns gezerrt, aber wer eine solche Stütze hat wie ich an ihm habe, da sinkt mein Fus nicht“ 3, pries sie ihren Mann bei Vetter Perthes. Ein solcher Mann war ein guter, verständnisvoller, liebevoller Vater, aber Ferdinand wünschte sich von ihm mehr Durchsetzungskraft. In seinen Lebenserinnerungen beklagte er: „Der edle Vater waltete über dem Ganzen in seiner unzerstörbaren Freundlichkeit und Selbstverleugnung, mit seinem fein gebildeten Geist und angeborenen Takt sich mehr unterordnend und zurückhaltend, als ihm seiner höher angelegten Persönlichkeit zukam. … Doch es lag nun einmal ein hinderndes Etwas, eine unübersteigliche Schwierigkeit im Wege – … vorwiegend in den Eigenthümlichkeiten seiner Gattin, deren Bildungsstandpunct und Begabung so ganz verschieden war von der seinigen. Dies trat denn auch in der Art und Weise der Erziehung der Kinder, sowohl was die leibliche Wartung, als was Zucht und Gehorsam betrifft, immer bemerkbarer hervor. Das leitende Princip der Mutter war, den lieben Kindern ihren Willen lassen! – und sie wurden von ihr, man kann sagen, ihnen in’s Angesicht gelobt, selbst, wenn sie dumme Streiche machten und was sich nicht schickte, ward entschuldigt oder – nicht gesehen, vor allem aber Fremden, den Freunden gegenüber, wurden der Kinder vortreffliche Eigenschaften herausgestrichen.“ 4 Eine moderne Erziehung, die Ferdinand nicht gutheißen konnte. Sein gnadenloses Urteil über die in seiner Wahrnehmung leicht proletarisch angehauchte und nicht standesgemäße Stiefmutter verriet ein angespanntes Verhältnis. Wenigstens erinnerte er sich, dass „etwas dieser Art … wir Älteren schon in Salzwedel erfahren (hatten); was Wunders, dass wir – ich nehme Carl aus – uns am Ende selbst besser und tüchtiger dünkten, als wir waren.“ 5 Das mochte bei ihm zutreffen. Obwohl der Erstgeborene nach dem Tode des Vaters den Kontakt zur Stiefmutter und seinen Halbgeschwistern hielt, leugnete er sie. In seinen Erläuterungen zu den von ihm 1859 herausgebrachten Manuskripten seines Großvaters erwähnte er nicht mit einem Wort die zweite Ehe seines Vaters. Jenny war empört, denn damit unterschlug er nicht nur 30 glückliche Lebensjahre des Vaters, sondern auch ihre und Bruder Edgars Existenz. Auf diese Weise konnte er nach Ansicht Jennys sie „geschickt um ihr, ihn störendes, Dasein bringen.“ 6 Einer der Gründe für sein Verschweigen war, dass er seine Halbschwester Jenny, eine geborene von Westphalen, nicht erwähnen wollte, weil diese inzwischen Frau Marx, die Frau eines Staatsfeindes, geworden war. Es war ihm nicht daran gelegen, dieses Faktum der Öffentlichkeit ohne zwingenden Grund zu unterbreiten.
Jenny wuchs unbeschwert in angenehmen Verhältnissen zu einer jungen Frau von Stand heran. „Meine älteste Tochter Jenny … schön an Seel und Körper, sie ist unsere wahre Freude im Leben …“ 7, schwärmte die Mutter bei ihrem Vetter über die Tochter, ein großes, schlankes Mädchen mit einem hübschen, schmalen Gesicht und ausdrucksvollen Augen, umrahmt von dunklen Haaren. Bald schon wurde die junge Adlige von der Männerwelt umworben, ihre Heiratschancen waren vorzüglich. „Jenny war ein mit den Reizen der Jugend ausgestattetes, schönes Mädchen, ausdrucksvollen Antlitzes, durch ihren hellen Verstand und energische Charakter-Anlagen die meisten ihrer Altersgenossinnen überragend. Es konnte nicht fehlen, dass sie unter den jungen Männern aller Augen auf sich zog“ 8, schrieb Bruder Ferdinand stolz an seinen Schwiegervater. Sie werde „fleißig von Curmachern umschwärmt, soll jedoch fortfahren, denselben ihr sangfroid – was in diesem Stücke gut angebracht ist – entgegenzusetzen.“ 9 Die Baronesse zeigte nicht die kalte Schulter, als ein Karl von Pannewitz aus Schlesien auftauchte. Die inzwischen zur „Ballkönigin“ avancierte Sechzehnjährige verliebte sich in den schneidigen, zackigen Secondeleutnant mit den guten Umgangsformen, und nach kurzer Bekanntschaft hielt dieser bei Vater Ludwig um ihre Hand an und erhielt die Zustimmung. Jenny war selig, turtelte mit dem schmucken Militär und fühlte sich wichtig im Kreise der jungen Damen, die, kaum erwachsen, von einem Manne zur Frau begehrt wurden. Die Verlobung fand (vermutlich) im Frühling 1831 statt. Alles schien den vorbestimmten Weg zu nehmen und die romantische Jenny träumte von Hochzeit.

Im Casino am Kornmarkt in Trier avancierte Jenny von Westphalen zur Ballkönigin
Laut den preußischen Militärakten gehörte ein Secondeleutnant Karl von Pannewitz (9. März 1803 – 16. Oktober 1856) dem 2. Bataillon des Infanterieregiments Nr. 28 an, das vom 8. Oktober 1830 bis zum 15. Juli 1831 in Trier und bis Mai 1832 im Hochwald stationiert war. Im Hause 462 bezog vom 8. Oktober bis zum 16. Dezember 1830 nachweislich ein von Pannewitz Quartier.
Die Verbindung zwischen der kapriziösen Baronesse und dem Leutnant sorgte bald für Gerede. Louise, inzwischen Ferdinands Frau, mischte eifrig mit. Nachdem sie von Caroline von Westphalen in einem „Triumphbrief“ von der Verlobung erfahren hatte, teilte sie im Oktober 1831 ihrer Mutter wichtigtuerisch mit: „Desto unangenehmer wurden aber wir durch Deine Nachrichten, Jenny’s neu geknüpftes Verhältniß betreffend, überrascht. Mir ist es noch ganz unerklärlich, wie die Mutter so schnell von ihrem wahrhaft unvernünftigen Enthusiasmus zurückgekommen ist, u. wie überhaupt die Enttäuschung in so kurzer Zeit so grell hat erfolgen können. Begierig sehen wir nun Alle Euren weiteren Bemerkungen über dieses leider! so bald von seinem ersten schönen Nimbus entkleidete Verhältniß entgegen, u. vor allem wünschen wir Jenny’s Empfindungen näher ergründen zu können, indem Ferdinand mit mir der Meinung ist, daß wenn das arme bethörte Mädchen jetzt schon den übereilten Schritt bereut, die Auflösung der Verbindung für alle Theile sehr zu wünschen ist. Wahrlich, Mutter u. Tochter dauren mich Beide sehr!“ 10 Im Familien-, Verwandten- und Bekanntenkreis wurde vermutlich über Probleme zwischen Fräulein von Westphalen und Karl von Pannewitz geklatscht, aber man war noch im Ungewissen, ob es zu einer Aufkündigung der Verlobung kommen würde. Louise zerbrach sich über Dinge den Kopf, die sie eigentlich nichts angingen. Sie bedauerte vor allem ihren Schwiegervater, den „Pylades“, denn ihr erschien „die Mutter, die doch wahrscheinlich die Hauptbeförderin von Jennys Verlobung gewesen ist, um so unverantwortlicher, da es bei wahrer Liebe für ihren ausgezeichneten Mann ihr erstes Streben hätte sein sollen, ihn … zum Verlassen des Geschäftslebens zu überreden, statt daß sie ihn, durch das eitle Befördern jener thörichten Verbindung … noch fest an seine Ketten geschmiedet hat. Oh, möchte doch dieses unpassende Verhältnis aufgelöst werden!“ 11 Nach ihrer und Ferdinands Ansicht hätte Ludwig von Westphalen aus gesundheitlichen Gründen den Dienst quittieren sollen.
Louise bat ihre Eltern, die in Trier lebten, um alle relevanten Informationen, denn der weiteren „Entwicklung von Jennys merkwürdigem Verhältnisse, sehen wir begierig entgegen.“ 12 Von Schwiegermutter Caroline hatte die Neugierige nämlich wenig befriedigende Auskünfte erhalten: „In der sie betreffenden Hauptsache, äußert sie sich übrigens sehr wenig und dunkel, so dass wir, ohne Eure vorhergegangenen Erläuterungen, von Jennys jetzigem Verhältnisse gar keine richtige Ansicht bekommen hätten.“ 13 Voller heuchlerischer Anteilnahme bat Louise ihre Mutter, Frau von Westphalen zu versichern, „daß es mir gewiß um Jennys und um ihretwillen sehr leid thäte, dies Verhältniß, von dem sie sich so viel Freude versprochen hätte, so trübe umwölkt zu sehen, dass ich indessen sehr hoffte und wünschte, dass sich diese betrübte Angelegenheit noch auf ein oder die andre Weise zu ihrer Zufriedenheit endigen würde.“ 14 Ihre Doppelzüngigkeit verriet ihr ambivalentes Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter. Sie zeigte Adelsdünkel und Arroganz und vergaß, dass ihre Mutter ein gebürtiges Fräulein Wegener war, das sich „hochgeheiratet“ hatte; somit war auch sie wie Jenny halb bürgerlich. Vielleicht förderte Caroline von Westphalen gerade deshalb die Liaison Jennys mit dem adligen Leutnant, damit der Makel wie bei Louise beseitigt werden konnte.
Die Entlobung erfolgte spätestens Ende Oktober 1831 und natürlich suchte Louise nun in den Briefen an ihre Eltern nach den Ursachen. Sie konnte „noch immer nicht begreifen, was für gewichtige neue Gründe meine Schwiegereltern u. Jenny so schnell gegen diese Verbindung eingenommen haben. Die schlechten pecuniären Aussichten für die Zukunft sind ja die nämlichen geblieben, als sie bei der Schließung dieser Verbindung waren: die Hauptgegengründe müssen jetzt also wohl in der Persönlichkeit des H. v. Pannewitz aufgefunden sein; doch schreibt meine Schwiegermutter, dass sie sich in seinem Charakter zwar nicht geirrt hätten“ 15, aber der „Hauptfehler des H.v.P.“, so hatte Louises Mutter kolportiert, sei dessen „Mangel an Kenntnis und an Sinn daran!“ 16 Bildungsmangel und Bildungsunlust waren für Louise natürlich „ein großer übelstand“, „doch hätten wir nicht geglaubt, daß dieser von Seiten der Mutter u. Jenny’s so hoch angeschlagen würde, u. glauben überhaupt nicht, daß dieser neu entdeckte Fehler einen alleinigen gewichtigen Grund zur Auflösung der Verbindung darbieten könnte, wenn nicht bedeutendere Charakter – u. moralische Fehler noch zum Grunde liegen.“ 17 Die Forderung nach Bildung über das übliche Maß hinaus konnte bei der so kritischen Jenny eigentlich kaum überraschen. Louise verbiss sich in das Thema, nahm die Rolle der ungeliebten Caroline von Westphalen und deren Schwester Christiane ins Visier. Zu ihren Eltern: „Fast möchte ich sagen, dass mir das jetzige Benehmen der beiden ältern Damen gegen den unglücklichen Liebhaber noch weit mehr widersteht als ihr früheres; oder um mich deutlicher auszudrücken, dass die thörichte, eitle Verblendung, die sie früherhin zum Begünstigen und Befördern dieser Verbindung bewog, mir fast noch verzeihlicher erscheint, als ihre jetzige Härte, Ungerechtigkeit u. Indelicatesse in Behandlung dieses Verhältnisses. Ja wenn nicht wirklich, uns sämtlich verschwiegene, bedeutende moralische Fehler, der Abneigung der beiden ältern Damen gegen H.v.P. zum Grunde liegen, so möchte ich behaupten, daß ihrem Verfahren gegen ihn sogar alle Rechtlichkeit fehlt. Wenn aber wirklich moralische Flecken an dem armen Verfolgten durch die spähenden Beobachtungen hätten aufgefunden werden können, so würden sie diesen Makel sicher nicht verschwiegen haben, da ihnen dadurch das leichteste und gerechteste Mittel zu der von ihnen so heiß gewünschten Auflösung der Verbindung in die Hand gegeben würde.“ 18 Die Stiefschwiegertochter vermutete letztendlich „gekränkte Eitelkeit“ bei den Damen: der Leutnant habe ihnen nicht mehr hofiert und sei deshalb in Ungnade gefallen. Louise ergriff Partei: „Bei aller Oberflächlichkeit und Alltäglichkeit des jungen Mannes, die ich, ohne ihn zu kennen, reichlich suggerire, dauert er mich doch indem er unrechtlich und unpassend behandelt wird. – Ja, der sonst so ruhige Carl meinte in seiner Entrüstung über die ganze Sache, dass, wenn er an H. v. Pannewitz Stelle wäre, er wohl wüsste, welch einen Aufsage-Brief er den sämtlichen Damen zusenden würde.“ 19 Sogar Bruder Carl wurde instrumentalisiert, damit Louise sich moralisierend aufspielen konnte. Für sie war zudem „das Umhertreiben auf Casino-Bällen unter solchen Umständen (...) fast eine öffentliche Blame zu nennen.“ 20 Jenny war zwar jung und lebenslustig, aber keine Herumtreiberin. Bruder Ferdinand hoffte auf Einsicht der Schwester nach der gescheiterten Verlobung, „wenn es ihr bei ihrem sonst verständigen Urtheil nicht bereits gelungen sein sollte. Aber mindestens bleibt immer eine harte sehr empfindliche Lehre zurück.“ 21 Er stellte bei seinem Schwiegervater Erwägungen zum Ende der Beziehung an, nämlich „dass der Mangel an Vermögen auf beiden Seiten … nicht als ein wesentliches Hinderniß erschienen ist; dagegen zählte ich umso gewisser auf die anderen guten und für die Zukunft noch mehr versprechenden Eigenschaften; sobald hierin aber bei dem Mann nur ein gewöhnlicher Grad anzutreffen war, u. zwar so wie er im Offiziersstande eben vorkommt, – musste ich auch die Sache für ein wahres Unglück ansehen.“ 22 Der Bruder begrüßte letztendlich die Trennung von dem doch sehr durchschnittlichen Leutnant. Mit keinem Wort ging er hingegen darauf ein, die Eltern hätten die Verlobung wegen zu naher Verwandtschaft zu der Familie von Pannewitz nicht gut geheißen. Die Mutter der ersten Frau Ludwigs war eine Friederike Albertine von Pannewitz gewesen, und dies führte in der Literatur zu überlegungen, ob nicht zu enge familiäre Verbindungen vorlagen. Dies ist im Prinzip für die Kinder aus der zweiten Ehe irrelevant.