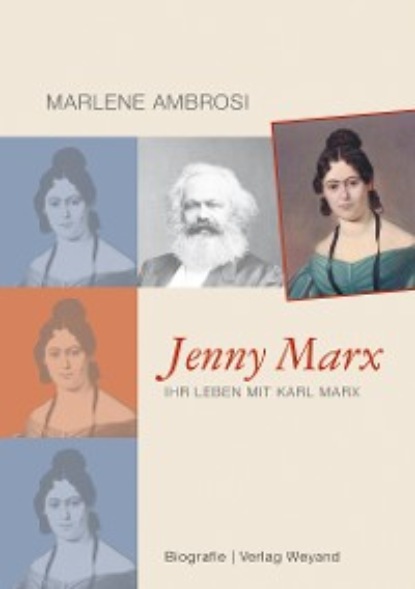- -
- 100%
- +
Die Beziehung Jenny von Westphalens zur Familie Marx änderte sich mit dem Tode Heinrichs. War sie zuvor fast täglich zu Gast in der Simeonstraße gewesen, so ließ sie sich kaum noch blicken. Karls Mutter, die in kürzester Zeit zwei schwere Schicksalsschläge überstehen musste, zeigte sich noch zwei Jahre später sehr verletzt. Niemand aus dem Westphalschen Hause habe ihr Trost gespendet, sondern man habe sich verhalten, als ob man sich nicht kenne. Jede Familie habe ihre Besonderheiten, schrieb Henriette ihrem Sohn, und die der Familie von Westphalen sei die Exaltiertheit, „kein juste milieu findet da nicht stat – entweder wird man in die himmlischen sfären versetzt oder man muss sich mit dem abgrund begnügen…“29 Karl Marx hätte das Verbindungsglied sein können, aber er war in Berlin und entfremdete sich seiner Familie zusehends und Jenny zeigte durch ihren Rückzug ihr Desinteresse nur allzu deutlich.
Zu Hause bemühte man sich, der Braut das Warten zu erleichtern. Jenny begleitete den kranken Bruder Carl in Kurbäder, im Juni 1838 nach Niederbronn im Elsaß und Mitte Juli nach Kreuznach. „Jenny wird ja nur um des Vergnügens willen die Reise mitmachen, verstehe das, wer mag – besonders nach dem betrübenden Tode des Vaters des C. Marx!“30, ereiferte sich Bruder Ferdinand bei seiner Frau, um doch noch eine positive Funktion zu erkennen, nämlich dass „Carl dann eine Pflegerin bei sich hat, die ihm in schlimmen Fällen beistehen kann.“31 Jenny schrieb den Eltern aus Niederbronn: „Seit gestern im Besitz Deines lieben, lieben Briefes, mein teures Mütterchen, für den ich Dir aus der Fülle meines Herzens den wärmsten Dank sage, eile ich gleich heute in aller Frühe zum Schreibtisch, um Euch, Ihr Lieben, einmal wieder vollständigeren Rapport über unser Leben und Treiben abzustatten.“32 Die ehrerbietigen Floskeln wechselten sich mit weltfraulichem Gehabe ab: „Doch müßt ihr nicht glauben, daß es hier gar keine geistigen Genüsse gäbe, daß man ein bloß materielles Leben führe. Wir haben Bücher die Hülle und Fülle, französische…, deutsche…, und was mehr wert ist, – höchst interessante, liebenswürdige Menschen zu unserm täglichen Umgang. Besonders intim bin ich mit der Frau eines Predigers, die jeden Nachmittag zu mir in den Kursaal kommt. Ihr Mann hat kürzlich angefangen, den Jean Paul zu übersetzen. Es ist überhaupt merkwürdig, wieviel man sich hier und in Frankreich mit deutscher Literatur beschäftigt, wieviel Deutsches hier in dem Volk noch überall durchblickt. Denkt Euch, in Straßburg wird in den meisten Kirchen deutsch und nur ausnahmsweise französisch gepredigt. Im Elsaß wird nur deutsch in den untern Volksklassen gesprochen …“33 Fräulein von Westphalen fühlte sich wohl, angemessen akzeptiert und konnte ihre Kenntnisse über eine andere Grenzregion erweitern. Aber, wo immer sie war, Karl fehlte. „Daß er hinter mir liegt, der Ort des Jammers, das alte Pfaffennest, mit seiner Miniatur-Menschheit, sagt Dir die überschrift dieses Blättchens; es soll Dir nun weiter erzählen von unsrer Reise ins Land der Vogesen, meinem innern und äußern Leben in der kleinen, freundlichen Baderesidenz, vorher aber mußt Du stille sein und lauschen, Du teurer Liebling, lausche den trauten Liebesgrüßen, die es Dir bringt, den süßen, zarten Worten der Liebe, die es Dir zulispelt. Teurer Karl, könntest Du jetzt bei mir sein, dürft’ ich an Deinem Herzen ruhen, mit Dir vereint hinausschauen ins heitre, freundliche Tal, die anmutigen Wiesengründe, die Berge mit ihren waldigen Höhen! Doch ach, Du weilst so fern, so fern, so unerreichbar; vergebens sucht Dich mein Auge, vergebens breiten sich meine Arme nach Dir aus, vergebens rufe ich sie Dir zu, alle die süßen Namen der zärtlichsten Liebe; den stummen Zeugen Deiner Liebe muß ich sie aufdrücken, alle die heißen Küsse …“34, schrieb Jenny am 24. Juni 1838 an Karl voller Sehnsucht. All ihr Denken und Sehnen galt nur dem Verlobten im so fernen Berlin. Wann würde ihr größter Wunsch erfüllt und sie seine Ehefrau werden? Die Entscheidung lag beim Manne. Nach drei Studienjahren war der Zeitpunkt für einen Abschluss mit Doktordiplom noch zu früh, und dies bedeutete warten, warten, warten und jedem Brief entgegenzufiebern.
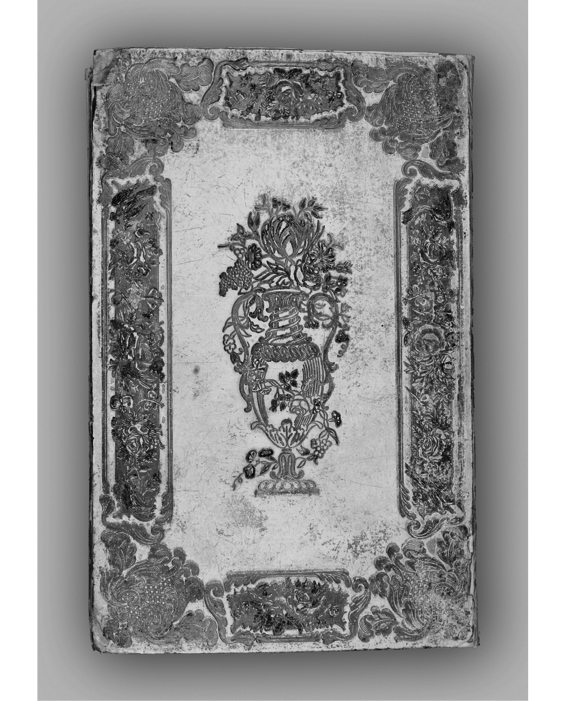
Handschriftliche Volksliedersammlung von Karl Marx für Jenny von Westphalen von 1839
Karl wusste um ihre Sehnsucht und stellte für Jenny im Winter 1838/39 eine Volksliedersammlung zusammen, insgesamt 80 Lieder in allen deutschen Mundarten, in Spanisch, Griechisch, Lettisch, „gebunden in einem Oktavband von 164 Seiten in einem Rokokoeinband, gelblich-weiß mit goldfarbenem Muster, grünen Girlanden und roten Rosen; in der Mitte eine Vase mit Trauben und Blumen.“ 35 Die Braut sang die Lieder sicherlich mit Leidenschaft und überlegte, welche Liebesbotschaft sie enthielten und war beseelt über die Liebesbeweise. Ein Jahr verging.
Um die Jahreswende 1839/40, Karl war zur großen Enttäuschung über die Festtage wieder in Berlin geblieben, manövrierte sich das Paar in eine neuerliche Krise. Jenny war angeblich mit einem anderen Mann gesehen worden, der Verlobte hatte darauf mit heftigsten Vorwürfen reagiert und Briefe von Jenny hatten die Missstimmung noch gesteigert. Die Braut hielt die Ungewissheit nicht lange aus und griff zur Feder, um dem genauso unglücklichen Karl ihre Befindlichkeit zu vermitteln.

Ölbild von Jenny von Westphalen im Alter von 25Jahren (1839)
„Liebes, einziges Liebchen!
Ich war so aufgeregt als ich zuletzt schrieb, und in solchen Augenblicken sehe ich dann alles noch viel schwarzer und schrecklicher als es wirklich.
Verzeih mein einziges Liebchen, daß ich Dich so ängstigen konnte, aber ich war vernichtet durch Deinen Zweifel an meiner Liebe und Treue. Sag Karl wie konntest Du das … niederschreiben, einen Verdacht äußern blos weil ich etwas länger als gewöhnlich geschwiegen … Ach Karl wie wenig kennst Du mich, wie wenig siehst Du meine Lage, und wie wenig fühlst Du, worin mein Gram besteht, an welcher Stelle mein Herz blutet. Die Liebe des Mädchens ist anders als die des Mannes, sie muß auch anders sein. Das Mädchen kann freilich dem Manne nichts anderes geben als Liebe und sich und ihre Person so wie sie ist, ganz ungetheilt und ewig. In gewöhnlichen Verhältnissen muß auch das Mädchen ihre volle Befriedigung in der Liebe des Mannes finden, sie muß alles andre in der Liebe vergessen“ 36, schrieb sie noch ganz aufgelöst. Konnte eine fortschrittliche Frau und für eine solche hielt sie sich doch, die Frau nur auf das Gefühl Liebe und körperliche Hingabe reduzieren? Jenny schien internalisiert zu haben, dass die Erfüllung der Frau durch den Mann erfolgte, – trotz ihrer Betonung der „gewöhnlichen Verhältnisse“. Ihr spezielles Problem war ihre Ungewissheit hinsichtlich Karls wahrer Gefühle und folglich beklagte sie: „Du achtest mich nicht, Du vertraust mir nicht, und daß ich Deine jetzige schwärmerische Jugendliebe nicht zu erhalten im Stande bin, hab’ ich ja von Anfang gewußt, tief empfunden, noch ehe man mir das so kalt und klug und vernünftig auseinandergesetzt hat.“ 37 Was hatte Karl nur geschrieben, dass sie wieder an allem zweifeln musste? Er sollte doch wissen, dass sie anders war als alle anderen Mädchen. Jedenfalls meinte sie: „Ach Karl, darin liegt eben mein Jammer daß das, was ein jedes andre Mädchen mit namenlosen Entzücken erfüllen würde Deine schöne rührende leidenschaftliche Liebe, die unbeschreiblich schönen Aeußerungen darüber, die begeisternden Gebilde Deiner Phantasie, daß dies alles mich nur ängstigen und oft zur Verzweiflung bringt.“ 38 Jenny von Westphalen konnte den Augenblick nicht genießen und im Moment des Glückes musste sie sogleich an dessen Vergänglichkeit denken, trotz aller Liebesschwüre. Seit Jahren wartete sie auf den Geliebten, und sie hatte keine Möglichkeit, die Angelegenheit „Hochzeit“ eigenständig voranzutreiben. Sie konnte nicht aktiv handeln und so wurde ihr die Zeit immer länger. Es blieb nur der Appell an den Verlobten: „Bedenk nur immer, dass Du daheim ein Liebchen hast, das da hofft und jammert und ganz abhängig von Deinem Schicksal ist.“ 39 Unentwegt dachte sie über sich und Karl nach und so mancher trübe, zweiflerische Gedanke nistete sich in ihrem Kopf ein. Zu Karl: „Je mehr ich mich der Seligkeit hingeben würde, desto fürchterlicher würde mein Schicksal sein, wenn Deine feurige Liebe aufhören, Du kalt und zurückhaltend werden solltest. Sieh Karl die Sorge um die Fortdauer Deiner Liebe raubt mir allen Genuß, ich kann mich Deiner Liebe nicht so ganz freuen, weil ich mich ihrer nicht mehr versichert glaube, es konnte nichts schrecklicheres für mich kommen als das. Sieh Karl deshalb bin ich nicht ganz so dankbar, ganz so beseligt über Deine Liebe, wie sie es wirklich verdiente, deshalb erinnre ich Dich öfter an äußre Dinge, an das Leben an die Wirklichkeit, statt wie Du es verstehest, mich ganz an der Welt der Liebe an dem Aufgehen in ihr und einem höheren theueren geistigen Eins Seiens mit Dir festzuhalten und alles andre in ihr zu vergessen, Trost und Seligkeit allein in ihr zu finden. Karl könntest Du den Jammer doch fühlen, Du würdest milder gegen mich sein und nicht überall gräßliche Prosa und Gewöhnlichkeit sehen, nicht überall Mangel an wahrer Liebe und Gefühlstiefe erblicken. Ach Karl könnt ich in deiner Liebe sicher ruhn, mein Kopf würde nicht so brennen, mein Herz nicht so stechen und bluten. Könnt ich an Deinem Herzen ewig sicher ruhen, Karl bei Gott meine Seele dachte nicht ans Leben und die kalte Prosa. Aber Engelchen Du achtest mich nicht, vertraust mir nicht und Deine Liebe für die ich alles hingäbe, kann ich nicht frisch und jung erhalten. … Ich fühle so ganz wie recht Du in allem hast, aber denk Dir auch meine Lage, meinen Hang zu trüben Gedanken, denk Dir das alles einmal recht wie es ist und Du wirst nicht mehr so hart gegen mich sein. Könntest Du doch nur ein Bischen mal ein Mädchen sein und dazu noch so ein sonderbares wie ich.“ 40 Mädchen – Seligkeit – hingeben, diese Worte lassen auf einen inneren Konflikt schließen – oder auf Ansprüche Karls. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die junge Frau dem Verlobten wohl den Beischlaf verweigert, trotz aller Versuchungen bei seinen seltenen Besuchen; zu oft hatte sie von Mädchen gehört, die den Verführungen erlegen und dann von dem Manne, nachdem er sein Vergnügen gehabt hatte, als gefallenes, unmoralisches Mädchen geschmäht und in die Verzweiflung gestoßen wurden. Ein Opfer dieser Doppelmoral wollte Jenny von Westphalen nicht werden.
Beim Niederschreiben all´ ihres Kummers wurde ihr leichter ums Herz und sie milderte ihre Vorhaltungen und Zweifel ab: „Doch Karlchen ich muß doch noch einmal ein Bischen ernst mit Dir reden, sag wie konntest du an meiner Treue zweifeln? Ach Karl Di ch durch einen andern verdunkeln zu lassen, nicht als ob ich andrer Leute gute vorzügliche Eigenschaften verkannte und Dich für unübertrefflich hielte, aber Karl ich liebe Dich ja so unaussprechlich und sollte an einem andern nur irgend etwas liebenswerth finden. Ach Karlchen ich habe nie gegen Dich gefehlt nie nie und dennoch vertraust Du mir nicht …“ 41 Kein Liebesgeständnis ohne Einschränkung. Jenny gab zu, sich gerne mit Fremden zu unterhalten und bei diesen nicht zu verstummen. Bei ihm, dem so innig Geliebten hingegen „weiß ich vor Angst kein Wort, da stockt mir das Blut in den Adern und meine Seele bebt.“ 42 Das war übertrieben, denn mit ihrem Karl konnte sie stundenlang turteln, reden, lachen – und dennoch war die Ambivalenz ihrer Gefühle erstaunlich.
Karl Marx trieb Jenny zu einem Zeitpunkt an den Rand der Belastbarkeit, als sie seinen Beistand dringend gebraucht hätte. Bei Westphalens herrschte niedergedrückte Stimmung, wie man am 9. März 1840 in der „Trier’schen Zeitung“ lesen konnte:
„Heute den 8. März 1840 um halb 7 Uhr Morgens, verschied zum bessern himmlischen Leben unser geliebter Sohn und Bruder
Carl Hans Werner von Westphalen
Königlicher Landgerichtsrath hierselbst.
Im noch nicht vollendeten 37. Jahre, nach mehrwöchentlichen Leiden am Nervenfieber. Voll Edelmuth und Selbstaufopferung, von Wahrheitssinn und Gerechtigkeit durchdrungen, war er im Leben unser Stolz, der Menschen liebevoller Freund, der Armen Helfer, und in seinem amtlichen Beruf voll Pflichtgefühl und Milde.
Mit tiefbetrübtem Herzen zeigen wir seinen unersetzlichen Verlust … an.“ 43
Binnen weniger Monate verlor Jenny nach Heinrich Marx einen weiteren Freund, der durch seine ruhige, ausgleichende Art ihr Halt gegeben hatte. Die Geschwister hatten viel miteinander unternommen und bis auf wenige Jahre war der große Bruder immer an ihrer Seite gewesen und hatte sie beschützt. Ob er Jennys Entscheidung für Karl Marx gut befand, ist nicht belegt, aber er wird sie nicht verurteilt haben, denn er kannte den Verlobten sehr gut. Jetzt fühlte sich Jenny in Trier noch einsamer und wünschte sich noch sehnlicher eine Veränderung ihrer Lebensverhältnisse und dies wusste Karl und schuf eine wichtige Voraussetzung für eine gemeinsame Zukunft.
In Berlin gehörte Marx dem „Doktorklub“ der Junghegelianer an, die in den von Arnold Ruge gegründeten „Halleschen Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst“ ihre Ideen verbreiteten. Ihre Religionskritik führte zu einer radikalen Gesellschaftskritik, die in einer Forderung nach Abschaffung des Staates gipfelte. Diese verbale Aufmüpfigkeit wurde durch den liberalen preußischen Kultusminister von Altenstein noch geduldet, aber 1840 änderte sich die Lage. Friedrich Wilhelm IV., seit Juni König von Preußen, hatte nicht den erhofften liberalen Kurs eingeschlagen und duldete keine Äußerungen wie ‚Gott existiere nicht‘´ und demnach könne der Monarch auch nicht von Gott eingesetzt sein und daher sei der in diesem Staat lebende Mensch dem Monarchen nicht untertan. Derartige subversive Ideen durften nicht publiziert und ihre Verkünder auf keinen Fall an den Universitäten tätig sein. über radikale Denker wie die Junghegelianer wurde ein Berufsverbot verhängt. Für Karl Marx war demzufolge die Chance vertan, in Berlin Dozent zu werden. Bruno Bauer, inzwischen Privatdozent in Bonn, überredete ihn mit Nachdruck zum Abschließen seiner Promotion, um ihm mit dieser Qualifikation an der Bonner Universität eine Assistenzstelle mit Aussicht auf eine Habilitation zu verschaffen. Bauer kannte Marx vom Doktorenclub in Berlin und war über seine Verlobte bestens informiert. Obwohl beide sich noch nicht persönlich kannten, prognostizierte er bei Marx weitblickend: „Deine Braut ist fähig, alles mit Dir zu ertragen, und wer weiß, was noch kommen wird.“ 44
Nach der üblichen vierjährigen Studienzeit, die er trotz Krankheit nicht verlängert hatte, exmatrikulierte sich Karl Marx in Berlin und reichte am 6. April 1841 seine Promotion in absentia an der Universität in Jena ein, die dafür bekannt war, dass man an ihr schnell und problemlos den Doktortitel erlangen konnte. Dekan Bachmann von der philosophischen Fakultät urteilte über „Die Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie“: „Das Specimen zeugt von ebenso viel Geist und Scharfsinn als Belesenheit, weshalb ich den Kandidaten für vorzüglich würdig halte.“ 45 Der Gutachter hatte trotz des Schnellverfahrens die Fähigkeiten des Verfassers erkannt, vorausgesetzt, es handelte sich nicht um ein vorgefertigtes Statement. Karl Marx erhielt in Berlin das am 18. April 1841 in Jena ausgestellte Doktordiplom. Jenny war glücklich über „ihren Herrn Doktor“, und ihr Vater freute sich über Karls Widmung: „Seinem teuern väterlichen Freunde, dem geheimen Regierungsrathe Herrn Ludwig von Westphalen zu Trier, widmet diese Zeilen als ein Zeichen kindlicher Liebe der Verfasser“ 46 und über Karls Dank: „Sie, mein väterlicher Freund, waren mir stets ein lebendiges argumentum ad oculos, dass der Idealismus keine Einbildung, sondern eine Wahrheit ist.“ 47
Die Verlobte glaubte, die Zeit des Wartens nähere sich dem Ende. Die Hoffnung trog. Für Jenny bedeutete dies, weiterhin auf Karl zu warten und ihre Gefühle ihm schriftlich mitzuteilen: „Was Du aber ein liebes süßes, einziges Herzens Liebchen bist! Und wie Deine Briefe mich beseligen, erheben, mit stillem Jubel erfüllen!“ 48 Um die quälende Wartezeit zu überbrücken, bildete sie sich weiter, lernte Griechisch und monierte, als ihre Anstrengungen nicht gebührend gewürdigt wurden: „Aber bei all dem vermiß’ ich doch eins: Du hättest mich wohl ein bißchen loben können wegen meines Griechischen und meiner Gelehrsamkeit einen kleinen lobenden Artikel widmen können; so seid ihr aber mal, Ihr Herrn Hegelinge – nichts erkennt ihr an, und wenn es das Allervortrefflichste wäre, wenns nicht grade in Eurem Sinne ist.“ 49 Kritische Worte, die sie anderen verübelt hätte; doch ihre Liebe relativierte jede Kritik. Zu Karl: „Schwarzwildchen wie freu ich mich, daß Du froh bist und daß mein Brief Dich erheitert, und daß Du Dich nach mir sehnst, und daß Du in tapezirten Zimmern wohnst und daß Du in Cöln Champagner getrunken hast und daß es Hegelklubbs giebt und daß Du geträumt hast und daß Du, kurz daß Du mein, mein Liebchen, mein Schwarzwildchen bist.“ 50 Trotz allen Getändels trieb sie die Frage um: „Gelt ich kann Dich doch heirathen?“ Karl beruhigte sie, aber einen konkreten Termin konnte er nicht nennen. Schritt für Schritt, lautete seine Devise. Er hatte Berlin im Mai verlassen, um sich an der Universität Bonn zu habilitieren – ein höchst erfreulicher Schritt für Jenny. Endlich war der Geliebte näher bei ihr. Sechs Wochen verbrachte er im Sommer 1841 in Trier bei der Mutter und drei Monate im Winter 41/42. Wo er unterkam, ist nicht belegt, möglicherweise bei den Eltern der Braut.
Jenny spürte seinen Rückhalt und forderte bei den Eltern mehr Freiheit und Selbstbestimmung ein, mit Erfolg. Die Siebenundzwanzigjährige erhielt die Erlaubnis, ihren Verlobten treffen zu dürfen, und Ende August 1841 konnte ihn Jenny auf einer Reise nach Neuss zu Freunden in Köln in die Arme schließen, unter Aufsicht. Im „Verzeichnis der gestern angekommenen Fremden“, abgedruckt im „Kölnischen Anzeiger“, war neben Frl. v. Westphalen und Marx, Dr. auch ein Herr v. Westphalen, Referen(dar) a(us) Trier vermerkt. Die Eltern waren besorgt und Jenny musste sich bei dem Geliebten über die Mutter ereifern, die sie ermahnt hatte, „nur äußern und innern Abstand zu beachten, weil ich Dich sonst in Bonn nicht besuchen könnte. Ach, Herzchen, wie mir da alles zentnerschwer auf die Seele fiel! äußerer und innerer Anstand!! – ach, mein Karl, mein süßer einziger Karl!“ 51 Die elterlichen Ermahnungen wurden nicht beachtet, Jenny und Karl schritten zur Tat. Sie verbrachten Stunden der Liebe oder einige Liebesnächte zusammen, endlich ungestört. Jenny befand sich in einem wahren Liebesrausch und stammelte eingedenk des höchsten Glücksgefühls einige Tage später in ihrem Brief aus Neuss: „Und dennoch Karl ich kann, ich fühle keine Reue, halte ich mir die Augen fest, fest zu und Seh ich dann Dein selig lächelndes Auge – sieh, Karl dann bin ich selbst in diesem Gedanken selig – Dir alles gewesen zu sein – andern nichts mehr zu sein. Ach Karl ich weiß sehr gut was ich gethan und wie ich vor der Welt geächtet wäre, ich weiß das Alles, alles und dennoch bin ich froh und selig und gäb selbst die Erinnerung an jene Stunden um keinen Schatz der Welt dahin. Das ist mein Liebstes und soll es ewig bleiben.“ 52 Von nun an ergriff die sexuelle Leidenschaft die junge Frau mit aller Macht und zog sie zu dem Manne hin, den sie „unaussprechlich, grenzen-, zeit- und maßlos liebt(e)“. Noch war sie nicht am Ziel, ein Horror. Ihr graute: „Nur wenn ich denke noch so lange von Dir getrennt leben zu müssen, so ganz wieder umringt von Jammer und Elend, dann beb ich zusammen. … Jede selige Stunde durchlebt’ ich noch einmal, noch einmal lag ich an Deinem Herzen, liebeberauscht und selig! Und wie Du mich anlächeltest und froh warst. Karl, Karl, wie lieb ich Dich! … Lieber süßer Engel denkst Du denn noch oft an all die Seligkeit, ach, mein lieb, lieb Herzchen wie war ich so glücklich, so überselig! Karl Dein Weib zu sein, welch ein Gedanke – vielleicht, o Gott mir schwindelt dabei!“ 53 Das „Vielleicht“ verdrängend, beschwor sie ihren Karl umso entschiedener: „Gelt ich bin aber schon ein bischen viel Dein Fräuchen? Karlchen sag werd’s ich noch ganz. Ach, wenn ich an Trier denke, schaudre ich zusammen – meine Eltern wohnen da, meine alten Eltern, die Dich so lieben, ach Karl ich bin recht schlecht und nichts ist mehr gut an mir als meine Liebe zu Dir – die aber ist über alles groß und ewig.“ 54 Jenny von Westphalen betrachtete sich von nun an als Karls Frau, moralische Bedenken, dass ein sittsames Mädchen jungfräulich in die Ehe gehen sollte, bedeuteten nichts gegen die Liebe. Und doch stürzten ihre Gedanken für ein paar Sekunden jäh aus der Glückseligkeit in tiefste Resignation: „Karlchen wenn Du mich jetzt vergäßest – nein nein das kannst Du nicht – kannst es nie. Das Ende Deiner Liebe und das Ende meines Daseins fallen in einen Moment zusammen.“ 55 Diese Worte waren keine Drohung, kein Erpressungsversuch, eher eine Liebeserklärung, und doch offenbarten sie innere Unsicherheit. Jenny liebte Karl Marx und wusste, dass ihre Gefühle erwidert wurden, aber eine dunkle Ahnung konnte sie nicht unterdrücken.
Nach den Tagen der Leidenschaft verging die Zeit noch langsamer für die reife Braut. Eine willkommene Abwechslung war die Taufe von Louise und Ferdinands drittem Kind. Nach Stammhalter Ferdinand (1836 – 1906) und Louise Caroline Wilhelmine Franziska (1839 – 1928) war Anna Elisabeth Charlotte Jenny von Westphalen am 22. September 1841 in Trier zur Welt gekommen. Jenny wurde als Namensgeberin zugleich Patin, zusammen mit Wilhelm Chassot von Florencourt, dem Bruder Louises. Jenny durfte das Baby in den Armen halten, als es am 8. November um 9 Uhr getauft wurde. Sie genoss das Gefühl, ein Kind in den Armen zu wiegen, und wünschte sich vielleicht, es wäre ihr eigenes Kind. Lange konnte sich Jenny nicht um ihr Patenkind kümmern, Klein-Jenny starb noch im Kindesalter.
Es war das letzte heitere Familienfest, das nächste Zusammentreffen hatte einen traurigen Anlass. Am 3. März 1842 starb Vater Ludwig im Alter von 71 Jahren abends um 6 Uhr nach monatelangem Leiden an Entkräftung. Auch wenn man mit seinem Ableben hatte rechnen müssen, die Trauer war groß. „Die Hinterbliebenen des Verblichenen“, offiziell vertreten durch die Söhne Ferdinand und Edgar, ließen die Bürger Triers wissen: „Die irdische Hülle des theuern Entschlafenen wird am Sonntag den 6. dieses Monats; Nachmittags 3 Uhr; zur Erde bestattet werden; seine Freunde und Bekannte, die Mitbürger Triers, die ihm so theuer geworden waren und die ihn auf dem letzten Gange zu begleiten wünschen, wollen sich zu jener Stunde im Sterbehause einfinden.“ 56 Wie viele kamen, wissen wir nicht, aber einer stand Jenny treu zur Seite, und das war das Wichtigste. Karl Marx hatte mit ihr am Totenbett geweilt, und es war bei der Beerdigung des Vaters tröstlich, den Geliebten um sich zu haben, der sie in den Arm nahm und an dessen Brust sie sich ausweinen durfte. Alle konnten sich vergewissern, dass dieser Mann fest zu ihr stand. Nichts konnte sie trennen, signalisierte die Baronesse ihrem Umfeld. Um seiner Braut beizustehen, verbrachte Marx im Sommer 1842 wieder mehrere Wochen in Trier und laut Fremdenliste der „Trier’schen Zeitung“ logierte er im Gasthof „Venedig“ in der Brückenstraße, nicht bei seiner Mutter. In Begleitung seiner schönen Braut feierte er im Juli mit seiner Familie die Hochzeit von Schwester Sophie, Jennys Kinderfreundin, mit dem Advokaten-Anwalt Robert Schmalhausen.
Nach dem Tode des Vaters wurde die Situation im Hause Westphalen schwieriger. Die Witwe erhielt ein Drittel oder vier Zehntel der Pension ihres Mannes, eine drastische Einbuße. Jenny und Edgar mussten finanziert werden, und um zu sparen, zog die Mutter mit Tochter und Schwester Ende März aus der großen Wohnung in der Brückergasse 625b in eine kleinere Wohnung in der Brückergasse Nr. 602. Wann die Familie in die Brückergasse 625b gezogen war, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Nur drei Monate später, am 12. Juni, starb ihre 67jährige Schwester Christiane Sophie, deren Ableben von Edgar von Westphalen und Dr. Marx angezeigt wurde. Ihr Tod war vielleicht der letzte Anstoß für eine übersiedlung nach Kreuznach.
Der Ortswechsel war mit einigen Beschwernissen verbunden. „Die verwittwete Geh.-Reg.-Räthin von Westphalen sucht bei ihrer Wohnungsverlegung nach Kreuznach eine stille Familie an die Stelle ihres bis zum 1. April k.J. fortlaufenden Mietvertrags“ 57, inserierte die Mutter am 14. Juli 1842, und in einer zweiten Annonce am 23. September gab sie bekannt: „Mit Wehmuth scheide ich aus dieser Stadt, in welcher mein unvergesslicher Mann und ich uns von den Theuern Einwohnern so vieler Güte und Wohlwollens zu erfreuen hatten. Haben Sie Dank, dass Sie eine lange Reihe von Jahren uns so viele Beweise Ihrer uneigennützigen Freundschaft gaben und erhalten Sie auch in der Ferne meinen Kindern und mir eine freundliche Erinnerung.“ 58