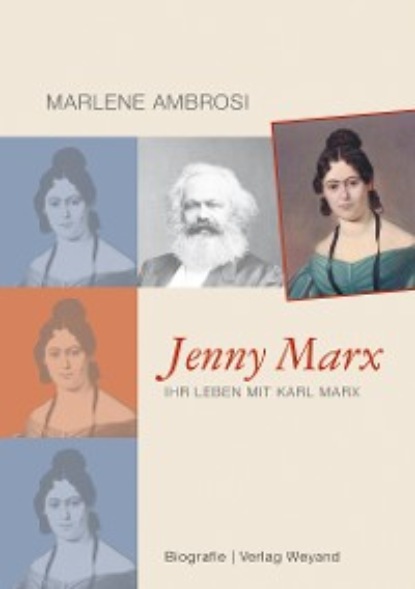- -
- 100%
- +
Kreuznach, den 19. Juni 1843.“24
Jetzt waren alle, auch die letzten Zweifler, darüber informiert, dass Fräulein von Westphalen Frau Marx geworden war; ein Schritt, den nur aufgeklärte Geister gut heißen konnten. Heute hätte sich Jenny vielleicht Frau von Westphalen-Marx und Karl vielleicht Herr von Westphalen genannt.
Was sich die Frischgetrauten zur Vermählung schenkten, ist nicht bekannt, aber die Geschenke der Mutter. 20 Jahre später erwähnte Jenny bei Bertha Markheim: „Der Herzog von Argyle ist ein naher Verwandter meiner Vorfahren, und als ich mich verheiratete, gab mir mein Herzens-Mütterchen viel prachtvolles Silberzeug mit, das von Schottland stammte und das Argylesche Wappen auf sich hatte“25 – traditionelle Gaben der Mutter an die Tochter am Tage der Vermählung. über das Schicksal dieser Kostbarkeiten meinte sie zu Frau Markheim lapidar: „Silber und Wappen sind natürlich längst bei all´ den Ausweisungen, Wanderungen und Emigrationen ‚from the blue bed to the brown’´ flöten gegangen, und das bischen, was ich aus dem Schiffbruch gerettet, schwankt auch stets zwischen Tod und Leben und ist meistens in den Händen des ‚Onkels‘.“26
Nach der zivilen und kirchlichen Zeremonie ging das junge Ehepaar auf Hochzeitsreise. Jenny in ihren Erinnerungen: „Wir reisten von Kreuznach über die Ebernburg nach der Rheinpfalz und kehrten über Baden-Baden nach Kreuznach zurück.“27 Verliebt genossen Jenny und Karl die bezaubernde Landschaft, stiegen in schönen Herbergen ab und freuten sich über das ungestörte Zusammensein bei Tag und Nacht. Frau Jenny Marx war nach sieben langen Jahren restlos glücklich und entspannt. Die Momente nervöser Anspannung gehörten der Vergangenheit an, die Ruhe und Gelassenheit ihres Mannes übertrugen sich auch auf sie. Die Flitterwochen finanzierte entweder Marx, der für seine Beiträge in den „Deutschen Jahrbüchern“ mit 500 Talern entlohnt worden sein soll, oder Jenny mit einer kleinen Erbschaft des im Mai verstorbenen Verwandten Friedrich Perthes.
Jennys Glück war vollkommen, als sie Gewissheit hatte, dass das erste Kind unterwegs war. Sie war froh, in ihrem Alter noch so problemlos schwanger geworden zu sein. Nach ihrer Berechnung würde das Kind im April oder Mai des folgenden Jahres auf die Welt kommen, wo, das wusste sie noch nicht. Sie genoss die Zeit, ließ sich von ihrem Ehemann und der Mutter verwöhnen. Die junge Ehefrau las philosophische Werke und zeigte sich „sehr eingeweiht in die neue Philosophie“, wie Arnold Ruge anerkannte. Auch der Mann war emsig am Lesen und Exzerpieren und soll 20.000 Seiten für die „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ durchgelesen haben. Er hatte sich zur Mitarbeit entschieden, obwohl inzwischen klar war, dass das Projekt „beide Nationen geistig durch ein eigenes Organ zu befreunden“ in deutschen Landen nicht realisiert werden konnte. Man visierte das grenznahe Straßburg an, entschied sich dann aber kurzfristig für Paris, das für Marx „die alte Hochschule der Philosophie … und die neue Hauptstadt der neuen Welt“28 war. Mit Zustimmung seiner frisch Angetrauten verpflichtete sich Marx im Oktober 1843 in der französischen Metropole zu sein. Jenny wäre zwar lieber bis zur Geburt des ersten Kindes in der Nähe der Mutter geblieben, aber das hätte eine Trennung von Karl bedeutet. Die Jungvermählten blieben bis Oktober in Kreuznach, bevor sie in ihr neues Leben aufbrachen, und auch die Mutter kehrte nach Trier zurück und bezog in vertrauter Umgebung in der Brückergasse Nr. 625B eine Wohnung.
In der Familie Westphalen und bei den adligen Anverwandten Florencourt, Veltheim, Krosigk, Asseburg und Röder war ein heiß diskutiertes Thema, was die Ex-Baronesse an der Seite dieses unberechenbaren Mannes erwarten würde. Franziska, die frömmelnde, unverheiratete Schwester in Berlin, meinte zu dem inzwischen nach Liegnitz versetzten Vize-Regierungspräsidenten Ferdinand: „Sie erscheinen mir unendlich beklagenswerth …, der Dr. Marx u. Jenny in ihrer Verblendung u. Abhängigkeit von Grundsätzen, … u. in Folge davon sie, fürchte ich, heimathlos wie Flüchtlinge von Ort zu Ort, von Land zu Land zu ziehen genöthigt sein werden.“29 Franziska ahnte nicht, wie prophetisch ihre Prognose war; zutreffend war auch ihre Befürchtung, die sich für sie aus einem nicht mehr erhaltenen Brief ergab: „welchem Geschäft er sich dort zu widmen beabsichtigt, schreibt sie mir nicht … Wenn nur nicht wieder das Unternehmen einen abenteuerlichen Grund hat …“30 Die Verbindung hätte im Familienkreis akzeptiert werden können, wenn Dr. Marx wenigstens eine Beamtenstelle in der preußischen Verwaltung angestrebt hätte. Aber Karl Marx ging konsequent einen anderen Weg und an seiner Seite, unbeeindruckt von dem Gerede der in ihren Augen bigotten Verwandtschaft, die junge Ehefrau.
Jenny Marx hat, wie Engels später an ihrem Grabe sagte, von diesem Zeitpunkt an „die Schicksale, die Arbeiten, die Kämpfe ihres Mannes nicht bloß geteilt, sie hat daran mit dem höchsten Verständnis und mit der glühendsten Leidenschaft größten Anteil genommen.“31
1 Elsner, Karl Marx in Kreuznach 1842/43, S.118
2 Krosigk, Jenny Marx, S.41
3 Elsner, Karl Marx in Kreuznach 1842/43, S.114
4 Schöncke, Karl und Heinrich Marx und ihre Geschwister, S.309
5 MEGA III,1 Jenny von Westphalen an Karl Marx Anfang März 1843
6 MEGA III,1 Jenny von Westphalen an Karl Marx Anfang März 1843
7 MEGA III,1 Jenny von Westphalen an Karl Marx Anfang März 1843
8 MEGA III,1 Jenny von Westphalen an Karl Marx Anfang März 1843
9 MEGA III,1 Jenny von Westphalen an Karl Marx Anfang März 1843
10 MEGA III,1 Jenny von Westphalen an Karl Marx Anfang März 1843
11 MEGA III,1 Jenny von Westphalen an Karl Marx Anfang März 1843
12 Friedenthal, Karl Marx, S.173
13 Krosigk, Jenny Marx, S.43
14 MEGA III,1 Karl Marx an Arnold Ruge am 25.1.1843
15 MEGA III,1 Karl Marx an Arnold Ruge am 25.1.1843
16 MEGA III,1 Karl Marx an Arnold Ruge am 13.3.1843
17 MEGA III,1 Karl Marx an Arnold Ruge am 13.3.1843
18 Elsner, Karl Marx in Kreuznach 1842/43, S.117
19 MEGA III, 1 Jenny von Westphalen an Karl Marx im März 1843
20 Raddatz, Karl Marx, S.57
21 Schöncke, Karl und Heinrich Marx und ihre Geschwister, S.846
22 Rudolf Stumpf schreibt in der homepage „Mein Gästebuch“ am 15. Mai 2004: „Ich selbst habe das Kirchenregister der Wilhelmskirche noch eingesehen, als diese Kirche noch stand. Dort war auch die Hochzeit vermerkt.“
23 Schöncke, Karl und Heinrich Marx und ihre Geschwister, S.846
24 Schöncke, Karl und Heinrich Marx und ihre Geschwister, S.847
25 MEW Bd. 30 Jenny Marx an Bertha Markheim 1863
26 MEW Bd. 30 Jenny Marx an Bertha Markheim 1863
27 Schack, Jenny Marx, S.25
28 Elsner, Karl Marx in Kreuznach 1842/43, S.118
29 Gemkow, Edgar von Westphalen, S.426
30 Gemkow, Edgar von Westphalen, S.426
31 Schack, Jenny Marx, S.229ff.
TEIL III – WANDERJAHRE
Paris – voller Hoffnung in die Zukunft
Herbst 1843 bis Frühjahr 1844
Aus freiem Entschluss verließen Jenny und Karl Marx Mitte Oktober 1843 das preußische Staatsgebiet in Richtung Paris. Die Juli-Revolution im Jahre 1830 hatte zu einer konstitutionellen Monarchie unter dem „Bürgerkönig“ Louis Philippe von Orléans geführt. Hunderttausende Verfolgter aus ganz Europa fanden in Frankreich Aufnahme, so auch Jenny und Karl Marx, die sich zu den 50.000 deutschen Exilanten in der französischen Hauptstadt gesellten.
Sie hatten, wie sich Jenny erinnerte, schnell Kontakte: „Hess und seine Frau, Ewerbeck und Ribbentrop, vor allem Heine und Herwegh bildeten unsren Umgang“1, und später erweiterte sich ihr Bekanntenkreis um „Tolstoi, Bakunin, Annenkow, Bernays und tutti quanti (und wie sie alle heißen). Viel Klatsch à quèrelles allemandes (um des Kaisers Bart).“2 Zu ihrem Umfeld gehörten auch kritische, gut ausgebildete Handwerksburschen, – keine Industriearbeiter. Die Arbeiter in den Fabriken machten Mitte des 19. Jahrhunderts beispielsweise in Köln weniger als 8% der Bevölkerung aus. Karl Marx sprach in diesen Jahren noch nicht für das Proletariat, für das er gemeinhin steht, sondern sein Denken entwickelte sich erst in Richtung Kommunismus. Ungeachtet dessen fühlten sich Frau und Herr Marx ein Leben lang den „gehobenen“ Ständen zugehörig; für sie lagen Welten zwischen den Adligen und Bürgerlichen, die sie verbal so entschieden bekämpften, und der Arbeiterklasse, für die sie verbal so entschieden eintraten. Die zur Bürgerlichen gewordene Frau Marx gab sich aufgeschlossen und war voll ehrlicher Anteilnahme für das harte Schicksal der Unterdrückten, aber sie wahrte Distanz, adlige Distanz. Jenny verstellte sich nicht, sie zeigte sich anderen gegenüber nicht überheblich, aber sie strahlte etwas aus, das die anderen erkennen ließ, dass sie sich nicht auf gleicher Stufe stehend fühlen konnten. Sie machte sich nicht gemein mit „kleinen Leuten“, und diese wussten sehr wohl, dass Frau Marx eine Adlige war, die ihren Stand aufgekündigt hatte, um mit dem Mann zusammenzuleben, den sie liebte. Das bewunderten sie, und sie waren Jenny dankbar für die Freundlichkeit, die sie ihnen zuteil werden ließ, – und manche fühlten sich insgeheim erhöht, wenn sie so ohne Voreingenommenheit begrüßt wurden. Mme. Marx konnte allerdings auch sehr ablehnend sein.
Bis Februar 1844 wohnte das junge Paar in der Rue Saint–Thomas du Louvre, danach mietete es sich kurzzeitig im Hotel „Vanneau“ in der gleichnamigen Straße ein, bevor es am 1. März wohl auf Vermittlung von Ruge in der Rue Vanneau 38, Paris VII., Faubourg St-Germain eine Wohnung bezog. In diesem Haus lebten auch die Ehepaare Ruge und Mäurer. Ob es sich dabei tatsächlich um eine Art Kommune mit Privatsphäre, wie behauptet wurde, handelte, ist nicht belegt. Jedenfalls währte das Miteinander nicht lange. Die kleinen Banalitäten des Alltags ließen trotz Köchin und Haushaltshilfe das Zusammenleben scheitern oder man harmonierte nicht. Das lag nicht nur an den anderen Mitbewohnern, sondern auch an dem geistreichen, aber sehr von sich überzeugten jungen Herrn Doktor und seiner Frau, der Ex-Baronesse. Frau Marx war nicht wie die anderen Ehefrauen, sie war kein biederes Hausmütterchen, sondern eine gleichberechtigte Frau, die für sich die Teilnahme an den politischen Debatten in Anspruch nahm. Sie arbeitete sich in die Themen ein, mit denen ihr Mann sich beschäftigte, und vermutlich äußerte sie mit Verve ihre Meinung. Sie brachte die weibliche Sicht ein, gab pragmatische Hinweise, lieferte Geistesblitze – eine ideale Ergänzung zu ihrem Mann, der problematisierte, theoretisierte und systematisierte. Ihrem Mann gefiel es, wenn seine Frau seine Anliegen mit ihren Argumenten stützte, und sie war stolz, ihren Ehemann in exponierter Position an den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ mitarbeiten und „Die heilige Familie“ und die „Kritik der kritischen Kritik“ entstehen zu sehen. Kurz: Jenny und Karl Marx vermittelten den Eindruck, das ideale Paar, ein Traumpaar, zu sein: jung, gut aussehend, geistreich, verliebt und das erste Kind erwartend.
Jenny und Karl Marx erkannten bald die unterschiedlichen Ansichten und Ziele innerhalb ihres Bekanntenkreises. Für sie blieb es nicht beim Feindbild Preußischer Staat, sondern ihr Kreis der Missliebigen erweiterte sich um Personen, mit denen sie bisher durchaus in freundlicher Verbindung gestanden hatten. Marx entzweite sich zuerst mit Ruge. Nachdem im Januar 1844 das erste Doppelheft der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ mit zwei Artikeln von Karl Marx „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ und „Zur Judenfrage“ erschienen war, kam es nicht mehr zur Herausgabe weiterer Hefte. Dies lag nicht nur an den stärker werdenden Differenzen zwischen Ruge und Marx, sondern auch an der Tatsache, dass kein Franzose an dem länderübergreifenden Projekt mitwirken wollte. Von den französischen Sozialisten wurden die deutschen Emigranten kritisch beäugt und zumeist abgelehnt. Vor allem der rigorose Atheismus schreckte sie ab; Sozialismus und Christentum mussten aus französischer Sicht keine Gegensätze sein, sondern konnten einander durchaus bedingen.
Marx überwarf sich zudem mit Ruge, weil die zugesagten 1.800 frs. Gehalt nicht in bar ausbezahlt wurden, sondern in Form von 1.000 Jahrbüchern. Sie sollen Marx angeblich 2.000 Franc eingebracht haben, obwohl die Verbreitung in Preußen erhebliche Schwierigkeiten mit sich brachte. Die preußischen Behörden befanden, die Schrift „gehört nach Art. XI der Verordnung vom 18. October 1818 zu den gesetzlich verbotenen und die beiden ersten Hefte sind, nach den ... gemachten Mittheilungen, geradezu verbrecherischen Inhalts. Es bedarf daher nicht nur einer geschärften, polizeilichen Aufmerksamkeit, um die Einbringung und Verbreitung dieser Zeitschrift in jeder zulässigen Weise zu verhindern, sondern es erscheint auch angemessen, den Buchhändlern … bekannt zu machen, dass sie sich durch Verbreitung der fraglichen Schrift der Gefahr aussetzten, zur Untersuchung und Bestrafung gezogen zu werden.“3 Ruge und Marx wurde unter Androhung sofortiger Inhaftierung untersagt, preußisches Territorium zu betreten. Dies tangierte Marx nicht existenziell, aber die Frage, welche Möglichkeiten des Broterwerbs es gab, trieb den künftigen Vater um. Er entschied sich für den Journalismus, unterstützt von seiner Frau, obwohl Jenny nicht unbedingt wollte, dass er sein Leben ausschließlich auf die Politik ausrichtete. Einmischung und tatkräftiges Mitmischen ja, aber der Mann sollte auch eine existenzsichernde Tätigkeit ausüben.
1 Schack, Jenny Marx, S.26
2 Schack, Jenny Marx, S.26
3 Schöncke, Karl und Heinrich Marx und ihre Geschwister, S.848
Höchstes Glück und größte Sorgen
Mai bis Dezember 1844
Die Krönung ihres Glückes war für Jenny und Karl Marx die Geburt von Tochter Jenny Caroline am 1. Mai 1844. Aus Freude und Erleichterung, dass Mutter und Kind gesund waren, ließ Großmutter Caroline am 4. Mai in der „Trier’schen Zeitung“ verkünden: „Das(s) meine Tochter Jenny Marx in Paris am 1. Mai von einem gesunden Mädchen glücklich entbunden, zeige ich meinen theilnehmenden Freunden ganz ergebenst an“. In Trier wusste man nun, dass Frau Marx in Paris lebte und trotz fortgeschrittenen Alters wenige Monate nach der Heirat ein Mädchen bekommen hatte.
Der Freude folgten bald größte Sorgen. Der Säugling erkrankte, und Jenny fühlte sich hilflos und völlig überfordert. Unendliche Angst um das Leben ihres Kindes ergriff sie, und auch ihr Mann war verzweifelt und konnte sie nicht trösten. In diesen Stunden der Not beschlossen sie, bei der Mutter Rat und Unterstützung zu suchen, und Jenny reiste im Juni nach Trier. Die Fahrt war an sich schon enorm strapaziös, aber mit einem todkranken Neugeborenen, das schrie, weinte und mit ungeeigneter Kost ernährt wurde, eine Tortur. Die Postkutsche von Paris über Metz nach Saarbrücken benötigte drei Tage, unterbrochen durch kurze nächtliche Ruhephasen, und weitere 15 Stunden von Saarbrücken nach Trier. Zitternd vor Angst um das Baby verbrachte die Mutter die so unendlich langsam vergehenden Stunden in dem stickigen Gefährt. Glücklicherweise war die mühsame Unternehmung nicht vergebens gewesen und Vater Karl erhielt umgehend „ein Bulletin über unser Kleinchen; denn dies dritte ist doch jetzt die Hauptperson im Bunde und das was mein und dein zugleich ist doch das innigste Band der Liebe. Das arme Püppchen war nach der Reise recht elend und leidend und es stellte sich außer einer Unterleibsverhärtung, eine förmliche überfütterung heraus. Das dicke Schwein mußte zugezogen werden und sein Entscheid war dann eine Amme zu nehmen, da es bei der künstlichen Ernährung nicht leicht wieder aufkommen werde.“1 Ein sinnvoller Ratschlag Dr. Schleichers, pietätlos „das dicke Schwein“ genannt, eine Amme zu engagieren. Muttermilch war schon immer gesünder als jede zusammengestellte Kost, aber vielleicht konnte Jenny nicht stillen oder sie wollte nicht, weil es sich für eine adlige Dame nicht geziemte und sie die Usancen ihres Standes noch nicht abgelegt hatte. „Das liebe kleine Klugaug saugt prächtig an einer jungen gesunden Amme, einem Mädchen aus Barbeln, der Tochter des Schiffers, der Vaterchen so oft gefahren. Die Mutter hat dies Mädchen als Kind einmal in bess’ren Zeiten ganz angekleidet, und – welch ein Zufall – dies arme Kind, dem Vaterchen täglich einen Kreuzer geschenkt, schenkt jetzt unserm Kind Leben und Gesundheit. Es war schwer zu retten und ist jetzt fast aller Gefahr enthoben“2, schrieb sie erleichtert an Karl. Die lähmende Angst ließ nach. Jenny atmete auf und beruhigte den Vater: „Trotz seinem Leiden sieht es wunderniedlich aus, und ist so blüthenweiß und fein und durchsichtig wie ein Prinzeßchen. In Paris hätten wir es gewiß nicht durchgebracht und so trägt diese Reise schon goldne Zinsen.“3 Der schlimmste Schicksalsschlag war abgewendet.
Der Besuch von Frau Marx war ein Gesprächsthema in der kleinen Stadt. Schön und nach der neuesten Pariser Mode gekleidet spazierte sie stolz mit ihrem Wunschkind durch die Gassen. Sie genoss ihren Aufenthalt. Die Mutter und Dienstmädchen Helene verwöhnten sie, das Kind gedieh und „ganz Trier gafft, glotzt, bewundert und becourt.“4 Viele Trierer erinnerten sich an die einstige Ballkönigin und das schönste Mädchen der Stadt. „Ich (brauche) niemand die Visite zu machen, denn Alles kommt zu mir und ich empfange von Morgens bis Abends die Cour. Ich trete übrigens gegen jeden üppig auf, und mein äußeres Auftreten rechtfertigt denn auch vollkommen diese üppigkeit. Einmal bin ich eleganter als Alle und dann hab’ ich nie in meinem Leben besser und blühender ausgesehn als jetzt. … Und die Complimente Herweghs, ‚wann ich confirmirt worden sei’, wiederholen sich hier fortwährend“5, freute sich Jenny bei Karl. In ihrem Innersten wusste sie um ihr Blendwerk, aber „was hätte man davon wenn man klein thäte; es hülfe doch niemand aus der Not und der Mensch ist so glücklich, wenn er bedauern kann. Trotz dem, daß mein ganzes Sein und Wesen Zufriedenheit und Fülle ausspricht, hofft doch Alles daß Du Dich doch noch zu einem ständigen Posten entschließen werdest.“6 Da Marx noch immer ohne Einkünfte, bzw. eine feste berufliche Verpflichtung war, sah Jenny die Zukunft nicht so rosig, wie sie vortäuschte. Auch wenn sie darauf vertraute, dass mit Karl an ihrer Seite nichts wirklich schlimm werden konnte, wollte sie sich vergewissern, dass „wir uns nur noch eine Zeit lang halten, bis unser Kleinchen ein Großchen ist. Gelt darüber beruhigst Du mich, Du lieber süßer Engel Du. Du einzig geliebtes Herz.“7 Die Frau in dieser Hoffnung zu wiegen, war immer möglich, besser waren Geldzuwendungen wie 1.000 Taler aus einer Spendenaktion von Kölner Liberalen. Auch ein Besuch konnte Entspannung in den Finanzen bringen. Die Höflichkeitsvisite bei Karls Familie hätte sofort nach Jennys Ankunft erfolgen müssen, da ihre Anwesenheit sich schnell herumgesprochen hatte. Die Damen Marx zeigten dennoch Haltung und nahmen den verspäteten Besuch nicht übel. Jenny war der Gang nach eigenem Bekunden nicht leicht gefallen. Sie war zwar schön in ihrem „nett Pariser Kleid“, aber ihr Gesicht glühte „vor Angst und Aufregung“ und ihr Herz schlug hörbar. Zu Karl über dessen Familie: „Deine Mutter ist blühend und wohl und die Heiterkeit selbst; fast lustig und ausgelassen. Ach, es ist so unheimlich diese Lustigkeit. Alle Mädchen waren sich gleich an Herzlichkeit; besonders Carolinchen. Am andern Morgen war Deine Mutter schon um 9 Uhr da um das Kindchen zu sehn. Es ist mir recht lieb und der Mutter auch; aber woher so plötzlich? was doch der Erfolg thut, oder bei uns vielmehr der Schein des Erfolgs, den ich mit der feinsten Tactik zu behaupten weiß. Leb wohl, theures Herz, liebes einziges Leben // Leb wohl / Dein Schipp und Schribb.“8 Ihr Vorgaukeln von Erfolg war verständlich, aber nicht geschickt. Die Schwiegermutter sah nicht den geringsten Anlass, ihr Geld zuzusagen; denn Erfolg war doch gleichbedeutend mit Einnahmen?
Anfang August war das Baby reisefähig, die Fahrtkosten hatten sich gelohnt und die Sehnsucht nach Karl stetig gewachsen, aber noch bewegte sich Jenny nicht aus Trier hinaus. Aufregendes war in preußischen Landen geschehen! Am 26. Juli 1844 war auf den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. ein Attentat verübt worden, und die Feier zur wundersamen Rettung des Allerhöchsten durften weder Freund noch Feind sich entgehen lassen. „Alle Glocken läuteten, Geschütze feuerten und die fromme Schar (begab sich) in die Tempel, dem himmlischen Herrn ein Halleluja zu bringen, daß er den irdischen Herrn so wundersam gerettet. Du kannst Dir denken, mit welch eigener Empfindung ich während der Feier die Heineschen Lieder las, und auch mein Hosianna mit anstimmte. ... Als ich das kleine grüne Heupferd, den Kavalleriehauptmann X., von verlorner Jungfrauschaft deklamieren hörte, glaubte ich nicht anders, als er meine die heilige unbefleckte Jungfrauschaft der Mutter Maria, denn das ist doch einmal die einzig offiziell konstatierte – aber von der Jungfräulichkeit des preußischen Staates! Nein, davon hatte ich das Bewusstsein längst verloren. Ein Trost bleibt noch beim Entsetzlichen dem reinen Preußenvolke, nämlich: dass kein politischer Fanatismus der Beweggrund der Tat war, sondern rein persönliche Rachlust“9, berichtete Frau Marx ihrem Mann. Von offizieller Seite war zunächst verkündet worden, ein politisches Komplott sei Ursache für den Anschlag gewesen. Allerdings musste diese Version dahingehend korrigiert werden, dass es sich um einen Einzeltäter handelte, der, so Jennys Ansicht, den „Mordversuch gewagt, aus Noth, aus materieller Noth“. Sie meinte zu ihrem Mann: „Geht es einmal los, so bricht es aus von dieser Seite – das ist der empfindlichste Fleck und an dem ist auch ein deutsches Herz verwundbar!“10 In der Tat nährte der Weberaufstand in Schlesien im Juni 1844 für Momente die Hoffnung, dass immer mehr Unterdrückte sich erhöben und es zu einem Flächenbrand käme. Das Militär bereitete diesem Aufschrei der hungernden Ausgebeuteten nach wenigen Tagen gnadenlos ein Ende. Trotz des bitteren Endes prognostizierte Frau Marx, dass in Deutschland zwar eine politische Revolution unmöglich sei, aber zu einer sozialen Revolution seien alle Keime vorhanden. Frau Marxens Erkenntnisse zu den Ereignissen im Sommer 1844 wurden im Wochenblatt „Vorwärts!“ anonym in einem „Brief einer deutschen Dame“ am 10. August 1844 abgedruckt.
Jenny Marx verlängerte Woche um Woche ihren Aufenthalt in Trier. Ein Grund war: „Jettchen Marx heiratete während meiner Anwesenheit.“11 Natürlich wollte Jenny zur Feier gebeten werden. Aber sie war sich bei ihrem Mann nicht sicher, ob sie eine Einladung erhalten würde, denn „mit den Deinen haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Erst der große erhabene Besuch und jetzt die großen Vorbereitungen für die Hochzeit. Da ist man denn ungelegen, wird nicht aufgesucht und ist bescheiden genug, nicht wieder aufzusuchen. Die Hochzeit ist am 28. August.“12 Eine Hochzeit mit düsterer Seite nach Jennys Meinung: „Trotz all der Herrlichkeit wird Jettchen täglich elender, der Husten und die Heiserkeit nehmen zu. Sie kann kaum mehr gehen. Wie ein Gespenst geht sie einher aber geheirathet muß sein. Man findet es allgemein entsetzlich und gewissenlos. … Ich weiß nicht ob das gut gehn kann. … Ich habe keine Ahnung von dem Wesen der Deinen dabei lustig und vergnügt zu sein. Wenn das Schicksal sie nicht etwas dämpfte, man könnte sich vor ihrem übermuth nicht retten. Und die Prahlerei mit ihren glänzenden Parthien und den Brochen und Ohrringen oder Shals. Ich begreife und fasse Deine Mutter nicht. Sie hat uns selbst gesagt, daß sie glaubt Jettchen habe die Schwindsucht und läßt sie doch heirathen. Aber Jettchen soll es mit Gewalt wollen. Ich bin begierig, wie alles kommen wird.“13 Was gab es zu bekritteln, wenn Jettchen den Mann, den sie liebte, heiraten und die Angehörigen ihr einen glücklichen Tag bereiten wollten? Wäre Jenny von Westphalen an Jettchens Stelle gewesen, sie hätte darum gekämpft, noch auf dem Totenbett ihren Karl heiraten zu können. Ob Jenny geladen war, ist nicht gesichert, denn sie verlor kein Wort über die Hochzeit – bei ihrer Mitteilungsfreude ungewöhnlich.
Ihre Wissbegierde, wie sich alles entwickeln würde, war ein halbes Jahr später befriedigt: Henriette Simons, geborene Marx, starb im Januar 1845.
Das Kind war Mitte August längst gesund. „Dein Püppchen ißt eben sein Süppchen“, schrieb die Mutter an ihr „Lieb gut Herzens Herz … Du gutes, liebes süßes Schwarzwildchen. Du Väterchen meines Püppchens“14, doch sie blieb in Trier. Der Grund: „Der Humbug mit dem heiligen Rocke war den Sommer in vollem Gange“. Diese „Heilig-Rock-Wallfahrt“ war die erste straff organisierte Wallfahrt des Bistums Trier. Vom 18. August 1844 an machte Bischof Wilhelm Arnoldi den „Heiligen Rock“ der Öffentlichkeit zugängig, und mehr als 1,1 Millionen Pilger (manche sprechen von einer halben Million) sollen innerhalb von sechs Wochen die kostbare Reliquie bewundert haben. Jenny Marx war mittendrin und schilderte ihrem Mann das Geschehen: „In Trier ist schon ein Treiben und Leben, wie ich es nie gesehen habe. Alles ist in Bewegung. Die Läden sind alle neu aufgeputzt, jeder richtet Zimmer zum Logiren ein. Wir haben auch eine Stube bereit. Ganz Coblenz kommt und die crème der Gesellschaft schließt sich an die Prozession an. Alle Gasthöfe sind schon überfüllt. 210 Schankwirtschaften sind neu etablirt. … Täglich 16.000 Menschen. … Die Leute sind alle wie wahnsinnig. Was soll man nun davon denken? Ist das ein gutes Zeichen der Zeit, daß alles bis zum extrem gehen muß, oder sind wir noch so fern vom Ziel?“15 Frau Marx stand nicht alleine mit ihrer Kritik. Viele aufgeklärte Zeitgenossen sprachen sich gegen das „Götzenfest“ aus, weigerten sich, den Rock als echtes Gewand von Jesus Christus anzuerkennen, prangerten die wirtschaftlichen Interessen, die Habsucht der katholischen Kirche, die größten Profit erzielte, an und „sah(en) in der Wallfahrt eine politische Demonstration der Ultramontanen gegen die staatliche Ordnung.“16 Wirte, Anbieter von Schlafplätzen und Krämer hatten Hochkonjunktur, und dadurch machte die Kirche einen großen Teil der Trierer Bevölkerung dem Spektakel gewogen. Auch Jennys Mutter profitierte von der Vermietung einer Stube; sie brauchte jedes Zubrot, um Tochter und Enkelin zu verwöhnen. Doch Jenny wollte der Mutter nicht zur Last fallen: „Ich werde das Monatsgeld von 4 Taler von dem Rest des Reisegeldes bezahlen, so auch Arznei und Doktor. Die Mutter will zwar nicht; sie hat aber doch an der Kost mehr zu tragen, als sie tragen kann. Es ist ärmlich und doch anständig alles um sie herum. Die Trierer sind wirklich ausgezeichnet gegen sie und das versöhnt mich auch wieder etwas.“17 Mutter Caroline war als Witwe eines ehemals hohen Regierungsbeamten und als Stiefmutter eines Mannes, dessen Karriere steil nach oben führte, geachtet, aber sie lebte bescheiden von der recht kärglichen Rente, mit der sie noch immer Sohn Edgar finanzierte.