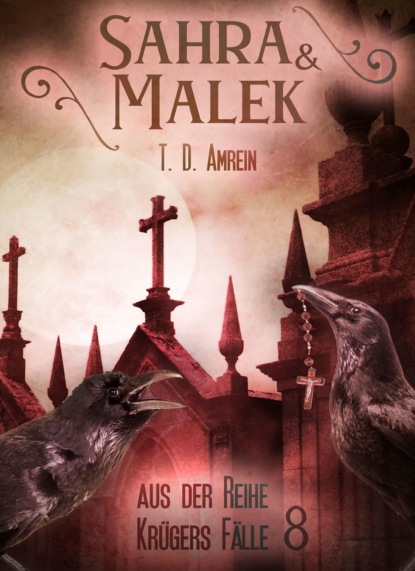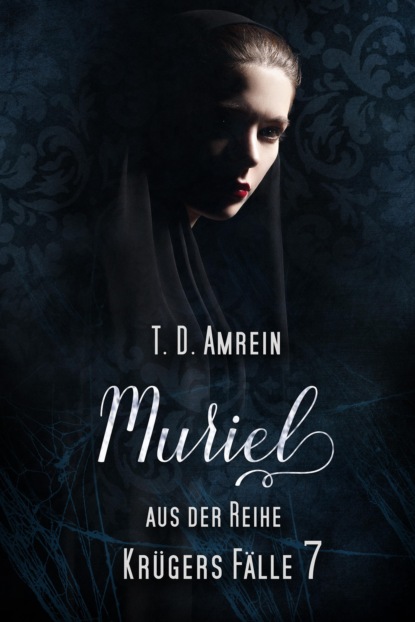- -
- 100%
- +
Leichen mit akuten Blutvergiftungen hatte sie bereits mehrere auf dem Tisch gehabt. Eines hatten die alle gemeinsam: Sie waren innerhalb weniger Tage vom kerngesunden Menschen zum Fall für einen Leichenpfleger geworden.
Ein paar Tage, überlegte sie. Wenn man ab dem Zustand rechnete, in dem sie sich offenbar schon befand, konnte es sich auch bloß noch um ein paar Stunden handeln.
Ein Gedanke blitzte auf: Eventuell bot sich ihr die Möglichkeit, sich in diesem Fall als Erste, selbst für ihre eigene Aufbahrung zu schminken. Das unwillkürlich hochkommende Lachen über den Einfall artete zum kläglichen Krächzen mit anschließendem heftigem Huster aus. Ein spontaner Ausbruch des Humors, den sie sich im Laufe der letzten Jahre mühsam erarbeitet hatte, dachte sie, nachdem sie wieder normal atmen konnte.
Aufs Neue dämmerte sie weg. „Nur noch für ein paar Minuten die Augen schließen. Unkraut vergeht schließlich nicht so rasch“, murmelte sie vor sich hin. Nur ganz kurz ruhig liegen und durchatmen. Danach musste sie sich unter allen Umständen um die Sache kümmern.
4. Kapitel
Krüger stand am nächsten Morgen wie vorgesehen vor Hahnlosers Haus. Ein in die Jahre gekommenes, grau und abweisend wirkendes Einfamilienhaus mit verwildertem Garten. Von den Fensterläden blätterte der Lack. Kleine Ziegelsplitter, die den Vorplatz mit roten Punkten verzierten, bröckelten vom Dach. So ziemlich das Einzige, das auf dem Grundstück sympathisch wirkte. Die Fensterscheiben zeigten sich verschmiert und gelblich verfärbt, sodass man trotz der fehlenden Gardinen von außen nichts erkennen konnte. Überall lagerten Gegenstände, die ihre Verwendung längst überlebt hatten. Dazwischen einige Stapel Brennholz oder alte Möbel, die wohl auch für diesen Zweck vorgesehen waren. Krüger schwante Schlimmes. Wenn es schon von außen so verwahrlost aussah …
Trotz der Information, dass Jürgen Hahnloser allein hier lebte, klingelte Krüger mehrmals. Nichts rührte sich.
Gleich der erste Schlüssel passte. Ein abgestandener Hauch strömte ihm entgegen. Er hatte zwar Handschuhe dabei, aber keine Atemmaske. Sollte er besser sofort abbrechen?
Er überwand sich und schob sich in den vollgestellten Flur. Das erste Zimmer auf der rechten Seite diente offenbar als Papierlager. Krüger wollte eigentlich so schnell wie möglich ein Fenster öffnen. Jedoch dazu hätte er auf den Berg aus Zeitungen und anderen Druckerzeugnissen steigen müssen. Anscheinend bewahrte Hahnloser hier die Post der letzten Jahre auf. Der nächste Raum, die Küche, wirkte wider Erwarten einigermaßen aufgeräumt. Zumindest angesichts des übrigen Chaos. Hier schaffte es Krüger zwar zum Fenster, aber es klemmte. Die Treppe nach oben wurde durch eine Tür auf halber Stockwerkhöhe unterbrochen. Abgeschlossen. Krüger stutzte. Er probierte alle Schlüssel durch. Keiner passte. Vielleicht doch ein Untermieter, überlegte er? Wenn, dann wahrscheinlich ein Mann. Dass sich eine Frau diesen Schweinestall antun würde, hielt er für ausgeschlossen. Ein weiterer Bewohner könnte möglicherweise auch den Zustand der Küche erklären, setzte er den Gedanken fort. Und der könnte natürlich jederzeit auftauchen! Fast wie ein Einbrecher schlich sich Kommissar Krüger aus dem Haus. Bloß eine Vermutung. Aber sein Bauchgefühl warnte ihn. Niemand war hier angemeldet, außer Hahnloser. Jedoch kaum zu erwarten, dass sich in seinem Umfeld jemand von irgendwelchen Meldevorschriften beeindrucken ließ.
Krüger schlenderte schließlich doch noch einmal zurück zur Haustür. Mit zwei Tröpfchen Sekundenkleber befestigte er ein Haar an Tür und Rahmen. Eine bewährte Methode. Cyanacrylatkleber hatte er eigentlich immer dabei. Und Haare auf dem Kopf auch.
***
Doktor Holoch hat mitgeteilt, dass Kommissar Krüger doch bitte in die Rechtsmedizin kommen solle, sobald er zurück sei, stand auf einem Notizblatt, das auf Krügers Schreibtisch lag. Sehr dringend konnte es nicht sein, sonst hätte man ihn angerufen, dachte der Kommissar. Andererseits, bei Doktor Holoch wusste man nie.
Krüger zog sich erst einen Kaffee aus dem Automaten, bevor er sich auf den Weg machte. Wenn der gute Doktor es wieder einmal übertrieb mit detaillierten Beschreibungen, Fotos oder sogar Originalpräparaten, konnte Krüger dazwischen einen Abfalleimer für den Becher aufsuchen, um kurz durchzuatmen. Im Reich des Doktors wurde kein allgemeiner Abfall geduldet, um Kontaminationen zu vermeiden. Genaugenommen durfte Krüger auch nichts dergleichen mitbringen, aber wer sollte ihm das verbieten?
Holoch schien sich aufrichtig zu freuen über den Besuch des Kommissars. Kein besonders gutes Zeichen aus Krügers Sicht. Das deutete an, dass der Pathologe eine Entdeckung gemacht hatte, die er als äußerst aufschlussreich und für die Ermittlung bahnbrechend einstufte. Nicht, dass dies noch nie vorgekommen wäre. Aber in neun von zehn Fällen entpuppte sich die große Erkenntnis eher als mittlere Sensation. Oder auch als gewagte Spekulation.
„Sie wollten mich sprechen, Herr Doktor?“, begann Krüger so neutral wie möglich.
Der Doktor nickte eifrig. „Ja, Herr Kommissar. Ich denke, dass ich Sie an meinen Gedanken in diesem Fall teilhaben lassen sollte!“
Krüger schwante Schlimmes. Nicht aus fachlicher Sicht. Aber Holoch liebte ungewöhnliche Details. Wie zum Beispiel eine genaue Beschreibung der Metamorphose einer Dasselfliege vom Ei bis zur ausgewachsenen Made. Bei einem menschlichen Wirt, natürlich.
Krügers: „Dann lassen Sie bitte hören“, klang entsprechend vorsichtig.
Holoch stutzte nur kurz. „Nun ja, ich habe die Schnittflächen, die bei der Entnahme der Testikel entstanden sind, unter dem Mikroskop untersucht. Die Wundränder an sich zeigen sich nicht besonders auffällig. Aber an der Außenhaut des Skrotums haben sich dunkle Rückstände abgelagert, die eigentlich nur von der Klinge während des Schneidevorgangs abgestreift worden sein können. Weil ich mich auch ab und zu mit Mineralien beschäftige, weiß ich, wie Korunde unter dem Mikroskop aussehen. Sie leuchten nämlich in bestimmten Farben. Selbstverständlich habe ich eine Probe an unser Labor gegeben, um das zu verifizieren.“
Krüger entspannte sich etwas. „Und was folgern Sie daraus, Herr Doktor?“
„Korund ist ein absolut übliches Schleifmittel. Moderne Einwegklingen wie Skalpelle oder auch diese weitverbreiteten Klingenmesser schärft schon längst niemand mehr. Höchstens noch normale Küchen- und Fleischermesser. Jedoch kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass ein Solches hier zum Einsatz kam. Unpraktisch und viel zu groß für einen so präzisen Schnitt. Der übrigens auffallend gerade verläuft. Eine schwierige Sache mit der Spitze eines langen Messers.“
Krüger nickte zustimmend. „Dazu in der Enge eines Fahrzeuges und zwischen den Beinen …“
„Trotzdem, die Klinge muss sehr scharf gewesen sein“, fuhr Holoch fort. „Kein gezähntes Messer, keine Scharten. Der Schnitt verlief sozusagen spielend leicht wie durch Butter. Für mich kommt deshalb nach Würdigung aller Details eigentlich nur ein klassisches Rasiermesser infrage.“
„Aber das ist doch auch ziemlich groß“, warf Krüger ein.
„Ja, das stimmt natürlich. Jedoch liegt es gut in der Hand. Es lässt sich leicht und sehr genau führen. Und wenn man gewohnt ist, damit zu arbeiten, versteht man normalerweise ebenfalls etwas davon, wie es zu schärfen ist.“
Krüger fasste sich ans Kinn. „Angenommen, Sie haben recht. Gibt es überhaupt noch eine Branche, die mit solchen Messern arbeitet?“
„Gewisse Friseure, die sich als moderne Barbiere sehen.“
„Ja, aber wer würde denn ausgerechnet auf diese Art auf sich aufmerksam machen?“
„Dass man nur aufgrund der Schleifmittelrückstände auf ein solches Messer schließt, dürfte ein durchschnittlich begabter Ausführender kaum erwartet haben, Herr Kommissar.“
Krüger beließ es bei einem schwachen Schulterzucken.
„Selbstverständlich kann es tatsächlich genau umgekehrt gewesen sein, um uns auf eine solche, in diesem Fall natürlich falsche Spur bringen zu wollen“, fuhr der Doktor fort. „Ein sehr raffinierter Täter könnte das Messer mit Absicht zuvor geschliffen und nicht gereinigt haben. Normalerweise zieht man diese Klingen vor Gebrauch bloß an einem Leder entlang. Es ab und zu richtig zu schleifen, ist allerdings trotzdem unerlässlich. Im Verlauf von etwa zehn Rasuren lässt die Schneide deutlich nach. Ich habe übrigens festgestellt, dass diese Messer bei Nichtgebrauch bald zu rosten beginnen …“
Krüger unterbrach ihn. „Entschuldigen Sie Herr Doktor. Das klingt zwar alles sehr interessant. Und ich möchte mich auch gerne genauer damit auseinandersetzen. Aber ich habe in zehn Minuten einen Termin, den ich nicht verschieben kann. Könnten Sie mir Ihre Ausführungen bitte schriftlich darlegen?“
Holoch sah ihn erstaunt an. „Das habe ich doch längst zu Papier gebracht, Herr Kommissar. Darf ich Ihnen gleich ein Exemplar mitgeben?“
Krüger entspannte sich. „Ich bitte darum!“
Holoch kramte eine graue Dokumentmappe hervor. „Bitte sehr, Herr Kommissar!“
Krüger überlegte kurz. „Weiß schon jemand von der Sache?“
Der Doktor schüttelte den Kopf. „Nein. Sie sind der Erste.“
„Dann belassen Sie es im Moment bitte dabei. Ich möchte mich zuerst eingehender damit beschäftigen. Möglichst bevor das bekannt wird.“
„Aber selbstverständlich, Herr Kommissar, bleibt das unter uns, wenn Sie das wünschen. Und ich freue mich, dass Sie es interessant finden.“
Krüger suchte krampfhaft nach einer Antwort, die dem Doktor gefallen könnte. Ohne Erfolg. Seinen Satz: „Sie verständigen mich, falls das Labor zu einem anderen Schluss kommen sollte, Herr Doktor?“, fand er selbst eher unpassend.
Holoch lächelte jedoch bloß. „Das wird nicht passieren, Herr Kommissar. Ich bin mir ganz sicher.“
Krüger zog sich zurück. Den vorgeschobenen Termin verband er mit einem Besuch bei Michélle. Sie sollte sich mit Holochs Theorie ebenfalls eine Nacht lang befassen können. Dann konnte er sich morgen mit ihr darüber austauschen. Mit den Mitteln eines durchschnittlich begabten Kommissars, ging ihm durch den Kopf.
***
Gisbert durfte zwar nicht zu Sahra, aber immerhin erhielt er die Mitteilung, dass sie die Nacht überlebt hatte. Ihr Zustand sei unverändert.
Auf die Schnelle hatte ihm der Assistent eines Kollegen ausgeholfen, die zahnlose Oma halbwegs ansehnlich herzurichten. Über welche Begabung Sahra verfügte, wurde Gisbert jedoch erst jetzt so richtig klar.
Zwar hatte der Helfer die unmittelbare Not behoben. Aber die nächste Leiche würde sich turnusgemäß bald einstellen. Gisbert hatte sich darauf eingerichtet, dass er von einer bis zwei Feuerbestattungen in der Woche leben konnte. Versorgt wurde er ausschließlich von Altenheimen oder Kliniken, wo er die Verstorbenen ohne komplizierte Bergungen einfach abholen konnte. Die Bestatter der Gegend kannten sich und hatten sich entsprechend arrangiert. Manchmal, bei großem Andrang, brachte ihm ein Kollege einen "Kunden" vorbei, wenn die eigenen Kapazitäten nicht mehr ausreichten. Die Gebäude und das Grundstück waren längst bezahlt. Außer preiswertem Verbrauchsmaterial und ab und zu einem anderen Leichenwagen, benötigte er kaum Ausrüstung für sein Geschäft. Die Autos kaufte er von Kollegen mit großen Firmen, gebraucht und sehr günstig ein. Zubehör wie Kerzen oder Tannenreisig wechselten mit traumhaften Margen den Besitzer. Ein kleiner Vorrat an Särgen, deren Verkauf ihm einen ansehnlichen Teil seines Verdienstes einbrachte, rundete das Ganze ab. "Die Angestellte", also Sahra, bezahlte er in Anbetracht ihrer Arbeitszeit zwar vergleichsweise großzügig. Aber der Ertrag einer einzigen Bestattung reichte für etliche Monate der "Personalkosten" aus.
Sahra versorgte sich und Gisbert außerdem mit einer Unmenge an selbstangebautem Gemüse und Früchten. Womit sollte sie, die praktisch niemals ausging, sich sonst den ganzen Tag beschäftigen. Im Gemüsegarten blieb sie ungestört und konnte sich sogar ab und zu an die Sonne legen. Ganz nebenbei schnitt sie die Sträucher und den Rasen, räumte Laub und hielt das Unkraut in Schach. Nur bei größeren Arbeiten und beim Schneeschippen half Gisbert manchmal mit. Und alle paar Jahre beauftragte er einen Gärtner, um die Bäume zu stutzen oder neue Stauden anzupflanzen.
Gut, Sahra erledigte dies alles freiwillig. Gisbert würde nur einen Bruchteil ihrer Arbeit tatsächlich verlangen und entsprechend bezahlen müssen.
Trotzdem schwante ihm, dass er sie auch in dieser Beziehung schmerzlich vermissen würde.
Eine Aushilfe besorgen oder doch selbst Hand anlegen? Keine Frage für Gisbert. Jedoch, er wollte unbedingt ein weibliches Wesen im Haus haben. Aus verschiedenen Gründen. Der Helfer des Kollegen war effizient gewesen, das musste Gisbert zugeben. Aber von der harmonischen, sakralen Stimmung, die normalerweise bei Sahras Aufbahrungen herrschte, konnte man nur wenig spüren. Auch dies fiel ihm erst jetzt wirklich auf. Sahra legte die Toten nicht bloß zum öffentlichen Begaffen hin. Ein eklatanter Unterschied, der sich jedoch nicht an klaren Ursachen festmachen ließ.
Frauen in diesem Job waren eher dünn gesät. Nicht so sehr Bestatterinnen an sich, sondern "nur" Leichenpflegerinnen. Eine mit Ausbildung würde sich ohnehin kaum von ihm für bloß einige Stunden in der Woche anstellen lassen.
Aber vielleicht eine ehemalige Zahnarzthelferin, deren Kinder schon etwas größer waren. Er würde das Inserat entsprechend formulieren. Natürlich nur, bis Sahra wieder ihren Posten einnahm. Aber konnte sie überhaupt weiterarbeiten mit nur einer Hand? Gisbert schüttelte den Gedanken ab. Die Ärztin hatte einen kompetenten Eindruck gemacht. Noch handelte es sich nur um eine nicht gänzlich auszuschließende Möglichkeit.
Es ließ sich nicht einfach so abstellen. Würde ihn ein abrupt endender Armstumpf stören, wenn er mit ihr schlief, fiel ihm ein. Was, wenn sie ihn irgendwo damit berührte? Wahrscheinlich schwierig, sich nichts anmerken zu lassen. Dann sollte er es lieber gleich ganz aufgeben?
Jedoch dürfte sie das tief ins Mark treffen. Sahra hatte schon so viel Niedertracht erlebt. Er war der Einzige, der sie bislang ohne Vorbehalt angenommen hatte. Und jetzt zog er in Betracht, dass sie zum schweren Verlust ihrer rechten Hand auch noch verkraften sollte, dass er sie nicht mehr anfassen mochte? Welch fantastische Partnerschaft!
„Moment!“, rief er sich selbst zu Ordnung. „Wir sind überhaupt kein richtiges Paar. Sie ist nur eine …“
Bloß Matratze wollte er sie doch nicht nennen. „Einfach eine Gelegenheit“, murmelte er schließlich. Aber ob er wollte oder nicht. Er vermisste sie. Nicht nur als wohlfeile Angestellte. Jedenfalls fühlte er sich plötzlich nicht mehr sicher? Und was wären sie denn dann die ganze Zeit gewesen? Ein falsches Paar, womöglich?
Gisbert zog sich in den Hobbyraum zurück, um nebenbei weiter nachzudenken. Ein heller, ebenerdiger Raum, in dem früher einmal Sarglager und die entsprechende Werkstatt untergebracht gewesen waren. Während seine Eltern noch gewirtschaftet hatten. Und er fast die gesamte Freizeit, die ihm als Schüler blieb, hier zusammen mit einem erfahrenen Tischler verbracht hatte. Auch heutzutage stand er oft an einer dieser Werkbänke, um sich liebevoll mit Holz zu beschäftigen. Vorwiegend mit altem Holz. Gisbert nahm sich viel Zeit für das Restaurieren von antiken Möbeln. Oder auch um Teile eines geschnitzten Bilderrahmens zu ergänzen, beispielsweise. Sein wichtigstes Kriterium: Er arbeitete genauso, wie man es früher vor der Zeit mit Strom und Maschinen musste. Einzige Ausnahmen, Licht in der Werkstatt und manchmal verwendete er eine Handbohrmaschine. Um unsichtbare Holzdübel in großer Zahl einzusetzen oder für kleine Schrauben vorzubohren. Am Ende sichtbare Löcher, schnitt er jedoch ausschließlich von Hand.
Es ging ihm nicht um eine Art reine Lehre. Aber wer noch nie ein Brett aus einem rohen Stamm mit Körperkraft ausgesägt hatte, konnte gar nicht wissen, was die Gesellen früher geleistet hatten. Gisbert bestand darauf, sich für sein Hobby reichlich Zeit zu lassen, alle Vorgänge wirklich zu genießen. Das Genießen dauerte insgesamt manchmal Jahre. Einfach solange, bis er ein Stück als fertiggestellt empfand.
Neue Objekte erhielt er von Antiquitätenhändlern, die wussten, dass er die bestmögliche Arbeit ablieferte. Bloß ohne jeden Termin. Bei älteren Händlern kam es ab und zu vor, dass erst die Erben die Antiquität zurückerhielten. Gisbert verrechnete keine Stunden. Er erhielt normalerweise einen Teil der Wertvermehrung als Aufwandsentschädigung. Sein echter Lohn lag im Gelingen. Das Neuerschaffen eines Kunstgegenstandes mit seinen eigenen Händen.
Diese Beschäftigung sorgte nebenbei zuverlässig dafür, dass er Unangenehmes beiseiteschieben konnte. So auch heute. Sahras Schicksal verblasste angesichts der Rettung eines gespiegelten Wurzelholzfurniers, das die Umsicht eines kompromisslosen Fanatikers verlangte. Und ein altes Dampfbügeleisen. Schon bald stieg der Geruch von gelöstem Knochenleim in der Werkstatt auf. Ein Fest für Gisberts Sinne.
5. Kapitel
Auf der Intensivstation in der Uniklinik Freiburg reinigte Frau Doktor Elke Steiger eigenhändig die Brandwunde der Patientin Sahra Kruse. Eine Anästhesie benötigte sie dazu nicht. Sahra lag unverändert im Koma. An einigen Stellen ließ sich eine beginnende Heilung erkennen. Das änderte jedoch nichts daran, dass im Zentrum der Handfläche bloß liegende Sehnen und Knochen zu sehen waren. Eigentlich keine Chance mehr für die Hand. Aber solange die Patientin nicht aufwachte und sich deshalb nicht bewegte, konnte man noch hoffen. Außerdem, auch wenn sich der Allgemeinzustand etwas stabilisiert hatte. Dass Frau Kruse überhaupt je wieder ihre Augen aufschlagen würde, stand keineswegs fest. Die Ärztin kümmerte sich nicht einfach so heute selbst um die Patientin. Sie erwartete einen erfahrenen Kollegen, der sich mit Verletzungsursachen besser auskannte als sie. Doktor Franz Holoch, den Rechtsmediziner der Kripo Freiburg.
Es galt, falls es einen Schuldigen gab, den zu finden. Nicht bloß, um Gerechtigkeit zu schaffen. Schließlich würden die Behandlungskosten der Klinik offenbleiben, wenn nicht eine solvente Versicherungsgesellschaft einspringen musste.
Doktor Holoch wurde regelmäßig gerufen, um beispielsweise Hämatome, die von Schlägen stammen konnten, zu beurteilen. Und selbstverständlich bei jeder Art von Stich- oder sogar Schussverletzungen.
Bei Sahra handelte es sich zwar um eine Brandwunde. Allerdings, eine so tief greifende Schädigung hatte Elke noch nie gesehen. Es konnte sich möglicherweise um eine Schweißflamme gehandelt haben, vermutete sie. Aber woher stammten dann die vielen Einschlüsse, die eher auf Schwarzpulver schließen ließen? Das kannte Elke vorwiegend von Feuerwerk. Oder als Streuspur bei Verletzungen durch Vorderlader. Jedoch eine Bleikugel hätte die Hand vermutlich durchschlagen.
Der eintretende Pathologe unterbrach ihre Gedanken. „Ach Sie sind schon hier, Frau Doktor Steiger. Wie schön, Sie wieder mal zu sehen!“
Elke erwiderte den Gruß und erhob sich. Sie kannte das Verhalten von Doktor Holoch. Er war äußerst charmant, ließ sich jedoch niemals auch nur im Geringsten auf eine andere Person wirklich ein. Jedenfalls nicht auf ein lebendiges Exemplar. Er beschränkte sich auf Komplimente und schmeichelte sehr gern. Dahinter lag eine unsichtbare Grenze. Elke war nicht die Erste gewesen, die sich Hoffnungen hingegeben hatte, den Eisblock Holoch antauen zu können. Seine Kompetenz als Pathologe schmälerte das jedoch nicht. Tröstlich blieb höchstens, dass es offenbar auch noch keiner anderen gelungen war, zu ihm durchzudringen.
Holoch musterte kurz die Patientin, bevor er nach ihrer Hand griff. „Weiß man, wer sie so verunstaltet hat?“, brummte er als Erstes.
Elke schüttelte den Kopf. „Sie ist nie aufgewacht seit ihrer Einlieferung. Der Mann, der sie gebracht hat, ist offenbar nur ein Bekannter. Sie soll einen Sohn haben, aber der ist auf hoher See.“
„Flamme mit konzentrierter Wirkung, würde ich sagen. Praktisch direkt aufgesetzt. Jedoch die Sprenkel stammen mit ziemlicher Sicherheit von Pulverpartikeln. Möglicherweise ist die Verletzung nicht auf einmal entstanden. Und sie wurde anfangs nicht fachgemäß versorgt, denke ich.“
Elke nickte. „Genau meine Interpretation. Bloß, verschiedene Ursachen hatte ich nicht vermutet. Aber Sie haben wahrscheinlich recht. Die ganze Zeit zerbreche ich mir den Kopf, welche Explosion eine so konzentrierte Hitze nur auf einen Punkt erzeugen könnte.“
„Na ja, wenn sie die Hand über einen Feuerwerksvulkan gehalten hätte?“, überlegte Holoch laut.
Elke verzog das Gesicht. „Daran hatte ich erst auch gedacht. Aber dann müsste die Streuung doch größer sein. Und ohne irgendwo sonst, am Handgelenk oder wo auch immer, kleine Verbrennungen durch Spritzer zu erleiden, scheint mir das kaum möglich.“
„Wenn sie nicht durch Schutzkleidung bedeckt war“, warf Holoch ein.
„Natürlich, Herr Doktor“, gab Elke nach.
Holoch betrachtete weiter die Wunde. „Was könnte ganz ähnlich sein, aber deutlich mehr Brisanz entwickeln?“
„Ich habe Ihnen eine ganz frische Probe für ihr Labor abgenommen, Herr Doktor.“ Sie zeigte ihm eine Schale mit den Rückständen, die sie gerade abgeschabt hatte. „Vielleicht hilft das weiter.“
„Danke, das ist nett, Frau Steiger. Aber ich überlege gerade …“ Er wog den Kopf. „Ich habe da einen Fall auf dem Tisch, in dem eine Rauchpetarde, also eine richtige, so ein Teil aus dem Krieg, eine Rolle spielt. Zeitlich, hm, vor gut zwei Tagen. Könnte hinkommen.“
Plötzlich hatte Holoch es eilig. „Sie hören von mir, Frau Kollegin, danke sehr für die Probe!“
***
Am nächsten Morgen, Kommissar Krüger erwartete eigentlich Michélle zu der geplanten Besprechung, klopfte Doktor Holoch bei ihm an.
„Einen besonders schönen guten Morgen!“ Holoch schien bester Laune.
Der Kommissar nickte bedächtig. „Ihnen auch, Herr Doktor. Ich bin aber noch nicht ganz so weit. Gerade erwarte ich Frau Guerin, um ihre Meinung anzuhören.“
Der Doktor winkte ab. „Darüber können wir uns später unterhalten. Ich habe eine völlig neue Spur. Ich gehe davon aus, ein weiteres Opfer in der Sache Hahnloser gefunden zu haben!“
„Wie, ein weiteres Opfer? Eine andere Leiche?“
„Eine Verletzte, Herr Kommissar, keine Tote.“
„Setzen Sie sich doch Herr Doktor! Haben Sie mit der Zeugin oder der Verletzten sprechen können?“
„Ja, danke. Also nicht direkt.“
„Nicht direkt?“, wiederholte Krüger. „Was darf ich mir darunter vorstellen, Herr Doktor?“
Krüger konnte seine Skepsis kaum verbergen.
„Ich wurde zu einer Beurteilung in die Uniklinik gerufen“, begann Holoch. „Dabei ist mir eine Verbrennung aufgefallen. Diese Brandwunde stammt mit Sicherheit von der gleichen Rauchpetarde, die wir im Wagen von Hahnloser gefunden haben. Ich verfüge zwar erst über die vorläufigen Ergebnisse des Labors. Aber die Umstände sind klar. Frau Kruse war vor Ort, als die Petarde abbrannte!“
„Frau Kruse“, wiederholte Krüger. „Sie verweigert die Aussage?“
„Nein, wieso?“
„Sie haben nicht direkt mit ihr gesprochen, sagten Sie zu Anfang, Herr Doktor.“
„Hatte ich nicht erwähnt, dass die Patientin im Koma liegt?“
„Nein, hatten Sie nicht, Herr Doktor“, erklärte Krüger freundlich.
Inzwischen hatte sich Michélle eingefunden und hörte, im Türrahmen stehend, zu.
Holoch hatte sie noch nicht bemerkt. „Leider sind ihre Aussichten nicht besonders erfreulich“, fuhr er fort. „Erstens ob sie überhaupt wieder aufwacht und zweitens in welchem Zustand. Sie könnte durch die schwere Blutvergiftung Hirnschädigungen erlitten haben, und die Hand wird man ihr wahrscheinlich amputieren müssen.“
„Das ist ja schrecklich!“, meldete sich Michélle. „Die arme Frau. Ohne Hand ist man nur ein halber Mensch.“
„Guten Morgen, Madame Guerin.“ Holoch nickte ihr aufmunternd zu. „Die Amputation ist wahrscheinlich das kleinste aller Übel, die Frau Kruse drohen, Madame“, stellte er fest. „Bedauerlicherweise!“
„Können Sie uns noch etwas genauer erläutern, wie Sie zu Ihren Schlussfolgerungen gelangt sind, Herr Doktor“, bat Krüger.
„Aber gern. Da war gleich die Erkenntnis, dass eine solche Verbrennung kaum eine übliche Ursache haben kann. Ich zog deshalb mehrere Möglichkeiten in Betracht …“