Verhaltenssucht. Die Illusion der Freiheit
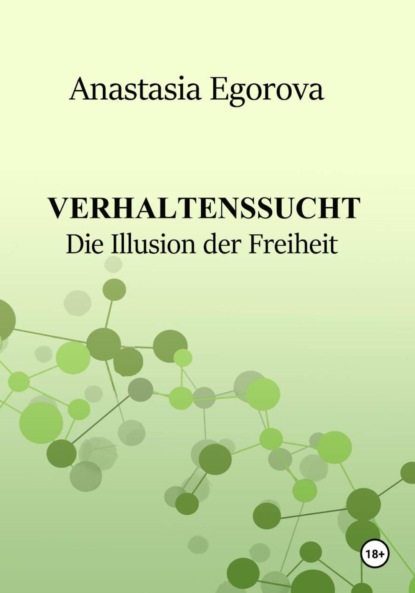
- -
- 100%
- +
Die Jungvögel der Zebrafinken erlernen ihre komplexen Gesangsmelodien von ihren Vätern – nicht zuletzt deshalb, weil die Männchen abwechslungsreicher und kunstvoller singen als die Weibchen –, und Kinder erlernen die Sprache von ihren Eltern und ihrem sozialen Umfeld. Die Erforschung der Gesänge „betrunkener“ Zebrafinken könnte den Wissenschaftlern vielleicht Aufschluss darüber geben, wie Alkohol auf die neuronalen Mechanismen unserer Sprache einwirkt.
Für den Menschen hat der unkontrollierte Alkoholkonsum verheerende Folgen, doch wie wirkt sich Alkohol auf Tiere und Insekten aus?
Die Biologen F. Wiencek, A. Zittmann, M. A. Lachance und R. Spanagel beobachteten das Leben wilder Spitzmäuse in den Regenwäldern West-Malaysias und fanden heraus, dass einige Individuen dieser possierlichen Insektenfresser systematisch den alkoholischen Nektar aus den Blütenknospen der einheimischen Bertam-Palme zu sich nehmen.
Dieses kleine Säugetier weist eine Körperlänge von 5–8 cm bei einem Gewicht von 4–16 g auf. Die Schnauze der Spitzmaus ist stark verlängert und erinnert an einen Rüssel. Die malaysischen Spitzmäuse sind natürliche Bestäuber der Bertam-Palme.
Spitzmäuse sind als Vertreter ihrer Familie generell nützliche Tiere für den Menschen und richten keinen Schaden an, obwohl sie gelegentlich Randale machen und in Bienenstöcke eindringen können, um sich Bienen zu erbeuten. In der weltweiten Fauna gibt es etwa 70 Spitzmausarten, die alle mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt sind: einige fressen Insekten, andere Würmer, wieder andere graben emsig in der Erde. Doch die malaysischen Spitzmäuse konsumieren täglich den alkoholischen Nektar aus den Blütenknospen der Bertam-Palme. Wissenschaftler verzeichneten eine maximale Ethanolkonzentration im Palmennektar von 3,8 %. Wie sich herausstellte, ist diese Alkoholdosis die höchste, die jemals in natürlichen Nahrungsmitteln nachgewiesen wurde.
Der Grund liegt darin, dass in den Palmblütenknospen eine bestimmte Menge Hefen gedeiht, wodurch der Nektar einen hohen Alkoholgehalt aufweist. Dennoch zeigen die Spitzmäuse, die die Palmblüten systematisch aufsuchen, keine ernsthaften Anzeichen von Vergiftung. Diese kleinen Säugetiere besitzen eine hohe Toleranz gegenüber Alkoholkonsum, da die Wechselwirkung zwischen Spitzmaus und Bertam-Palme in einem langen evolutionären Entwicklungsprozess angelegt ist.
Eine Analyse des Spitzmaushaares ergab, dass die Alkoholkonzentration im Körper der Tierchen signifikant höher ist als beim Menschen mit einem vergleichbar hohen Alkoholkonsum.
Wissenschaftler vermuten, dass der Alkoholkonsum der Spitzmäuse – von mäßig bis hoch – bereits in frühen Evolutionsstadien vorhanden war. Doch es ist noch nicht klar, in welchem Maße die Spitzmäuse vom Alkoholkonsum profitieren und wie sie das Risiko eines ständig hohen Alkoholspiegels im Blut reduzieren.
Im Gegensatz zu den malaysischen Spitzmäusen, die – ebenso wie die Zebrafinken – „unter Alkoholeinfluss“ intellektuell wirken und keine Verhaltensanzeichen von Trunkenheit zeigen, verhält sich ein anderes Tier – die Spitzhörnchen-Art Ptilocercus lowii –, die ebenfalls den Nektar der Bertam-Palme verzehrt, recht anständig. Allerdings ist das Spitzhörnchen der größte Trunkenbold unter allen Besuchern der „Palmenschänke“. Dieses Tierchen konsumiert größere Mengen Nektar als andere Liebhaber desselben. Wir können nur hypothetisch annehmen, dass Alkohol eine positive psychologische Wirkung auf die Tiere haben könnte, doch gibt es hierfür keine substantiellen Beweise.
Eine derart eigentümliche Schänke in den malaysischen Dschungeln wird regelmäßig von Grauen Baumratten, Malaysia-Ratten und dem Sunda-Plumplori aufgesucht. Am häufigsten erscheinen Spitzhörnchen und Loris in der „Bar“. Sie verbringen jede Nacht zwischen 138 Minuten auf der Palme. Anmerkung: "138 und 138 Minuten" ist wahrscheinlich ein Tippfehler. Sollte es eine Spanne sein, z.B. "120 bis 138 Minuten"?
F. Wiencek, der das „Barbenleben“ der malaysischen Tiere untersuchte, installierte Überwachungskameras rund um die Palme und während der Forschungsdauer wurden niemals ernsthafte Verhaltensänderungen bei den „trinkenden“ Tieren festgestellt.
Leider ist dem Menschen diese Alkoholtoleranz im Evolutionsprozess nicht vererbt worden, und so bleibt uns nur, die malaysischen Spitzhörnchen und Spitzmäuse zu beneiden – sie eben, die trinken, ohne betrunken zu werden.
R. Dudley, Biologe an der University of California, Berkeley, erforschte etwa 25 Jahre lang den Mechanismus der menschlichen Anziehungskraft zu Alkohol und stellte 2014 in seinem Buch „The Drunken Monkey: Why We Drink and Abuse Alcohol“ die Hypothese auf, dass das Verlangen nach Alkohol bereits bei unseren primaten Vorfahren begann, die heuristisch entdeckten, dass der Geruch von Ethanol sie zu reifen Früften führen könnte. Bei der Beobachtung des Affenverhaltens entdeckte R. Dudley die Regelmäßigkeit, dass Tiere gezielt Früchte suchen, die so weit gereift sind, dass ihr Zucker fermentiert. Durch die Gärung des Zuckers im Saft entsteht etwa 2 % Alkohol, und Affen verzehren diese fermentierten Früchte mit Genuss.
Die Primatologen C. Campbell und V. Weaver von der California State University, Northridge, sammelten angebissene Früchte, die von Spinnenaffen in Panama weggeworfen worden waren, und wiesen in diesen Früchten 1–2 % Alkohol nach, der ein Nebenprodukt der natürlichen Hefegärung ist. Durch die Analyse des Urins dieser Affen fanden die Forscher heraus, dass der Urin sekundäre Metaboliten von Alkohol enthält. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass die Tiere fermentierte Früchte zur Energiegewinnung nutzten.
Später untersuchten C. Campbell gemeinsam mit R. Dudley und A. Maruo die Ernährung von Schimpansen in Uganda, um R. Dudleys Hypothese des „betrunkenen Affen“ zu untermauern. Die Beobachtung der Tiere ermöglichte den Nachweis von Ethanol in ihrer Nahrung, und auch in ihrem Urin wurde eine bestimmte Menge Alkohol festgestellt. Jedoch wurden keine ernsthaften behavioralen oder physiologischen Folgen des Konsums überreifer Früchte beobachtet. Die von den Affen bevorzugten Früchte wiesen Alkoholkonzentrationen auf, die mit denen in leichtem Bier oder Cidre vergleichbar sind. Ein Beispiel hierfür sind die Früchte des Jambulabaums.
C. Campbell stellte die Vermutung auf, dass Affen aus fermentierten Früchten mehr Kalorien beziehen als aus nicht-fermentierten, und je mehr Kalorien, desto mehr Energie. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Priorität bei der Fruchtwahl bei unseren menschlichen Vorfahren ähnlich gewesen sein muss; sie zogen Früchte vor, die mit Ethanol angereichert waren, weil sie dem Organismus mehr Energie lieferten.
Allerdings hegte die Forscherin K. Milton Zweifel an der Hypothese des Biologen R. Dudley und veröffentlichte einen kritischen Beitrag zu seiner Studie im Journal „Integrative and Comparative Biology“. K. Milton behauptet in ihrem Artikel, Ethanol schrecke Primaten eher ab, als dass es sie anziehe. Früchte mit einem höheren Ethanolgehalt würden sowohl von Menschen als auch anderen Primaten gemieden, wobei man sich gerade am Geruch orientiere. K. Milton bemerkt skeptisch, dass Ethanol keinen Nutzen biete, es handele sich schlichtweg um ein angenehmes Toxin. Sie stellte eine eigene Theorie zur menschlichen Anziehungskraft des Ethanols auf, deren Kern darin besteht, dass den Menschen – im Gegensatz zu Primaten – die angeborene Weisheit in Bezug auf Ernährungsgewohnheiten fehle. Die menschliche Kultur habe Alkohol über Jahrtausende fermentiert, und durch die Erfahrung vorheriger Generationen hätten die Menschen gelernt, ihn zu schätzen. Nach Miltons Auffassung hat die Ursache für diese Anziehungskraft nichts mit Ernährung oder Gesundheit zu tun; vielmehr streben Menschen nach Substanzen, die ihr Bewusstsein verändern können.
Wenn die Sachlage bei Primaten einigermaßen klar ist, so verhält es sich mit afrikanischen Elefanten bis heute weniger eindeutig. Im Jahr 2006 beschlossen die Wissenschaftler S. Morris, D. Humphries und D. Reynolds, den Mythos der betrunkenen Elefanten im südlichen Afrika zu widerlegen. Afrika ist ein durchaus exotisches Land, das verschiedenste verschlungene, skurrile Folkloregeschichten hervorbringt, und die Geschichte von den betrunkenen Wildelefanten ist eine davon. Die Annahme, dass afrikanische Elefanten betrunken werden, indem sie die Früchte des Marulabaums verzehren, ist eine amüsante Anekdote für Touristen, die Presse und sogar für wissenschaftliche Abhandlungen. Nach Ansicht von S. Morris mag ein Elefant gelegentlich Marulafrüchte fressen, doch gibt es keine eindeutigen Beweise für eine Trunkenheit von Elefanten in freier Wildbahn. Nach Berechnungen der Wissenschaftler, die die menschliche Physiologie zum Vergleich heranzogen, müsste ein 3000 kg schwerer Elefant etwa 10 bis 27 Liter 7-prozentigen Ethanols zu sich nehmen, um einen Zustand veränderten Verhaltens durch Trunkenheit zu erreichen.
Marulafrüchte enthalten etwa 3 % Ethanol. Ein Elefant, der sich normalerweise abwechslungsreich ernährt, könnte aus diesen Früchten durchschnittlich 0,3 g/kg aufnehmen, was nur halb so viel ist wie für eine Berauschung nötig wäre. So blieb die Hypothese, dass Elefanten sich durch Marulafrüchte „betrinken“, unbestätigt.
Doch dieser Mythos lässt Wissenschaftler seit vielen Jahren keine Ruhe, und so beschlossen Forscher aus Botswana im Jahr 2023, in die Fußstapfen von S. Morris und seinen Kollegen zu treten und den Mythos der Vergiftung wilder afrikanischer Elefanten durch Marulafrüchte im südlichen Afrika zu entkräften. T. Makopa und G. Modikwe sammelten gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern Marulafrüchte auf einer Fläche von über 800 km² in Botswana und isolierten etwa 160 Hefestämme von diesen Früchten. In der Regel fermentieren etwa 93 % dieser Isolate einfache Zucker und produzieren Ethanol. Der Ethanolgehalt in den Marulafrüchten war in seinen Merkmalen derart beschaffen, dass ein Einfluss großer Mengen auf das Verhalten von Elefanten in der Natur nahelag, doch zur Widerlegung des Mythos der betrunkenen Elefanten reichten die Daten einer einzelnen Studie nicht aus. Der Mythos der Elefanten, die betrunken werden und sich schlecht benehmen, nachdem sie Marulafrüchte gefressen haben, bleibt ungelöst und wird im modernen südafrikanischen Brauchtum weiterhin erfolgreich gepflegt.
Während die Sachlage bei Elefanten vorerst unklar bleibt, ist sie bei Honigbienen eindeutiger. Die amerikanischen Wissenschaftler I. Ahmed, C. Abramson und U. Faruq machten darauf aufmerksam, dass bereits das Verweilen von Honigbienen im Flug in der Nähe einer Ethanolquelle – ja, schon ihr bloßer, flüchtiger Vorbeiflug an einer offenen Ethanolquelle – Veränderungen in der Kinematik des Bienenkörpers und ihrer Flügel bewirken kann.
Um signifikante Veränderungen der Körper- und Flügelbewegungen von Honigbienen unter dem Einfluss von Ethanol-Dämpfen in der Nähe der Quelle festzuhalten, setzten die Wissenschaftler vier Hochgeschwindigkeitskameras (9000 Bilder/Sek.) ein. Mithilfe statistischer Analysewerkzeuge untersuchten die Beobachter die kinematischen Veränderungen von Körper und Flügeln der Bienen, die durch ansteigende Ethanol-Konzentrationen von 0 % bis 5 % verursacht wurden. Im Allgemeinen verändert sich bei den Bienen der Rollwinkel des Körpers, es zeigt sich eine Abnahme der Flügelschlagfrequenz, und zugleich nimmt die Amplitude der Flügelschläge zu. Allerdings geben die Forscher keinen Aufschluss darüber, aus welchem Grund dies geschieht: ob die Bienen betrunken sind oder ob andere Ursachen zugrunde liegen.
Bereits im Jahr 2006 jedoch wies der slowenische Wissenschaftler J. Božič zusammen mit einem Team anderer Forscher, die das Verhalten betrunkener Bienen untersuchten, auf einen Zusammenhang zwischen steigendem Ethanolgehalt im Körper der Biene und veränderten Verhaltensreaktionen hin. J. Božič und seine Kollegen C. Abramson und M. Bedenčič dressierten Honigbienen darauf, Futterstellen anzufliegen, die Saccharose sowie 1–10 % Ethanol enthielten. Bei der Beobachtung des Verhaltens der „betrunkenen“ Bienen entdeckten die Wissenschaftler bei ihnen eine Störung der Verhaltensabläufe innerhalb des Bienenstocks.
Durch einen bestimmten Satz von Bewegungen, einen eigentümlichen Tanz, kommunizieren die Bienen miteinander und übermitteln sich so gegenseitig Informationen. Unter Alkoholeinfluss nahm die Aktivität der Schwänzeltänze als Muster des natürlichen Verhaltens bei den Bienen ab, während die Häufigkeit der Zittertänze zunahm. Zudem tauschten die „betrunkenen“ Bienen häufiger Nahrung untereinander aus als ihre Artgenossen und führten die Rituale der Körperreinigung etwas öfter durch. Die Verhaltensänderungen von Honigbienen unter Ethanol-Einfluss spiegeln die Wirkung des Alkohols auf ihr Nervensystem wider. Ein ähnliches Verhalten zeigt sich bei Insekten bei Vergiftungen mit subletalen Dosen von Insektiziden.
Im Jahr 2018 wiederum beleuchteten K. Miller, K. Kuschewska und W. Priwalowa in ihrer Studie über die Auswirkungen von Ethanol auf Honigbienen die Besonderheiten der adaptiven Reaktionen der Insekten.
Die Honigbiene wird von Wissenschaftlern häufig als einfaches wirbelloses Modell für alkoholbezogene Forschungen genutzt. Bislang wurden an Honigbienen mehrere Folgen von Alkoholkonsum demonstriert, doch der Effekt der Toleranz gegenüber Ethanolkonsum als eines der Anzeichen von Alkoholmissbrauch wurde lange Zeit in wissenschaftlichen Experimenten nicht nachgewiesen.
Polnische Wissenschaftler bestätigten die Hypothese, dass die Reaktion auf Ethanol im Hinblick auf motorische Störungen bei jenen Bienen geringer ist, die zuvor bereits Alkoholeinfluss ausgesetzt waren. Bienen, die zum ersten Mal alkoholisiert wurden, zeigten den Rauscheffekt, ausgedrückt in Bewegungsstörungen, deutlicher. Die gewonnenen Daten erlaubten den Wissenschaftlern den Schluss, dass Bienen mit der Zeit eine Toleranz gegenüber Alkoholeinfluss entwickeln, und dies könnte hypothetisch ein Anzeichen für Alkoholmissbrauch sein. Theoretisch, übertrüge man das Bienenverhalten auf das menschliche Verhalten: Könnten Bienen mit steigender Alkoholtoleranz folglich abhängig werden?
Den Höhepunkt der Geschichte mit den betrunkenen Bienen bildet die Forschung der polnischen Wissenschaftler M. Ostap-Chek, M. Opalek, D. Stek und K. Miller, die nachweist, dass Bienen tatsächlich Anzeichen eines Katers aufweisen.
M. Ostap-Chek und seine Kollegen erforschten die Besonderheiten der Ausprägung von Alkoholismus bei Honigbienen und beobachteten das Auftreten von Entzugssyndromen bei den Insekten. So zeigten Arbeiterbienen, die über längere Zeit Nahrung mit Alkoholzusatz zu sich genommen hatten, nach dem Entzug des Zugangs zu dieser Nahrung ein ausgeprägtes Suchverhalten und ein deutliches Streben nach sofortigem Ethanolkonsum, sobald sie wieder Zugang dazu erhielten. Die Forscher verzeichneten zudem einen leichten Anstieg der Sterblichkeit unter den Bienen als Folge des Entzugs und des darauffolgenden erneuten Alkoholzugangs.
In der Menschenwelt stellt Suchtverhalten ein Verhalten dar, bei dem ein Mensch, der an Abhängigkeit von Alkohol, Drogen oder einer Verhaltenssucht leidet, nach Möglichkeiten sucht, bewusstseinsverändernde Substanzen zu konsumieren oder bei nichtstofflichen Abhängigkeiten seine Bedürfnisse zu befriedigen. So beginnt ein drogenabhängiger Mensch, sich an Personen zu wenden, die potenziell konsumieren oder wissen, wo verbotene Substanzen zu beschaffen sind. Aus suchtmäßigem Antrieb strebt der Mensch danach, sich mit anderen Konsumenten verbotener Substanzen zu treffen und Möglichkeiten für den Konsum dieser Substanzen ausfindig zu machen.
Doch zurück zur Bienenforschung. Die Ergebnisse der Studie von M. Ostap-Chek und seinen Kollegen zeigten: Nicht nur, dass Bienen eine Alkoholabhängigkeit entwickeln, bei ihnen kann sogar ein Katersyndrom beobachtet werden.
Eine weitere Forschergruppe polnischer Wissenschaftler unter der Leitung von J. Korczyńska und A. Szulc untersuchte im Jahr 2023 die Auswirkungen von Ethanol und Essigsäure auf das Verhalten von Arbeiterinnen der Schmalbrustameise Temnothorax crassispinus. Im Experiment wurde das Verhalten von Arbeiterameisen beobachtet. Eine Gruppe von Ameisen wurde für eine bestimmte Zeit Wattebäuschen ausgesetzt, die mit Wasser getränkt waren, eine andere Gruppe befand sich in der Nähe eines mit Ethanol-Wasser-Lösung getränkten Wattebausches, und eine dritte Gruppe lief in der Nähe eines mit Essigsäure befeuchteten Wattebausches umher. Die Forscher führten gleichzeitig 30 fünfminütige Tests in jeder Gruppe durch.
Ethanol und Essigsäure riefen, nach den Beobachtungen der Wissenschaftler, signifikante Veränderungen in den Bewegungen der Insekten hervor und beeinflussten ihr Erkundungsverhalten, ihre Putzrituale sowie das Aggressionsniveau bei Interaktionen mit Artgenossen. Die Ameisen in der Nähe des essigsäuregetränkten Wattebausches zeigten Abwehrverhalten, wohingegen die Gruppe am ethanolgetränkten Wattebausch eine Verstärkung des Erkundungsverhaltens demonstrierte; unter Ethanoleinfluss begannen die Ameisen unruhig hin und her zu laufen.
In der Wildnis, ohne menschliches Zutun, existiert ein weiteres interessantes Beispiel dafür, wie Ameisen unter den Einfluss einer chemischen Substanz geraten, die ihr Verhalten verändert.
In einem wissenschaftlichen Artikel japanischer Biologen aus dem Jahr 2015 wurden die faszinierenden Wechselbeziehungen zwischen Raupen der Bläulingsunterfamilie und Ameisen beschrieben. Weltweit gibt es etwa 5200 Arten von Bläulingen, die hauptsächlich in den Tropen vorkommen, doch etwa 450–500 Arten haben sich erfolgreich an das Leben in den nördlichen Regionen unseres Planeten angepasst.
Die Raupen der Bläulinge haben sich im Laufe der Evolution daran angepasst, gemeinsam mit Ameisen zu leben. Die in Indonesien, Japan, Taiwan, Südkorea und Nordkorea vorkommenden Bläulingsarten sind Vertreter myrmekophiler Schmetterlinge.
Myrmekophilie bezeichnet die Fähigkeit lebender Organismen, gemeinsam mit Ameisen in einem Nest oder in deren Nähe zu existieren. So sind Myrmekophile Tiere und Insekten, die in der Nähe von Ameisen leben und für eine gewisse Zeit von ihnen abhängig sind.
Die Raupe des in Japan vorkommenden Bläulings scheidet ein Sekret aus, das besondere süße Stoffe enthält, welche Ameisen anziehen. Die Raupen besitzen ein spezielles dorsales Nektarorgan, das dieses Sekret absondert. Dieses Sekret enthält Neuromodulatoren, die die Ameisen veranlassen, auf ihrem „Wachposten“ in der Nähe der Raupe zu verbleiben und sie zu bewachen. Die Ameisen nehmen dieses Sekret auf, und die darin enthaltenen Neuromodulatoren wirken auf ihr Belohnungssystem. So sichert sich die Raupe die Loyalität und den Schutz der Ameisen. Ein derartiger natürlicher Mechanismus der „Zombifizierung“. Die abhängige Ameise kehrt, unter dem Einfluss des Raupensekrets, niemals in ihren Ameisenbau zurück und verwandelt sich in eine Wachameise, die die Raupe vor Angriffen durch Spinnen und Parasiten beschützt. Übrigens beruht die Beziehung zwischen Blattläusen und Ameisen auf einem ähnlichen Prinzip; auch Blattläuse belohnen Ameisen. Die Ameisen schützen die Blattlauskolonien vor Marienkäfern und Florfliegen und verlegen ihre Schützlinge auf saftigere, junge Pflanzen zur Nahrungsaufnahme, während die Blattläuse im Gegenzug den Ameisen Zucker als Produkt ihres Stoffwechsels abgeben – auch dies ein Beispiel gegenseitiger Abhängigkeit zu beiderseitigem Vorteil in der Welt der Insekten.
Suchthaftes Verhalten in Bezug auf Ethanol wurde von Wissenschaftlern sogar bei Fadenwürmern beobachtet. C. Salim, E. C. Caan und E. Baitshan – wissenschaftliche Mitarbeiter der Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie am College of Medicine der University of Tennessee (USA) – untersuchten im Jahr 2022 die Zwanghaftigkeit des Suchverhaltens bodenlebender Nematoden bei der Suche nach Alkohol. Dieser Fadenwurm zeigt unter dem Einfluss bestimmter Neuropeptide zwanghaftes Verhalten bei der Alkoholsuche und gibt seine Versuche immer wieder nicht auf. Unter dem Einfluss anderer Neuropeptide hingegen kann der Wurm eine beständige „Aversion“ gegen Alkoholkonsum entwickeln. Vielleicht werden Wissenschaftler durch eine vertiefte Erforschung der neuropeptidergen Regulation an Tiermodellen lernen, auch beim Menschen eine Abneigung gegen Alkoholkonsum hervorzurufen.
Eine große Anzahl von Studien, die die Wirkung von Alkohol und Rauschgiften untersuchen, führen Wissenschaftler mit Nagetieren durch. Im Jahr 2004 dressierten Mitarbeiter des Charleston Alcohol Research Center in South Carolina (USA) gezielt männliche Labormäuse darauf, zwei Stunden täglich Alkohol (15 % Ethanol) zu trinken.
Während der Versuche hatten die Mäuse durchgängig Zugang zu Futter oder Wasser. Sobald ein stabiler Basislevel des Alkoholkonsums bei den Mäusen etabliert war, setzten die Wissenschaftler sie 16-stündigen Perioden mit Alkoholdampf-Inhalationen aus, gefolgt von 8-stündigen Entzugsperioden ohne Alkoholdämpfe. Insgesamt gab es vier Zyklen à 16 Stunden, unterbrochen von 32-stündigen Pausen. Nach dem letzten Ethanol-Expositionszyklus wurden alle Mäuse beobachtet und fünf Tage hintereinander unter Bedingungen mit eingeschränktem Alkoholzugang auf ihre Alkoholisierung getestet. Nach fünf Tagen erhielten die Tiere eine zweite Serie von Ethanol-Expositionen mit Entzugsperioden, gefolgt von einer weiteren fünftägigen Testphase zur Überprüfung des Mausverhaltens. Zu welchem Ergebnis führte dieses Experiment?
Nach den wiederholten Zyklen chronischer Alkoholexposition und den durchlebten Entzugserfahrungen stieg der Ethanolkonsum bei den Mäusen signifikant stärker an als in den Kontrollgruppen, deren Mäuse keinen derartigen Expositionen ausgesetzt waren und einfach ein mäusetypisches Leben ohne Alkohol führten.
Die an den Alkoholkonsum gewöhnten Mäuse zeigten anschließend ein ausgeprägtes Suchverhalten, nahmen Ethanol bereitwillig und freiwillig auf, wenn es ihnen von den Forschern angeboten wurde. Im Ergebnis wurde bei den Mäusen künstlich eine Verhaltenssucht mit charakteristischen Entzugssyndromen ausgebildet.
Auch in der Wildnis gibt es verschiedene Fälle, in denen Tiere Substanzen, Pilze, Beeren oder Pflanzen zu sich nehmen, an denen Menschen gewöhnlich versterben oder Vergiftungen erleiden. Die Wissenschaftler K. Suetsugu und K. Gomi von der japanischen Universität Kobe machten im Jahr 2021 darauf aufmerksam, dass einheimische japanische Eichhörnchen unbeschadet giftige Fliegenpilze und Knollenblätterpilze verzehren. Knollenblätterpilze und Fliegenpilze spielen eine wichtige Rolle für den Erhalt des Waldökosystems. Der Fliegenpilz ist für die giftigen Eigenschaften seiner halluzinogenen Bestandteile wie Ibotensäure, Muscimol und Muscarin bekannt. Schwere Vergiftungsfälle beim Menschen durch Fliegenpilze umfassen Delirien, Halluzinationen, Krampfanfälle und mitunter sogar tödliche Ausgänge.
Ein typisches Symptom einer Fliegenpilzvergiftung ist die visuelle Verzerrung der Größe von Objekten. Und nun: Heben Sie die Hände, wer Lewis Carrolls Märchen „Alice im Wunderland“ gelesen hat? (Wem es nicht bekannt ist, dem sei es wärmstens empfohlen.)
Erinnern Sie sich an die Begegnung zwischen Alice und der Raupe, die auf dem Hut eines unbekannten Pilzes sitzt und träge eine Wasserpfeife raucht?
All diese Manipulationen mit den Pilzstücken in dem Märchen, die mal zu einer Verkleinerung, mal zu einer Vergrößerung der Körpergröße führen, sind nichts anderes als die Wirkung giftiger Substanzen, möglicherweise eben jenes Fliegenpilzes, auf das menschliche Bewusstsein.
Doch die japanischen Eichhörnchen bleiben nicht nur unversehrt, wenn sie die giftigen Fliegenpilze fressen, sie zeigen auch in ihrem Verhalten keine Anzeichen einer narkotischen Vergiftung durch die Pilze. Die Eichhörnchen haben sich angepasst, giftige Pilze zu essen, doch der Grund dafür ist unbekannt. Wissenschaftler haben die Hypothese, dass die Eichhörnchen als Überträger der Pilzsporen an einen neuen „Wohnort“ fungieren, und um dies zu erforschen, plant K. Suetsugu, die Ausscheidungen der Eichhörnchen zu untersuchen.
Im Gegensatz zu den japanischen Eichhörnchen hatten Hunde in Kentucky weniger Glück, und im Journal of Veterinary Diagnostic Investigation wurde 2019 von den Wissenschaftlern M. Romano, H. Doan und R. Poppenga ein Fall publiziert, in dem ein Labrador aufgrund einer Vergiftung durch Fliegenpilze verstarb. Die Bestätigung einer Pilzvergiftung bei Hunden gestaltet sich in der tiermedizinischen Praxis oft schwierig. Die Aufnahme von Pilzen wird häufig nicht beobachtet, und die klinischen Erscheinungsformen einer Pilzvergiftung sind unspezifisch und möglicherweise auf zahlreiche andere toxikologische oder nicht-toxikologische Ursachen zurückzuführen. Der Vergiftungsfall des Hundes wurde mittels PCR-Test diagnostiziert; die Tierärzte taten alles in ihrer Macht Stehende, doch es gelang nicht, den Rüden zu retten. Dies ist in der Praxis von Tierärzten kein Einzelfall von Fliegenpilzvergiftungen bei Haushunden.





