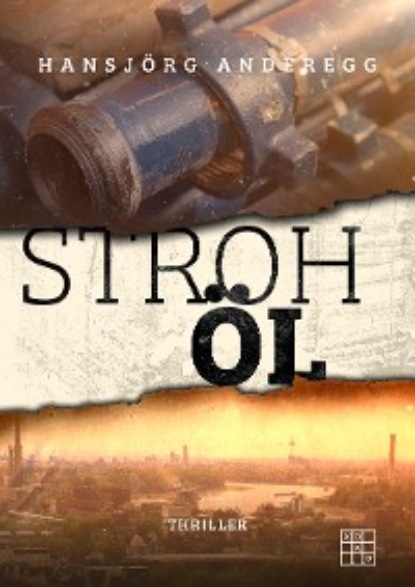- -
- 100%
- +
Dieses Argument leuchtete ihm ein. Er gab ihr einen Schutzhelm und trat ins Freie.
»Sie wissen, was wir hier tun?«
»Ganz grob«, antwortete sie und spielte die Naive. »Sie suchen im Tonschiefer nach Gas. Erklären Sie es mir.«
»Da haben wir schon das erste Missverständnis. Die Gesteinsschicht, in der das Erdgas, vor allem Methan, gebunden ist, hat nichts mit Schiefer zu tun. Es ist eine Schicht aus Tonstein. Die Bezeichnung Schiefergas ist Unsinn. Sie beruht auf einem Übersetzungsfehler.«
»Ach so, und dieser Tonstein befindet sich hier unter unseren Füßen?«
Er nahm ihr die wissbegierige Dilettantin ohne Weiteres ab. Die Kommissarin rückte in den Hintergrund. Es reichte gar für ein verständnisvolles Lächeln, als er antwortete:
»Nicht direkt an dieser Stelle. Wir befinden uns am Rand des Vorkommens. Die Bohrung führt senkrecht unter die undurchlässige Schicht, über der das Grundwasser liegt. Von dort bohren wir horizontal weiter in die Tonschicht hinein.«
»Horizontal?«, unterbrach sie mit großen Augen. »Wie geht denn das?«
»Es ist im Grunde eine alte Technik, die wir heute natürlich mittels Sensoren und Computern wesentlich besser beherrschen. Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen die Auswertungen im Überwachungswagen.«
»Danke, später vielleicht.«
Ihr Interesse galt im Augenblick eher dem Inhalt der vielen Tanks auf dem Gelände. Sie standen bei den Bohrtürmen.
»Also, hier führt die Druckleitung hinunter und stößt dann horizontal in die Tonschicht vor. Das Gestein bekommt durch den Druck Risse. So gibt es das eingelagerte Gas frei, das entlang der Bohrung aufgefangen und an die Oberfläche geleitet wird. Bei den Förderköpfen dort drüben fangen wir es auf und leiten es in die Vorratstanks. Das ist nur eine Versuchsanlage mit Testbohrungen. Deshalb sind wir natürlich nicht an ein Pipelinenetz angeschlossen.«
»Und das funktioniert einfach mit Wasser?«
Wieder lächelte er verständnisvoll. »Wir verwenden ein FracFluid aus Wasser, Sand und Stärke. Im Gegensatz zu klassischen Fracking Anlagen gibt es bei uns keine giftigen Chemikalien. Wir nennen die Methode deshalb ›Clean Fracking‹.«
»Tönt ja sehr fortschrittlich.«
»Ist es auch.«
Er führte sie zu einem Mischwerk nahe der Stelle, wo die Lagerhalle abgebrannt war. Es wies keinerlei Explosionsschäden auf, genau wie alle andern Anlagen, die sie besichtigte. Der Eindruck verstärkte sich, die Täter hätten genau darauf geachtet, nur den Inhalt des Lagers zu vernichten. Warum sollten Umweltaktivisten so etwas tun?
»Hier wird das Wasser mit dem Zusatz gemischt«, erklärte er. »So entsteht das FracFluid.«
»Mit dem Zusatz aus der abgebrannten Halle«, ergänzte sie mit ironischem Schmunzeln.
»Ja, Sie haben recht. Das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Wir werden das Fluid vorderhand fertig gemischt aus Leverkusen beziehen.«
Die Auslagerung des Mischvorgangs und damit die Aufhebung des Lagers für Fracking Zusatz waren also die einzigen technischen Konsequenzen des Anschlags. Auf dem Weg zurück zum Container überraschte sie Kolbe mit der Frage:
»Warum gerade hier, so nahe am Schutzgebiet um den Bodensee?«
»Die Tonschicht verläuft nun mal genau hier entlang – und wie gesagt: Wir betreiben ›Clean Fracking‹ und halten uns an alle Auflagen.«
»Das möchte ich hoffen.«
Die Kommissarin war zurück, Kolbes Misstrauen auch.
»Ich muss Sie bitten, mir alle Arbeitsprotokolle und die Logfiles aus dem Überwachungswagen von der Nacht des Anschlags auszuhändigen. Wir brauchen ein vollständiges Bild der Ereignisse in jener Nacht.«
Nun waren auch Kolbes feindselige Blicke wieder da. Er hatte keine Wahl und wies eine Mitarbeiterin an, die gewünschten Informationen zusammenzustellen. Der dünne Papierstapel sah nicht sehr vertrauenerweckend aus. Sie zweifelte an der Vollständigkeit der Angaben, befasste sich aber zuerst mit der geologischen Karte, die Kolbe bei ihrer Ankunft weggeräumt hatte. Sobald sie allein war im Container, breitete sie die Karte aus. Die Tonschicht verlief in einem breiten Band vom See her nach Nordosten. Wie der Ingenieur behauptet hatte, befand sich das Versuchsgelände am südlichen Rand des Vorkommens. Sie rief das Satellitenbild der Umgebung auf ihrem Handy ab und legte es in Gedanken über die Karte. Zwanzig oder dreißig Stellen waren rot eingekreist, Gebiete, die sich besonders für eine Förderung eigneten. Die Kreise bildeten eine lange Kette, deren größtes Glied jemand durchgestrichen hatte. In diesem Kreis lag das Kloster Mariafeld.
Zehn Minuten später fuhr sie an einem Kornfeld entlang, wo ein Bauer auf dem Traktor dabei war, die Schwaden aus Stroh zu wenden. Sie hielt an, hupte und gab dem Mann Zeichen, dass sie mit ihm sprechen möchte. Er reagierte erst, als sie den Dienstausweis schwenkte.
»Es geht um den Sprengstoffanschlag, stimmt‘s?«, fragte er, kaum abgesprungen.
Er hieß Paul Weber und arbeitete als Gutsverwalter für das Kloster.
»Schon eine ganze Ewigkeit«, betonte er.
Sie brauchte nicht zu fragen. Er schnitt das Thema, das sie interessierte, von sich aus an.
»Wissen Sie, diese Chemie-Mafia will hier alles kaputtmachen. Sehen Sie sich das Land doch an.« Eine ausladende Handbewegung unterstrich sein Argument. »Das ist Landwirtschaftszone, so weit das Auge reicht. Seit vielen Generationen werden hier nachhaltig Getreide, Gemüse und Früchte produziert. Der Boden ist gut und ernährt uns alle zuverlässig. Und da kommen die geschniegelten Rechtsverdreher der Chemie-Bonzen in ihren Nadelstreifenanzügen und wollen den ganzen Landstrich mit Bohrtürmen überziehen.«
»Den ganzen Landstrich? Ich denke, es geht um einzelne Probebohrungen.«
Ein bitteres Lächeln umspielte seinen Mund. »Wäre es nur um diese zwei, drei Löcher gegangen, hätten sie nicht so einen Aufstand um unser Land gemacht. Dreimal waren die Herren Anwälte mit dem Ingenieur beim Prior, aber der hat sich Gott sei Dank nicht breitschlagen lassen. Es gibt eben noch anständige Menschen.«
»Verstehe ich Sie richtig: Die NAPHTAG wollte das Klostergut kaufen?«
»Genau, so heißt die Mafia, NAPHTAG. Sie haben am Ende eine astronomische Summe geboten für den Teil des Guts, auf dem wir jetzt stehen. Wenn Sie mich fragen, geht es denen darum, ein zusammenhängendes Gelände bis hinüber nach Memmingen zu erschließen. Einige Nachbarn haben schon verkauft oder gut bezahlte Vorkaufsrechte überschrieben.«
»Bis nach Memmingen! Das sind mehr als hundert Kilometer, Platz für hundert Förderanlagen.«
»Da sehen Sie es.«
Kolbe hatte nichts dergleichen erwähnt, als handelte es sich bei seinem Unternehmen nur um eine isolierte Probebohrung. Falls die Vermutung des Gutsverwalters zuträfe, könnte sich der Konzern ein Scheitern des Versuchsbetriebs gar nicht mehr leisten. Sie bedankte sich und zog das Telefon aus der Tasche. Es gab Arbeit für den Kollegen Haase. Bauer Webers Angaben bargen Zündstoff. Es lohnte sich, sie unverzüglich zu überprüfen.
Ingenieur Kolbe hatte das Versuchsgelände verlassen, als sie zurückkehrte. Sie benutzte die Gelegenheit, die Techniker an den Bohrtürmen direkt zu befragen. Beim Rundgang mit Kolbe war ihr der große, offenbar unbenutzte Vorrat an Bohrgestängen und Förderrohren aufgefallen. Sie suchte sich den Arbeiter aus, der sich am brennendsten für sie zu interessieren schien.
»Wie es aussieht, sind die Löcher noch nicht tief genug«, scherzte sie.
Der Scherz war offenbar gelungen. Er lachte herzhaft.
»Es täuscht«, sagte er mit dem Blick aufs Materiallager. Er neigte sich zu ihr herüber, dass sein Mund ihr Ohr beinahe berührte und flüsterte: »Der Herr Ingenieur hat sich verrechnet.«
»Wie darf ich das verstehen?«
»Wir sind schon in einer Tiefe von 2‘000 Metern auf ergiebige Schichten gestoßen.«
»2‘000 Meter, aha. Das ist aber ein ganz schön tiefes Loch.«
Er fand auch diese Bemerkung außerordentlich erheiternd.
»Sie haben keinen Schimmer von unserer Arbeit, was?«, platzte er heraus. »Zwei Kilometer sind gar nichts. Normalerweise treiben wir über vier Kilometer vor.«
3‘000 Meter war die gesetzlich erforderliche Minimaltiefe für solche Bohrungen. Das schien der Techniker nicht zu wissen. Kolbe wusste es ganz bestimmt. In seinen Protokollen war die Tiefe mit unbedenklichen 4‘500 Metern angegeben. Sie glaubte nicht an ein Versehen.
Hinz und Rappold hatten die Befragungen abgeschlossen. Die Überprüfung der Alibis für die Tatnacht würde einige Zeit dauern, ebenso wie die noch ausstehenden telefonischen Befragungen der externen Mitarbeiter und Zulieferer. Die bisherigen Ermittlungen ergaben kein einheitliches Bild. Nichts wies eindeutig in die Richtung eines Insider Jobs.
Hinz überraschte sie. Er hatte nicht nur Fotos aller Anwesenden geschossen, sondern auch die Autos auf dem Parkplatz abgelichtet und sie den Angestellten zugeordnet. Der Junge besaß Potenzial.
»Leider keine verdächtigen Fahrzeuge«, fasste er zusammen.
Nicht überraschend: Seine Aktion erfolgte einige Tage zu spät. In der Tatnacht war keinem Kollegen eingefallen, die anwesenden Autos zu kontrollieren.
»Wir fahren dann mal zurück«, sagte Rappold.
Die beiden saßen schon im Wagen, als laute Rufe und Flüche ihre Aufmerksamkeit auf die Förderköpfe lenkten. Dampf zischte pfeifend aus einem Ventil. Arbeiter flüchteten. Warnrufe scheuchten auch die letzten zwei Techniker von ihrem Arbeitsplatz. Der Druck von 400 bar sprengte das defekte Ventil. Es explodierte mit lautem Knall. Geschosse aus Gusseisen schwirrten durch die Luft wie gigantische Querschläger. Alarmsirenen schalteten sich ein. Mitten im Durcheinander entdeckte sie hinter dem Bohrgestänge am Rande des Versuchsgeländes ein geparktes Auto, das Hinz weder erwähnt noch auf einem Foto gezeigt hatte. Sie musste die Unglücksstelle mit dem geplatzten Ventil weiträumig umgehen, um zum Fahrzeug zu gelangen. Von Weitem sah sie eine Gestalt darauf zu laufen.
»Halt, Polizei, bleiben Sie stehen!«, schrie sie aus Leibeskräften.
Die tosende Schlammfontäne, die aus dem Leck in den Himmel schoss, übertönte alle Rufe. Sie verlor die Gestalt für kurze Zeit aus den Augen. Das Rohrlager versperrte den Weg. Fluchend rannte sie ums Hindernis herum. An der Ecke schoss die Schaufel eines Radladers wie das aufgerissene Maul einer Bulldogge auf sie zu. Ein Satz zur Seite in einen Sandhaufen rettete sie in letzter Sekunde.
»Alles in Ordnung?«, rief der Fahrer, ohne anzuhalten.
Er bremste nur leicht ab und beschleunigte sogleich wieder, als er sah, wie sie sich aufraffte. Wütend schüttelte sie den Sand aus den Kleidern, dann rannte sie weiter, den Puls auf hundertachtzig.
Die Gestalt war verschwunden, das Auto auch. Mann oder Frau? Sie konnte es nicht mit Sicherheit sagen. Wagentyp und Kennzeichen blieben unbekannt. Eine schwarze oder dunkelblaue Limousine – mehr hatte sie nicht gesehen. Zu wenig für eine Fahndung, und die Verfolgung war zwecklos. Eine Stunde und unzählige Fragen später war sie kein bisschen schlauer. Niemand wollte den Unbekannten gesehen haben, aber es gab ihn oder sie, immerhin eine neue Erkenntnis.
Der rote Minivan hielt unterhalb des Hügels an. Von hier aus lag einem das ganze Klostergut zu Füßen. Die Luft flimmerte über den abgeernteten Feldern. In der Ferne glitzerte das schmale, silberne Band des Überlingersees. Maria Herzog stieg aus und atmete die trockene Landluft ein, die wie immer um diese Jahreszeit nach frischem Stroh roch. Sie war froh, wenigstens von ihrem Lieblingsplatz aus keine Bohrtürme zu sehen und das Summen der Pumpen nicht zu hören. Die Landschaft und das alte Gemäuer des Klosters hatten sich nicht verändert, seit sie als kleines Mädchen zum ersten Mal auf diesem Platz gestanden hatte. Die Zeit war stehen geblieben. Das erfüllte sie jedes Mal mit einer inneren Ruhe, die sie sonst im Alltag nicht kannte.
Die Marienglocke kündigte das mittägliche Angelusläuten mit drei bedächtigen Schlägen an. Sie war nicht religiös. Dafür war ihr Gehirn zu rational verdrahtet, aber die Jahre im katholischen Waisenhaus und Internat hatten ihr diese Kultur eingeimpft. Für sie war das Glockengeläute ein Stück Heimat wie der Bodensee oder der Zeppelin, der am stahlblauen Himmel surrend seine Runden drehte.
Bauer Weber war auf dem Weg in die Scheune. Seine Maschinen ruhten über Mittag wie früher die Landarbeiter. Er sprang vom Traktor, als sie auf den Hof fuhr.
»Da schau her, die Maria«, rief er freudig.
Für ihn war sie immer noch das Mädchen, das fast jede freie Minute auf dem Hof verbrachte. Er war der Herr Weber geblieben.
»Na, brauchen deine Pferde wieder Stroh?«, fragte er lachend.
Er wusste, dass ihre Pferde mikroskopisch kleine Lebewesen waren, die das Stroh schneller fraßen als ausgewachsene Pferde das Gras. Vorstellen konnte er sich dennoch nichts unter ihrer Arbeit.
»Sie lachen, Herr Weber, aber die Nachbarn haben uns tatsächlich schon gefragt, wann endlich die Pferde kämen.«
»Kann ich gut verstehen.«
Er half ihr, die zwei Strohballen ins Auto zu laden. Bald würde die ›Herzog Green Chemicals AG‹, ihre kleine Start-up Firma, mit einem Lkw vorfahren. Der Sprung vom Forschungslabor zur industriellen Produktion war endlich in Sichtweite gerückt. Sie war überzeugt, den endgültigen Durchbruch in den nächsten Tagen, höchstens Wochen, zu schaffen. Für sie und ihre Forscherkollegen, allen voran Felix Buchmacher, Mitbegründer und unverzichtbarer Partner, würde ein Lebenstraum in Erfüllung gehen. Ein Traum, an den auch die privaten Investoren glaubten, deren Risikokapital ihren Betrieb am Leben erhielt. Sie würden reich belohnt werden, daran zweifelte sie keinen Augenblick.
Bauer Webers Frage unterbrach ihre Gedanken.
»Hast du gehört, was ich gesagt habe?«
»Wie bitte – nein, Entschuldigung.«
»Ihr Akademiker seid ein zerstreutes Volk«, sagte Weber kopfschüttelnd. »Ich habe gesagt, das Stroh koste diesmal nichts.«
»Kommt nicht infrage.«
»Willst du Streit?«, lachte er.
»Was halten Sie davon, wenn ich diese zwei Ballen bezahle, dafür die nächste Ladung geschenkt erhalte?«
Er musterte sie misstrauisch. »Da steckt sicher einer deiner schlauen Schachzüge dahinter.«
»Abgemacht?«
Sie streckte ihm die Hand entgegen. Er schlug zögernd ein.
»Vielen Dank, die nächste Ladung holen wir nämlich mit dem Lkw ab.«
Sie nahm den Handel nicht ernst, er offenbar auch nicht. Mit den Schultern zuckend, sagte er:
»Ich wusste es. Gegen euch Studierte ist kein Kraut gewachsen. Aber egal, vielleicht stehst du das nächste Mal sowieso vor einer leeren Scheune.«
»Wie das?«
»Ich weiß nicht, wie lang der Prior dem Druck der Fracking Mafia noch standhält. Das Kloster ist alles andere als auf Rosen gebettet, und nach der miserablen Ernte im letzten nassen Sommer herrscht Ebbe in der Kasse. Ich müsste dringend das Gebläse erneuern und das Dach ausbessern lassen, aber dafür fehlt das Geld.«
»Sie meinen, Pater Raphael verkauft das Land doch noch an die NAPHTAG?«
»Überraschen täte es mich nicht.«
Die Nachricht schockierte sie. Das Stroh würde sie auch woanders bekommen, falls das Kloster den Getreideanbau aufgäbe. Ihr Problem bestand darin, dass sie den Verheißungen des ›Clean Fracking‹ keine Sekunde traute. Eine solche Industrieanlage praktisch vor der Haustür würde die Qualität der übrigen Güter, die Bauer Weber produzierte, beeinträchtigen. Bio Label ade, Lebensqualität ade. Vor allem aber schockierte sie, dass offenbar nichts und niemand die Profitgier des Petrochemie Giganten stoppen konnte. Weber hörte sich ihre Argumente geduldig an. Am Schluss bemerkte er nur:
»Wem sagst du das.«
Sie musste unbedingt den Prior sprechen. Die Mittagspause verbrachte sie am Telefon mit den Kollegen im Labor in Wollmatingen und ihrer Geliebten. Emma verhielt sich merkwürdig verschlossen seit einigen Tagen. Maria wusste nur, dass sie an einer heißen Story arbeitete, in der die NAPHTAG eine Hauptrolle spielte. Mehr war nicht aus Emma herauszuholen. Wie üblich hielt sie die Geschichte strikt unter Verschluss bis zur Veröffentlichung. »Sonst wird aus der Bombe eine harmlose Verpuffung«, war ihr Argument. Maria hatte kein Problem damit. Sie selbst verhielt sich nicht anders, was ihre Forschungsergebnisse anbelangte. Der entscheidende Unterschied bestand nur in Emmas Tendenz, sich bei ihren Recherchen in unmögliche Situationen zu manövrieren. Kurz bevor die Bombe platzte, steigerte sich die Sorge um Emma zum latenten Unwohlsein. Hörte sie einen halben Tag nichts von ihr, begannen sich die Nerven zu kräuseln, als stünden sie unter Hochspannung. Emma beendete das Gespräch mit dem üblichen Zweckoptimismus:
»Mach dir keine Sorgen. Es ist bald vorbei.«
Pater Raphael, der Prior des Klosters Mariafeld, empfing sie freudestrahlend wie Bauer Weber. Die Sorgenfalten auf seiner Stirn erschienen ihr zahlreicher und ausgeprägter als beim letzten Besuch vor zwei Monaten. Vielleicht bildete sie es sich ein nach dem Gespräch mit Weber, aber die Stimme des Paters bestärkte den Eindruck. Er klang müde, erschöpft, obwohl er sich alle Mühe gab, die gewohnte, unerschütterliche Kraft und Ruhe auszustrahlen, die ihr stets Halt und Zuversicht gegeben hatte. Sie sah in ihm nicht den Priester, den frommen Mönch. Pater Raphael war der gute Onkel, der sich ihrer nach dem Verlust der Eltern angenommen hatte. Ihm verdankte sie die Chance, an der Uni Konstanz das studieren zu können, was sie schon früh in den Bann gezogen hatte: Biologie, die Wissenschaft vom Leben. Er hatte sie letztlich überzeugt, den Schritt in die Selbstständigkeit mit dem Start-up-Unternehmen zu wagen, obwohl auch er sicher keine genaue Vorstellung davon hatte, was sein Schützling zwischen Petrischalen, Bioreaktoren und Chromatografen eigentlich trieb.
»Du hast Stroh geholt, nehme ich an«, sagte er nach der Begrüßung.
Sie nickte. »Die Mikroben brauchen Futter.«
»Eines Tages musst du mir mit den Worten eines Laien erklären, woran ihr arbeitet.«
»Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man von ein paar Einzelheiten absieht. Wir bringen Bakterien dazu, bestimmte Chemikalien aus Biomasse zu erzeugen. Bauer Webers Stroh eignet sich hervorragend als Futter. Unsere Bakterien ersetzen also eine ganze chemische Fabrik.«
»Das hört sich so einfach an.«
»Ganz so einfach ist es schon nicht. Immerhin tüfteln wir schon fünf Jahre daran, und während meiner Doktorarbeit habe ich auch nichts anderes getan. Anfangs wollten die Viecher partout nur in teurem Traubenzucker gedeihen.«
Die Bemerkung rang dem Prior ein Schmunzeln ab.
»Riesling-Sylvaner, vermute ich.«
»So ungefähr.«
»Und jetzt habt ihr die Einzeller umerzogen?«
»Genau das haben wir getan. Ich bin zuversichtlich, dass wir bald eine stabile Population gezüchtet haben, Pater. Vielleicht sieht man es mir nicht an, aber ich bin richtig glücklich.«
»Man sieht es«, beruhigte er lächelnd, »andererseits hattest du schon immer ein sonniges Gemüt. Dafür beneide ich dich.«
Sie ließ den Blick durchs Arbeitszimmer des Priors gleiten. Wie oft hatte sie schon hier gesessen, das große, schwere Kruzifix vor Augen, das zu ihm gehörte wie die Kutte und die Brille mit dickem, schwarzem Rand? Auch dieser Raum veränderte sich nie. Pater Raphael besaß empfindliche Antennen. Ihm entging nicht, dass sie noch etwas loswerden wollte. Lächelnd forderte er sie auf, zu sprechen.
»Ich habe von Bauer Weber erfahren, dass die NAPHTAG Land vom Kloster kaufen will. Er ist sehr beunruhigt.«
Der Prior nickte nachdenklich. »Das kann ich verstehen. Er hängt am Klostergut wie wir alle.«
»Ehrlich gesagt, mache ich mir auch große Sorgen«, fügte sie hinzu.
»Du? Warum solltest du dir Sorgen machen?«
Sie wiederholte die Argumente, die sie schon beim Gutsverwalter vorgebracht hatte. Ähnliches musste Pater Raphael auch durch den Kopf gegangen sein. Er zeigte sich nicht überrascht, dachte aber lange nach, bevor er antwortete:
»Noch ist nichts entschieden.« Nach einer weiteren Pause ergänzte er: »Manchmal lässt einem der Herr nur die Wahl zwischen zwei Übeln.«
»Tun Sie es nicht. Verkaufen Sie nicht an die NAPHTAG, Pater. Ich weiß, es hört sich kindisch an, aber ich kann es nicht anders ausdrücken: Dieser Konzern ist böse. Die NAPHTAG kann sich die besten Anwälte leisten, dass Sie am Ende mit allen Konsequenzen leben müssen, selbst wenn das Fracking Unternehmen Ihr ganzes Grundwasser verseucht.«
»Übertreibst du jetzt nicht ein wenig, Maria?«
Sie schüttelte entschieden den Kopf. »Wir haben mit unserer Firma erlebt, wozu die NAPHTAG fähig ist. Wir haben bei verschiedenen Banken wegen des geplanten Börsengangs angefragt. Anfänglich erhielten wir attraktive Angebote, doch nach kurzer Zeit verabschiedete sich eine Bank nach der andern. Aus technischen Gründen, wie sie behaupteten. Ein paar ehrliche Banker haben uns den wahren Grund genannt. Die NAPHTAG hat gedroht, ihre Bankbeziehung zu beenden, falls sie weiterhin mit uns zusammenarbeiten.«
Der Pater starrte sie ungläubig an. »Warum sollten die so etwas Verwerfliches tun?«
»Weil sie sich bedroht fühlen, noch bevor wir unsere Forschungsergebnisse veröffentlichen. Der NAPHTAG Konzern will jede Konkurrenz im Keim ersticken. Eines Tages wird unsere ›grüne‹ Chemie große Teile der petrochemischen Industrie ersetzen. Davor haben sie panische Angst. Darum treiben sie dieses Fracking Projekt mit allen Mitteln voran, um Fakten zu schaffen und nachhaltige Alternativen wie unsere gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ich fürchte, dazu ist dem Konzern jedes Mittel recht.«
Sie war verstimmt, zornig. Pater Raphael kannte seine Maria so nicht. Jedenfalls ließ sie einen ziemlich verwirrten Prior im Kloster zurück, als sie sich auf den Heimweg machte.
KONSTANZ
Die Studentin sah die chemische Formel, die wie ein fettes Logo auf Felix Buchmachers Arbeitsmappe prangte.
»C4H6O4 – was ist an diesem Molekül so spannend?«, fragte sie provozierend.
»Was wissen Sie über Plattformchemikalien?«, fragte Felix zurück.
»So nennt man Basischemikalien, aus denen viele andere, komplexere Stoffe synthetisiert werden.«
»Das haben Sie schön auswendig gelernt«, sagte er lachend.
Er schob die Probe aus dem Labor in Wollmatingen ins NMR-Impulsspektrometer und schaltete das Gerät ein. Die Start-up Firma war zu klein und sparsam, um sich ein solches Instrument leisten zu können. Deshalb verbrachte er manche Stunde unter Studenten im Chemiegebäude der Uni – und in der Cafeteria. Er deutete auf die Formel und ergänzte:
»Bernsteinsäure ist so eine Basischemikalie. Man verwendet sie zum Beispiel zur Herstellung von Polyester. Lösungsmittel und Weichmacher für Kunststoffe werden daraus produziert. Sogar die Parfümindustrie braucht dieses Molekül.«
Die Studentin zeigte sich unbeeindruckt.
»Und jetzt wollen Sie die Struktur dieses einfachen Moleküls bestimmen?«, fragte sie mit einem ironischen Blick aufs Spektrometer.
Er schüttelte lachend den Kopf. »Die könnte ich im ›Beyer‹ nachschlagen. Nein, junge Dame, was das Instrument gerade analysiert, bleibt mein Geheimnis.«
»Na dann viel Erfolg.«
»Danke, werde ich haben«, murmelte er, während sie zur Tür hinaus rauschte.
Von hinten erinnerte sie entfernt an die Süße mit den Fransen, die ihm in der Cafeteria verstohlene Blicke zugeworfen hatte, wie er glaubte. Er wandte sich mit einem leisen Seufzer wieder dem Computerbildschirm zu, auf dem er den Fortschritt der Analyse kontrollieren konnte. Die Probe im Spektrometer gehörte tatsächlich zum bestgehüteten Betriebsgeheimnis der ›Herzog Green Chemicals‹. An der Struktur dieses Enzyms entschied sich, ob ihre junge Firma eine Zukunft hatte oder nicht. Das Molekül mit dem komplexen räumlichen Aufbau wirkte als Katalysator bei der Herstellung von Bernsteinsäure aus Stroh und anderen Zelluloseabfällen durch die eigens zu diesem Zweck programmierten Bakterien. Ohne Katalysator würde der Traum einer ›weißen Biotechnologie‹ nicht in Erfüllung gehen. Trotz unsicherer Rohstoffversorgung und schwankender Preise bliebe die klassische Herstellung von Basischemikalien und Kunststoffen durch petrochemische Verfahren attraktiver. Nachwachsende Rohstoffe statt Erdöl und Erdgas würden auf absehbare Zeit eine unbedeutende Randerscheinung bleiben. Das Molekül in diesem Spektrometer war die Zukunft – sofern die räumliche Struktur bis in alle Einzelheiten stimmte.