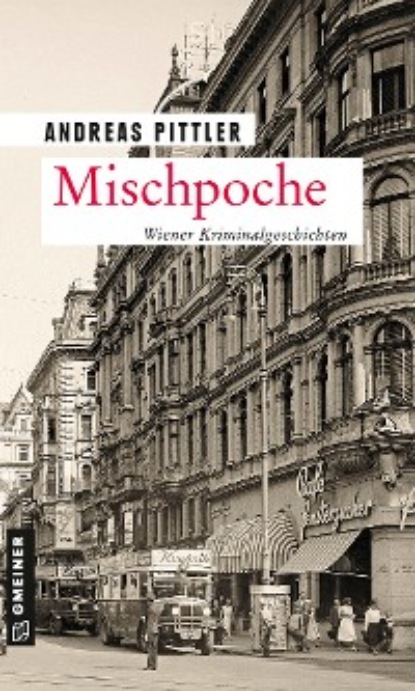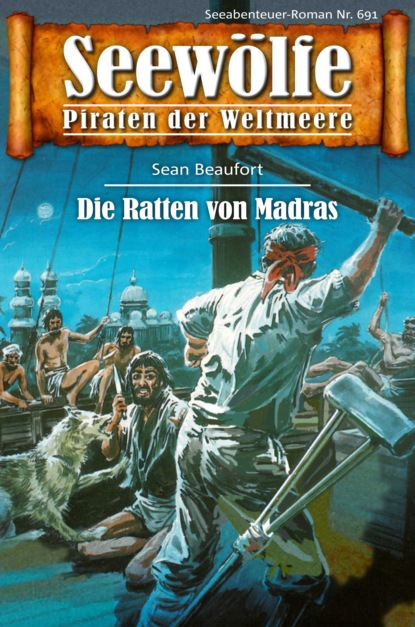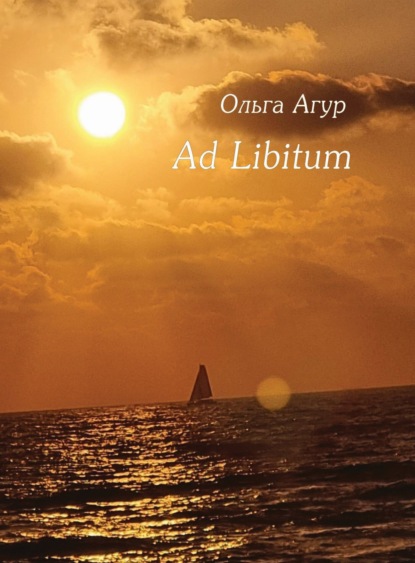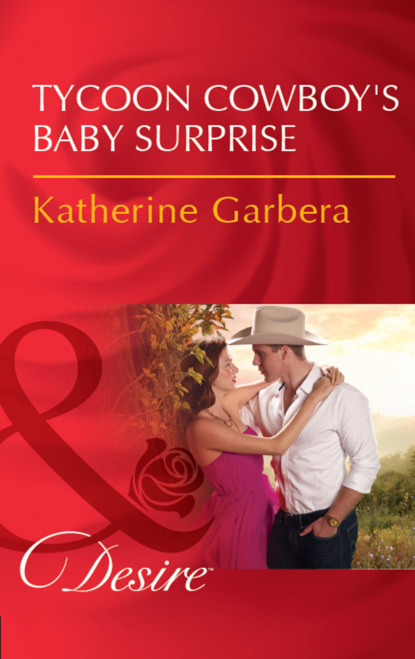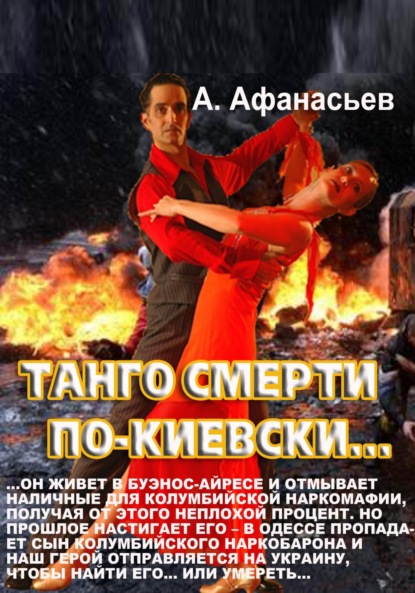- -
- 100%
- +
Innerlich musste ihm Bronstein beipflichten. Wie war er nur auf Beuschel gekommen? In den letzten fünf Jahren hatte er derlei nicht einmal mehr in einem Druckwerk gesehen, geschweige denn in natura. Eine blödere Ausrede war ihm wohl nicht eingefallen.
Zu seinem Glück war’s Johann egal, und so stand wenige Sekunden später ein doppelter Slibowitz auf der Schank.
»Dank dir recht«, murmelte Bronstein und steuerte einen der Tische an, um nicht länger mit dem Wirt Konversation machen zu müssen. Umständlich kramte er sein Zigarettenetui aus dem Inneren seines Sakkos, fingerte mit zittriger Hand einen Glimmstängel heraus und steckte ihn an. Der Rauch beruhigte ihn einigermaßen. Gleich danach kippte er den Schnaps in einem Zug hinunter, und erstmals seit dem morgendlichen Streit mit Jelka wich dieses flaue Gefühl in seinen Eingeweiden. Ein Glaserl noch, und er würde direkt in der Lage sein, sich ein klein wenig zu entspannen, der katastrophalen Lage zum Trotz.
»Heute geben wir’s ihnen«, hörte er einen der Uniformierten am Nebentisch sagen.
»Genau! Dieses Mal erwischen wir sie, und nicht sie uns. Und wir erwischen sie mitten zwischen den Augen.«
Und schon war dieses flaue Gefühl wieder da. Möglichst unauffällig drehte er sich nach den Sprechern um. An dem Tisch saßen drei Polizisten, vor ihnen befanden sich drei Bier, was Bronstein ob seines Slibowitz’ nicht verurteilen wollte. Doch schon auf den ersten Blick erkannte er das ungute Flackern in den Augen der Wachmänner. Kein Zweifel, da war jemand auf Rache aus.
»Sechs von uns haben die Hundling am G’wissen. Und das zahlen wir ihnen heute heim«, bestätigte der erste Uniformierte Bronsteins Verdacht.
Er erinnerte sich. Am Gründonnerstag waren an die 30 Demonstranten, aber eben auch sechs Polizisten Opfer der Gewalttätigkeiten rund um das Parlament geworden. Offensichtlich hatte die Sicherheitswache diese Tatsache noch nicht vergessen.
Es ging also um Vergeltung. Schon den großen Krieg hatte man geführt, weil man nach Rache schrie. Und alle Welt hatte gesehen, wohin eine solche Haltung führte. War die Welt denn immer noch nicht klüger geworden?
»Also es bleibt dabei«, schwor der Rädelsführer seine Kollegen ein, »es wird scharf g’schossen, egal, was die Großkopferten sagen.«
Plötzlich blickte er direkt auf und fixierte Bronstein. Offensichtlich war ihm erst jetzt aufgefallen, dass seine kleine Ansprache belauscht worden war.
»Is’ wos?«, fragte er in aggressivem Ton in Bronsteins Richtung.
»Na, eh nix«, wiegelte dieser ab, »haut’s es den Kummerln ane eine?«
Der Polizist traute ihm sichtlich nicht.
»I war damals a dabei«, würgte Bronstein mühsam hervor, »beim Parlament… Volkswehr! Den Wastl, der was mein Habarer is’, haben s’ mir damals z’samm’g’schoss’n. Der kann heut noch nicht g’rad’ geh’n.«
Bronstein war ehrlich überrascht, wie leicht ihm das Lügen neuerdings von der Hand ging. Wenn er so weitermachte, konnte er glatt Politiker werden.
Der Polizist musterte ihn abschätzend. Schließlich schien er zu dem Schluss zu kommen, ihm trauen zu können.
»Bist a Kriminaler, gell?«, fragte er.
»Ja«, entgegnete Bronstein.
»Und? Hast g’rad’ was vor?«
»Na.«
»Na, dann komm mit. Wir geh’n jetzt in die Hörlgassen. Dort rotten sich diese Gfraster z’samm’. Da wirst Gelegenheit bekommen, deinem Wastl die offene Rechnung zu begleichen.«
Bronstein dämpfte die Zigarette aus und stand auf: »Na dann, gemma’s an.«
Die anderen taten es ihm gleich. Gemeinsam verließen sie erst die Kantine, dann das Gebäude, und Bronstein erstaunte die Ruhe, die er dabei an den Tag zu legen vermochte.
Die Sonne heizte, wie es sich für einen 15. Juni gehörte, die Pflastersteine auf, und unwillkürlich kniff Bronstein die Augen zusammen. Sie waren noch keine 50 Meter gegangen, als undefinierbarer Lärm zu ihnen drang. An der nächsten Ecke angekommen, sahen sie sich Tausenden Menschen gegenüber, die für das Getöse verantwortlich waren. Bronstein erkannte vereinzelte Schilder, auf denen Botschaften wie ›Freiheit für Hexmann‹ oder ›Lasst Steinhardt frei‹ zu lesen standen, und fragte sich, wie er in diesem Gewühl Jelka finden sollte.
Vom Ring und vom Kai fluteten Einheiten der sozialdemokratischen Stadtschutzwache herauf, die sich anschickten, die Kommunisten in die Zange zu nehmen. Unwillkürlich musste Bronstein an den November des Vorjahres zurückdenken, als er Jelka gerade noch hatte retten können. Würde ihm das diesmal auch gelingen? Er bezweifelte es.
Wäre er nicht so in Sorge um seine Freundin gewesen, er hätte beinahe lachen mögen. Die Historie bewies doch beachtlichen Sinn für Ironie: just jene, die noch vor zehn Jahren von den Repräsentanten der Monarchie niederkartätscht worden waren, schickten sich nun an, ihrerseits Andersdenkende gewaltsam zu unterdrücken. Vielleicht hatte Jelka mit ihrem Sprüchlein ja doch recht, wonach das Sein das Bewusstsein bestimmte. Kaum waren diese Bauers, Renners und Elderschs an der Macht, verhielten sie sich nicht anders wie zuvor die Stürgkh, Auersperg oder Schwarzenberg. Er sehnte sich zurück in jene jungfräulichen Tage seiner Polizeikarriere, da er, noch vollkommen unangekränkelt von jedem Zweifel, alle seine Aufträge aus innerster Überzeugung hatte erledigen können, wo Gut noch Gut und Böse noch Böse gewesen zu sein schien.
Der November 18 war ihm wie ein Aufbruch in eine neue Zeit gewesen, in der endlich alle vor dem Gesetz gleich sein würden, wo es sich niemand mehr richten konnte, sondern wo jeder sein Recht fand, ohne Ansehen der Person. Jetzt aber schien es ihm tatsächlich so, wie Jelka immer behauptete: das Staatsgebäude war nicht erneuert worden, man hatte nur die Tapeten von Schwarzgold auf Blassrot geändert.
Bronstein schüttelte sich. Was machte er da? Er war Polizist und kein kommunistischer Agitator! Solche Gedanken standen ihm gar nicht zu. Er wurde dafür bezahlt, dass er Ruhe und Ordnung aufrecht erhielt, ungeachtet, ob seine Befehle von einem adeligen Burgherrn, einem sozialdemokratischen Bibliothekar oder gegebenenfalls von einem kommunistischen Bergarbeiter kamen. Solange die jeweilige Macht ordnungsgemäß legitimiert war, hatte er ihre Weisungen entgegenzunehmen, und wenn Jelka hundertmal meinte, er müsse zuerst sein eigenes Gewissen befragen, ehe er eine Order ausführte. Der Dienstweg eines Beamten sah eine schier unüberschaubare Zahl an Instanzen vor – aber ein Gewissen befand sich nicht darunter!
»Alsdern, schauts euch um, wer am lautesten krakeelt. Auf den legt’s dann an!«
Bronstein fuhr entsetzt herum. Der Uniformierte hatte offensichtlich tatsächlich einen Tötungsbefehl gegeben. So etwas war, soweit er sich erinnern konnte, nicht einmal in der Monarchie vorgekommen. Doch noch ehe er reagieren konnte, fuhr der Wachmann fort: »Und verteilt euch unter die Stadtwachler. Es schaut besser aus, wenn die Kummerln glauben, die Sozis haben sie z’samm’g’schossen. Da sind wir dann fein raus.«
Bronsteins Verlangen, Jelka aus dem ganzen Schlamassel herauszuholen, wurde immer stärker. Verzweifelt spähte er in die Menge der Demonstranten, und allenthalben meinte er, ihren charakteristischen Rotschopf zu entdecken. Doch nur allzu schnell musste er sich eingestehen, dass er sich getäuscht hatte. Der Ring der Exekutive zog sich allmählich um die Demonstranten zusammen, sodass diese nun wirklich umzingelt waren. Ihre letzte Chance, das erkannte auch Bronstein, bestand darin, den schwächsten Punkt der Polizeikette auszumachen und dort durchzubrechen. Bronstein sah sich nach seinen Begleitern um, doch die waren zwischenzeitlich verschwunden. Er fürchtete, sie könnten die übrigen Wachorgane zu einer unüberlegten Handlung provozieren, und überlegte fieberhaft, wie er auf den Gang der Ereignisse Einfluss nehmen konnte. Tatsächlich schien es, als beratschlagten die in der Falle sitzenden Kommunisten, wie sie sich aus ihrer misslichen Lage zu befreien vermochten, und wie es Bronstein vorausgesehen hatte, wählten sie die Schutzorgane der Stadt Wien als Ziel ihres Befreiungsschlages. Im Laufschritt näherten sich Protestierer der Absperrung und schickten sich sichtlich an, unmittelbar vor der gegnerischen Kette nochmals Fahrt aufzunehmen, um sie allein durch die Wucht ihrer Geschwindigkeit niederzureißen. Womit sie allerdings ebenso wenig wie Bronstein gerechnet hatten, war der Umstand, dass die städtischen Ordnungshüter angesichts der heranstürmenden Menge zu den Waffen griffen. Bronstein, der die Szene atemlos beobachtete, bezweifelte, dass eine Salve über die Köpfe der Demonstranten hinweg die Lage deeskalieren würde. Im Gegenteil, viel eher käme die Menge dadurch erst recht in Rage. Doch der Kommandant der Stadtwache hieß seine Männer anlegen, und Sekundenbruchteile später ertönte die Order zum Abfeuern der Gewehre. Fassungslos sah Bronstein, wie die Uniformierten direkt in die Menge zielten. Schon nach der ersten Salve blieben Dutzende Menschen im Straßenstaub liegen. Gleich danach erhob sich ein infernalisches Heulen und Wehklagen. Bronstein suchte an einer Hausmauer Halt und kämpfte mit seinen Innereien, um sich nicht übergeben zu müssen. Das, so erkannte er, war schlimmer als die Ereignisse im November. Die Menge wogte in nackter Panik hin und her und fand keinen Ausweg. Menschen trampelten über Tote und Verwundete, wurden selbst niedergerissen und verschwanden unter den Füßen anderer, die gleich den Gestrauchelten ihr Heil in der Flucht suchten. Und der Befehlshaber der Stadtwache befahl seinen Leuten nachzuladen.
Bronstein hielt nichts mehr an seinem Platz. Die eben noch aufgekommene Übelkeit war schrankenlosem Zorn gewichen. Nicht einmal im Tierreich biss der Sieger dem Unterlegenen auch noch in die dargebotene Gurgel. In bemerkenswerter Geschwindigkeit erreichte Bronstein den Befehlsstand der sozialdemokratischen Wachorgane.
»Ja, sagen Sie, sind Sie vollkommen wahnsinnig?!«, fauchte er den Offizier an, nachdem er halbwegs zu Atem gekommen war.
Der Mann würdigte ihn keines Blickes. »Bringts mir das Seicherl da weg!«, wies er einige der ihn umstehenden Unteroffiziere an, die sogleich Bronstein unsanft in ihre Mitte nahmen und in Richtung Ring schleiften. Sein Protestgeschrei ging im Lärm und im Chaos unter. Erst etwa 100 Meter vom Platz ihres Kommandanten entfernt warfen dessen Schergen Bronstein auf das Trottoir. Seit Kindheitstagen war er nicht mehr so demütigend behandelt worden, empfand Bronstein. Er rappelte sich auf und setzte den Stadtwächtern nach. Kaum war er an sie herangekommen, drehte sich einer von ihnen blitzschnell um und schlug Bronstein mit dem Lauf seiner Pistole gegen die Schläfe. Bronstein wurde gegen eine Hauswand geschleudert, drehte sich sodann um seine eigene Achse und sank tonlos zu Boden.
Enervierende Kopfschmerzen waren das Erste, das Bronstein registrierte, als er erwachte. Er benötigte eine gewisse Weile, ehe er seine Umgebung genauer in den Blick nehmen konnte. Über ihm befand sich eine weiße Stuckdecke, ihm gegenüber ein hohes, vergittertes Fenster. Links neben ihm stöhnte jemand leise, von der rechten Seite kam ein penetrantes Schnarchen. Bronstein realisierte, dass er sich in einem Krankenhaus befand. Er versuchte, den Kopf zu heben, doch rasende Schmerzen ließen ihn sofort von diesem Vorhaben Abstand nehmen.
»Ah, wer kommt denn da wieder zu sich? Guten Morgen, Herr Oberleutnant.«
Guten Morgen? Wie lange lag er schon da?
»Sie waren ganz schön lange weg! Gestern um 4 hat man Sie eingeliefert. Jetzt ist es schon bald wieder Mittag. Aber bitte, diese Kommunisten haben Sie auch ganz schön zugerichtet. Sie können von Glück reden, dass nichts gebrochen ist. So kommen S’ mit einer mittleren Gehirnerschütterung davon. In zwei, drei Tagen sind S’ wieder auf dem Damm.«
Das waren nicht die Kommunisten gewesen, schoss es ihm durch den Kopf, doch er schaffte es nicht, diesen Gedanken zu verbalisieren. Ein kaum hörbares Röcheln war der einzige Laut, den er zustande brachte. Die Krankenschwester tätschelte behutsam seinen Unterarm: »Jetzt gehen wir es einmal ruhig an, gelt, Herr Oberleutnant? Schlafen S’ Ihnen nur ordentlich aus, dann wird alles wieder gut.«
Alles wieder gut? Wie konnte alles wieder gut werden, wenn er hier ans Bett gefesselt war, während er immer noch nicht wusste, wo sich Jelka befand und wie es ihr ging? Er durfte keine Zeit verschwenden, musste sofort das Spital verlassen, um sich … auf die Suche … nach Jelka … zu machen.
In Panik riss er die Augen auf. Er konnte rein gar nichts erkennen. Erst allmählich registrierte er ein paar Kontraste. Endlich konstatierte er, dass im Raum nur eine einzelne Funzel brannte, die gegen die Dunkelheit der Nacht keine Chance besaß. Wenigstens waren seine Kopfschmerzen deutlich geringer geworden. Er schaffte es, sich aufzurichten, und saß eine kleine Weile aufrecht im Bett, ehe ihm bewusst wurde, dass er zu einer solchen Stunde ohnehin nichts ausrichten konnte. Also legte er sich wieder hin und beschloss, bis zum nächsten Morgen zu warten.
Die Wanduhr am Ende des Zimmers zeigte fünf Minuten nach sieben Uhr, als er erneut erwachte. Er fühlte sich merklich besser und riskierte es, sich aus dem Bett zu erheben. Wie er war, begab er sich auf den Flur und hielt nach einer Toilette Ausschau. Dann ging er zum Schwesternzimmer und verlangte seine Effekten.
»Aber Sie können nicht gehen, Herr Oberleutnant. Sie brauchen noch Ruhe!«
»Ach was, mir geht’s gut. Ich hab’ schon genug Zeit verplempert mit dem Blödsinn da. Geben S’mir einfach mein G’wand, und ich entlass’ mich selbst.«
Die Schwester hatte seinem fordernden Ton nichts entgegenzusetzen, und so hielt sie ihm einfach wortlos den Revers unter die Nase, den Bronstein unterschrieb, ohne den Text des Dokuments zu lesen. Zehn Minuten später stand er auf der Straße und ließ sich von einer Mietdroschke ins Präsidium fahren.
»Ja, Oberleutnant! Dich gibt’s noch! So eine Freud’!« Pokorny schien ehrlich begeistert, seinen Vorgesetzten vor sich zu sehen. »Wir haben schon g’laubt, du schwimmst die Donau abwärts, und die Rumäner fischen dich beim Eisernen Tor aus dem Wasser.«
»Weißt eh, Unkraut vergeht ned«, replizierte Bronstein knapp, um dann sofort zur Sache zu kommen. »Vorgestern. Diese Demonstration da. Hörlgasse und so. Was wissen wir d’rüber?«
»Ned viel eigentlich«, maulte Pokorny, »20 Tote, 80 Verletzte auf Seiten der Kommunisten, keinerlei Verluste auf unserer Seite. Die Demokratie hat auf der ganzen Linie gewonnen. Ich sag’ dir, jetzt geht’s nur mehr aufwärts, wo wir die Extremisten von rechts und links … Sag’, warst du da vielleicht auch dabei?« Pokorny realisierte erst jetzt, warum sein Chef einen ganzen Tag abgängig gewesen war. Doch Bronstein verspürte nicht die geringste Lust, seinem Mitarbeiter die ganze lange Geschichte zu erzählen. Die Information, es seien 20 Menschen getötet worden, ließ ihn erneut in Panik ausbrechen.
»20 Tote? Weiß man auch, wer das ist?«
»Ja, klar, die liegen alle in der Sensengasse. Da …«
Bronstein hörte nicht mehr hin. Er stürzte zum Telefon und ließ sich mit Ferdinand Strakosch, der Institution der Wiener Gerichtsmedizin, verbinden. »Servus, Ferdl. Du, ich hab’ eine ganz wichtige Frage an dich: bei den Toten von vorgestern, ist da eine junge Rothaarige dabei?«
Strakosch verzichtete darauf, die Frage Bronsteins einer inhaltlichen Bewertung zu unterziehen, denn der gehetzte Tonfall seines Gesprächspartners überzeugte ihn davon, dass diesem an der Beantwortung seiner Frage mehr gelegen war als an allfälligen verbalen Geplänkeln. »Ich kann dich beruhigen, so eine ist nicht darunter. Und jung waren überhaupt nur zwei Männer …«
»Und die Verwundeten? Wohin wurden die gebracht?«
»Du, das weiß ich jetzt aber wirklich nicht. Die werden s’ wahrscheinlich auf die diversen Spitäler aufgeteilt haben, nehme ich an. Aber warum …«
»Du, Ferdinand, keine Zeit für Erklärungen. Ich sag’ dir alles, wenn ich wieder einen Überblick hab’. Bis dahin sag’ ich einfach nur danke.«
In den nächsten Stunden hätten Mörder gute Chancen gehabt, mit ihren Verbrechen davonzukommen, denn Bronstein tat nichts anderes, als in sämtlichen Wiener Krankenhäusern nach der Identität der dort eingelieferten Verletzten zu fahnden. Gegen 8 Uhr abends wusste er die Namen von 72 Demonstranten, die sich immer noch in der Obhut eines Spitals befanden. Die übrigen, hieß es, seien nicht so schwer verletzt gewesen, sodass sie in der Zwischenzeit entlassen werden konnten. In polizeilichem Gewahrsam, so hatte er weiter in Erfahrung gebracht, befand sich niemand von denjenigen, die an den Aktionen rund um den 15. Juni teilgenommen hatten. Doch angesichts der Bilanz konnte man wohl davon ausgehen, dass die Sicherheitskräfte von Anfang an die Order ›Keine Gefangenen‹ ausgegeben hatten. Bronstein wusste nicht, ob er nun aufatmen sollte oder nicht. Jelka war weder unter den amtlich festgestellten Toten noch unter den Verwundeten. Allerdings war anzunehmen, dass sie nach einem solchen Massaker kaum nach Hause gegangen war. Wo also sollte er sie suchen?
»Ich weiß, Chef, warum du so dreinschaust«, hörte er plötzlich Pokorny sagen, der, ungeachtet der späten Stunde, noch einmal ins Büro gekommen war. »Aber keine neue Welt wird ohne Schmerzen geboren. Solche Eruptionen gehören halt dazu. Wirst sehen, das wird sich alles einspielen, und dann geht keiner mehr auf den anderen los, dann verläuft wieder alles in geordneten Bahnen.«
Bronstein war nahe dran, Pokorny sein Herz auszuschütten und ihm zu gestehen, dass es ihm nicht um die fragwürdigen Geburtswehen der Republik, sondern nur um seine Jelka ging, doch er schreckte schließlich doch davor zurück.
»Na siehst«, deutete Pokorny Bronsteins Schweigen als Zustimmung zu seinen Thesen, »es wird wieder aufwärts gehen. Jetzt kommen andere Zeiten, in die wir mit Optimismus schreiten.«
»Pokorny, deine Reime überzeugen mich nicht unbedingt. Aber schreiten werd’ ich jetzt auch, und zwar nach Haus’.«
Die ganze Nacht über machte Bronstein kein Auge zu. Unentwegt dachte er an Jelka. Es mochte ja sein, dass die neue Zeit endlich Frieden, Wohlstand und Freiheit brachte, doch ihm wäre es weit wichtiger gewesen, sie hätte ihm Jelka gebracht. In den folgenden Tagen recherchierte er während der Dienstzeit eifrig alle Berichte, die zum vermeintlichen Kommunistenputsch eingelangt waren, stets auf der Suche nach einem Hinweis auf Jelka, während er nach Dienstschluss jeden Ort aufsuchte, an dem Jelka schon einmal gewesen war. Beide Tätigkeiten brachten ihn seinem Ziel keinen Millimeter näher. Und während sich die Kollegen in Elogen auf die Republik ergingen, wurde Bronstein mit jeder Stunde, die ergebnislos verstrich, mutloser.
1920: Jung und Alt
Bronstein malte mit Hingabe einige Schnörkel rund um seine Unterschrift und schloss sodann lächelnd den Aktendeckel. Es war ein befriedigendes Gefühl, einen Fall als gelöst ins Archiv befördern zu können. Denn ein Fall war nicht bloß ein Bündel Papier. Das waren ganz konkrete menschliche Schicksale, die auf tragische Art miteinander verwoben waren. Löste man also einen Fall, dann brachte man immerhin einen Hauch Gerechtigkeit in die Welt, wenn man schon nicht für Wiedergutmachung sorgen konnte. Ein Ermordeter wurde zwar nicht mehr lebendig, aber der Bösewicht, der ihm das Leben genommen hatte, wurde wenigstens seines eigenen Lebens auch nicht mehr froh, was für die Angehörigen des Opfers vielleicht ein kleiner Trost sein mochte. Und als Polizist hatte man leidenschaftslos an die Sache heranzugehen. Die Tatsachen allein zählten. Es oblag den Geschworenen, die Fakten einer Bewertung zu unterziehen. Natürlich hatte man auch als Ermittler eine Meinung zu den Dingen, doch die war privater Luxus und hatte auch privat zu bleiben. Mitunter kam es vor, dass eigentlich das Opfer der Böse war und seinen Mörder durch beständiges Schikanieren zu einer Verzweiflungstat aufgestachelt hatte. Gleichfalls geschah es immer wieder, dass der Verbrecher einfach schwachsinnig war und die Tragweite seines Tuns gedanklich gar nicht erfassen konnte. Doch Gewalttat blieb Gewalttat, vor der Polizei waren tatsächlich alle, die das Gesetz brachen, gleich. Und daher hatten eben auch allfällige Emotionen seitens der Behörde zu unterbleiben. Im Strafrecht gab es eben nur Schwarz oder Weiß, da war kein Platz für Grautöne. Entweder, jemand hatte eine Untat begangen, oder er hatte sie nicht begangen. Und wenn er sie begangen hatte, dann war er schuldig. In welchem Ausmaß er das war, hatte den Polizisten nicht mehr zu interessieren. Das musste das Gericht entscheiden.
Bronstein war ehrlich überrascht über seinen philosophischen Gedankenflug. Er hätte ihn gleich mitschreiben sollen, denn das wäre ein hervorragender Vortrag für die Polizeischule gewesen.
Und Vorträge zu halten hatte er wahrlich genug. Jede Woche trafen – immer noch – neue Polizeiangehörige aus allen Ecken und Enden der ehemaligen Monarchie in Wien ein, die auf ihren unkündbaren Beamtenstatus beim Ministerium des Inneren pochten. Als die Regierung Renner damals zugesichert hatte, jeden Staatsdiener, der es wünschte, weiterhin in Dienst zu halten, mochte niemand damit gerechnet haben, dass die Betroffenen dieses Versprechen ernst nahmen. Doch mittlerweile arbeiteten in den Reihen der Wiener Polizei mehr Provinzler als Wiener. Allesamt waren sie stramm deutschnational, schmetterten bei jeder Gelegenheit ›Lieb Vaterland magst ruhig sein‹, und alle hießen sie Kapuszczak, Narutinsky, Woprschalek oder Szentszerenyi. Und sie redeten so, wie sie hießen. Selbst Pokorny vermochte aus ihnen nicht schlau zu werden. »Doch, doch«, pflegte er dann immer zu sagen, »ich glaub ihnen schon, Herr Kollege, dass Sie Deutsch reden. Es ist halt nur nicht das Deutsch, das ich verstehe.« Bronstein hatte da schon weit weniger Geduld mit Germanias Zier: »Die wollen die Wacht am Rhein singen?«, hieß es von seiner Seite, »denen sing ich sie. Aber gach a no!«
Und als wäre ihre seltsame Sprache und ihre protzige Deutschtümelei noch nicht schlimm genug, war Bronstein Woche für Woche gezwungen, sich mit diesem von der Weltgeschichte vergessenen Haufen im Wege der Ausbildungskurse auseinanderzusetzen. Vergeblich appellierte er immer und immer wieder an seine Vorgesetzten, diese verkrachten Dorfgendarmen bloß nicht in den Außendienst zu lassen, doch deren Replik, was sollten diese Kollegen im Innendienst, da müssten sie Akten lesen, und das sei bei Weitem das größere Problem, hatte zu Bronsteins Bedauern sehr viel für sich.
Seitdem waren also die Kapuszczaks, Narutinskys, Woprschaleks und Szentszerenyis der Stolz der Wiener Sicherheitsdirektion. Und so kam es, dass einer von ihnen, Siegfried Kapuszczak aus Stanislau, bei Bronstein vorstellig wurde.
»Härr Leitnont, Oberleitnont, Härr! Bin gangen von Revier zu Tatort, weil gerufen dort zu gehen. Opfer lebt, aber verletzt schwer.«
»Sagen S’ einmal, wollen S’ mich pflanzen?«
»Pflanzen? Bitte, nicht verstehe, was meint!«
Bronstein atmete tief durch. »Welches Revier, welcher Tatort? Wer hat was gerufen?«
In Kapuszczak schienen die richtigen Zahnräder ineinanderzugreifen.
»No, Bezirk Chitzing. Tatort Zechetna Ulic… Gosse. Gerufen hat, bitte schen, Telefon.«
»Aha«, Bronstein rekapitulierte, dass es sich um die Zehetnergasse im 13. Wiener Gemeindebezirk handeln musste. Und das Bezirkskommissariat Hietzing war offensichtlich benachrichtigt worden, dass es dort zu einer Gewalttat gekommen war. Weshalb ihn dies etwas angehen sollte, wo das Opfer doch offensichtlich lebte, verstand er allerdings nicht. Die Mordkommission kontaktierte man, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ein Mord vorlag. Und das schien ja wohl nicht der Fall zu sein. Wenn bei jeder Wirtshausschlägerei mit Verletzten die Abteilung Leib und Leben ausrücken würde, dann käme er nie mehr dazu, einen Aktendeckel zu schließen.
»Und was geht uns das an?«, bellte er ins Telefon.
»Bitte schen, ist versuchte Mord.«
»Sagt wer?«
»Sagt Opfr!«
Bronstein verdrehte die Augen und flehte zu Gott, er möge ihn mit Geduld segnen. Dann blickte er auf die Uhr. In wenigen Minuten war es vier. Den gemütlichen Nachmittag im Schweizerhaus konnte er vergessen. Dabei war es so ein schöner Tag!
»Pokorny!« Bronsteins Stimme donnerte durch den Raum.
»Was liegt an, Chef?« Pokorny, bereits fix und fertig angekleidet, stand in der Zimmertür.