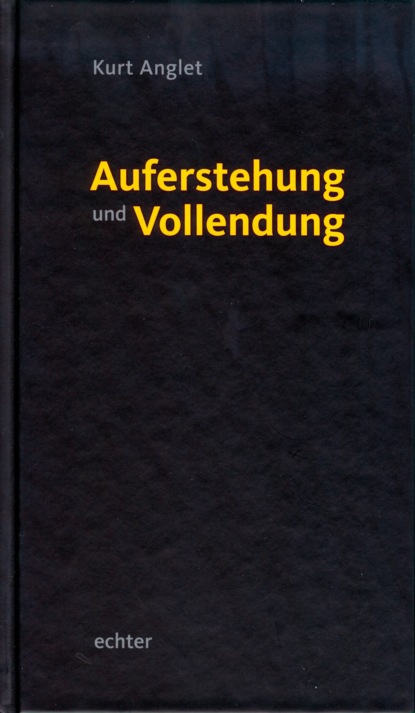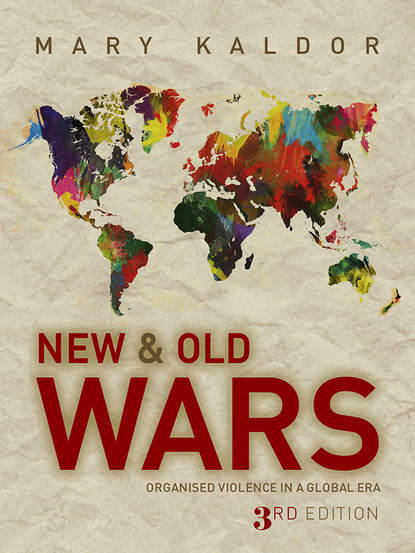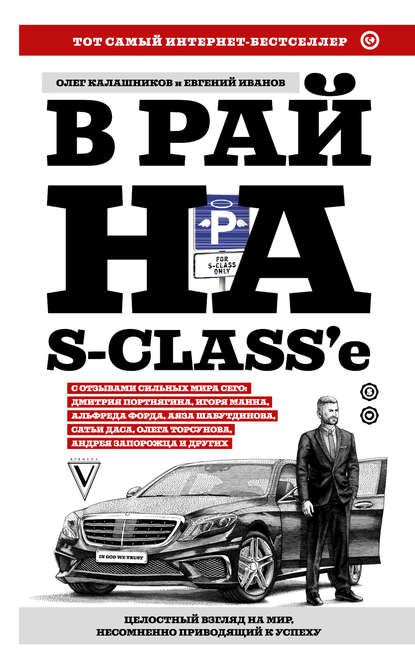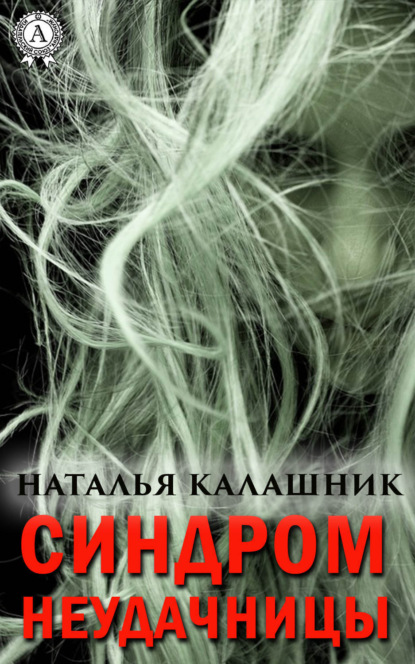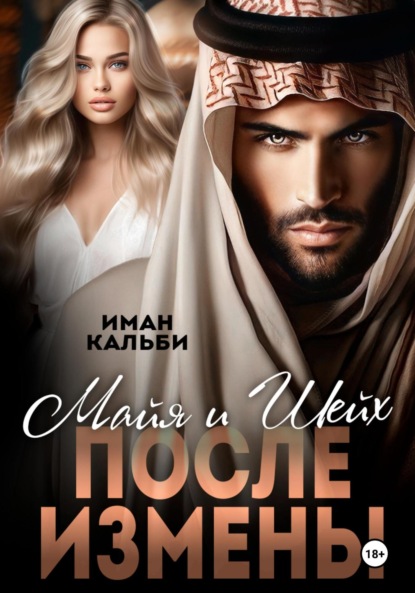- -
- 100%
- +
Ebenso wenig bei Nietzsche, dem der Rückzug ins tragische Zeitalter der Griechen, hinter das Christentum und die metaphysische Grundlegung der menschlichen Vernunft bei Platon und Aristoteles, verstellt ist, um als »dionysische Wahrheit«, wie »die Mysterienlehre der Tragödie« seiner »Geburt der Tragödie« lautet, »das gesammte Bereich des Mythus als Symbolik ihrer Erkenntnisse« zu übernehmen (vgl. KGA III.1,69), gewissermaßen das Gegenprogramm zu Bultmann. Allerdings übernimmt sich dabei »die heraklesmässige Kraft der Musik« (vgl. ebd.) buchstäblich; muss doch Nietzsche nur wenig später – in einem nachgelassenen Fragment vom Winter 1872–73 – einräumen, dass es sich bei jener »Wahrheit« des tragischen Mythos in Wahrheit um den Eindruck handelte, »den eine Tristanaufführung im Sommer 1872 auf mich hervorbrachte« (KGA III.4,167). M. a. W., er datiert auf ein modernes Kunstprodukt, auf Wagners Musikdrama zurück. Nicht weniger artifiziell erweisen sich alle »Ursprungswahrheiten« unseres Zeitalters, so Heideggers Deutung des Seinsgeschehens aus dem Geist der Vorsokratiker: eine mehr als dürftige Bemäntelung des eigenen Abfalls von dem Einen Gott der Offenbarung, der bekanntlich neben sich keine anderen Götter duldet – auch keine Halbgötter. Heißt es doch in einem Gerichtspsalm (Ps 82,6–7):
»Wohl habe ich gesagt: Ihr seid Götter,
ihr alle seid Söhne des Höchsten.
Doch nun sollt ihr sterben wie Menschen,
sollt stürzen wie jeder der Fürsten.«
Nicht umsonst mahnt der heilige Johannes am Ende seines ersten Briefes: »Meine Kinder, hütet euch vor den Götzen!« (1 Joh 5,21). Denn es gehört zu den fatalsten Missverständnissen einer historistisch gestimmten Moderne, die Götzen allein in der Vorwelt des Mythos zu suchen, als dessen Relikte dann gar die wunderbare Geburt Jesu Christi, seine Auferstehung und Himmelfahrt durchschaut werden. »Es giebt mehr Götzen als Realitäten in der Welt: das ist mein ›böser Blick‹ für diese Welt, das ist auch mein ›böses Ohr‹ «, vermerkt Nietzsche im Vorwort zu seiner »Götzen-Dämmerung« (vgl. KGW VI.3,51). Sie steht neben Wagners Götterdämmerung, zu ihr sollte sich später die »Ergötterung« Heideggers hinzugesellen, der in seinem sog. zweiten Hauptwerk »Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)« erklärt: »Von den Göttern her das seynsgeschichtliche Denken begreifen ist aber ›das selbe‹ wie der Versuch einer Wesensanzeige dieses Denkens vom Menschen aus« (ebd. 439). Genau diesen Versuch hat Nietzsche vollzogen, wenn er in dem besagten Vorwort vorab konstatiert: »Kein Ding geräth, an dem nicht der Übermuth seinen Theil hat. Das Zuviel von Kraft erst ist der Beweis der Kraft. – Eine Umwerthung aller Werthe, dies Fragezeichen so schwarz, so ungeheuer, dass es Schatten auf Den wirft, der es setzt – ein solches Schicksal von Aufgabe zwingt jeden Augenblick, in die Sonne zu laufen, einen schweren, allzu schwer gewordnen Ernst von sich zu schütteln. Jedes Mittel ist dazu recht, jeder ›Fall‹ ein Glücksfall. Vor Allem der Krieg. Der Krieg war immer die grosse Klugheit aller zu innerlich, zu tief gewordnen Geister; selbst in der Verwundung liegt noch Heilkraft.« In nichts anderem gründet eine Philosophie der Verblendung (»in die Sonne zu laufen«) oder wie Nietzsche abschließend zu verstehen gibt: »Diese kleine Schrift ist eine grosse Kriegserklärung« (vgl. ebd. 52). Und dass es Nietzsche damit durchaus ernst meint, geht aus dem Abschnitt 3 des Kapitels »Was ich den Alten verdanke« hervor: »In den Griechen ›schöne Seelen‹, ›goldene Mitten‹ und andre Vollkommenheiten auszuwittern, etwa an ihnen die Ruhe in der Grösse, die ideale Gesinnung, die hohe Einfalt bewundern – vor dieser ›hohen Einfalt‹, einer niaiserie allemande zuguterletzt, war ich durch den Psychologen behütet, den ich in mir trug. Ich sah ihren stärksten Instinkt, den Willen zur Macht, ich sah sie zittern vor der unbändigen Gewalt dieses Triebs, – ich sah alle ihre Institutionen wachsen aus Schutzmaassregeln, um sich vor einander gegen ihren inwendigen Explosivstoff sicher zu stellen. Die ungeheure Spannung im Innern entlud sich dann in furchtbarer und rücksichtsloser Feindschaft nach Aussen: die Stadtgemeinden zerfleischten sich unter einander, damit die Stadtbürger jeder einzelnen vor sich selber Ruhe fänden. Man hatte es nöthig stark zu sein: die Gefahr war in der Nähe –, sie lauerte überall. Die prachtvolle geschmeidige Leiblichkeit, der verwegene Realismus und Immoralismus, der dem Hellenen eignet, ist eine Noth, nicht eine ›Natur‹ gewesen. Er folgte erst, er war nicht von Anfang an da. Und mit Festen und Künsten wollte man nichts Andres als sich obenauf fühlen, sich obenauf zeigen: es sind Mittel, sich selber zu verherrlichen, unter Umständen vor sich Furcht zu machen … Die Griechen auf deutsche Manier nach ihren Philosophen beurtheilen, etwa die Biedermeierei der sokratischen Schulen zu Aufschlüssen darüber benutzen, was im Grunde hellenisch sei! … Die Philosophen sind ja die décadents des Griechenthums, die Gegenbewegung gegen den alten, den vornehmen Geschmack (– gegen den agonalen Instinkt, gegen die Polis, gegen den Werth der Rasse, gegen die Autorität des Herkommens)« (ebd. 151). Das ist Nietzsches wahres Gesicht – nicht das schönfärberische der gegenwärtigen akademischen Nietzsche-Rezeption: ein Gesicht, hinter dessen Griechenbild sich das Gesicht des Deutschen der wilhelminischen Ära verbirgt, mag Nietzsche selbst buchstäblich bis zuletzt Ressentiments gegen deren Repräsentanten und die Deutschtümelei seiner Zeitgenossen gehegt haben.
Denn auf die »grosse Kriegserklärung« der »GötzenDämmerung«, die im Jahre 1889 erschienen ist, folgt eine weitere, letzte: Todkrieg dem Hause Hohenzollern, der sich zweimal eine Letzte Erwägung anschließt (vgl. KGA VIII.3,457–461). Es handelt sich um Nietzsches letzte Aufzeichnungen vor seiner Umnachtung, in denen er, als wäre der Erste Weltkrieg in greifbarer Nähe, mit Bismarck und dem Hause Hohenzollern als Kriegstreibern abrechnet. [Wir haben das betreffende Fragment wiederholt zitiert, von unserer Nietzsche-Dissertationsschrift »Zur Phantasmagorie der Tradition« bis zu unserer letzten Abhandlung »Vom Kommen des Reiches Gottes« – à propos »Reich Gottes«, zu dem Nietzsche in der »Götzen-Dämmerung« nichts weiter einfällt als unter dem Abschnitt 4 von »Moral als Widernatur« die Feststellung: »Das Leben ist zu Ende, wo das ›Reich Gottes‹ anfängt …« (KGA VI.3,79).] Dabei sollte in jenen Jahren nur mehr der »Explosivstoff« zünden, den der »Psychologe« Nietzsche am Wesen des Griechen rühmte: »Die ungeheure Spannung im Innern entlud sich dann in furchtbarer und rücksichtsloser Feindschaft nach Aussen« – nur waren es nicht mehr die Stadtgemeinden, die sich untereinander zerfleischten, sondern die alten Kulturvölker Europas. Obschon Nietzsche auftrumpft, als hielte er die Welt in den Händen, zeigt sich hier das ganze Ausmaß geistiger Verwirrung über die sich abzeichnende eigene Pathologie hinaus: Da wird für das Leben Partei ergriffen unter der Verherrlichung des Krieges, um dann, als der Krieg realiter in greifbare Nähe rückt, den maßgeblichen politischen Kräften ebenjene Schuld zuzuschieben, die der »Psychologe« Nietzsche zuvor – wie auch das menschliche Gewissen – nach Kräften geleugnet hat. Nur von Heidegger, der immerhin auf den Ersten Weltkrieg zurückblickte, ist solcher Widersinn noch überboten worden, ob in Affirmation des schuldhaften Gewissens in »Sein und Zeit« oder in der Verherrlichung des Todes als »das höchste und äußerste Zeugnis des Seyns« in seinem zweiten Hauptwerk »Beiträge zur Philosophie« (vgl. ebd. 284). Immerhin hat Nietzsche die Tendenz dorthin relativ früh, in einem nachgelassenen Fragment vom Herbst 1880, erkannt: »Das höchste Todesziel der Menschheit auszudenken – irgendwann wird sich die Aufgabe darauf concentriren. Nicht leben, um zu leben« (KGA V.1,600). – Um gleich darauf sein Einvernehmen mit jener Tendenz zu bekunden: »Die guten Menschen haben in schweren Augenblicken keine Skrupel« (ebd. 601).
Bezeichnenderweise hat kein Philosoph oder Theologe, sondern der Nationalökonom Wilhelm Röpke, einer der Vordenker der sozialen Marktwirtschaft, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in seinem Buch »Die deutsche Frage« (1945) die Konsequenzen jener Kriegs- und Todesverherrlichung beim Namen genannt. So leitet er einen längeren Abschnitt über Die Intellektuellen mit der Feststellung ein: »Es gibt in Deutschland kaum eine andere Schicht, die so verhängnisvoll versagt hat wie diejenige der Intellektuellen in ihrer Gesamtheit, mit Ausnahmen eines großen Teiles der Geistlichen beider Konfessionen. Dieses Versagen war deshalb so verhängnisvoll, weil es auf eine Lähmung des Gewissens der deutschen Nation hinauslief« (ebd. 70).
Dabei holt nun Röpke, der bis 1933 einen Lehrstuhl in Marburg innehatte – noch nach seiner Entlassung suchten ihn Nationalsozialisten wegen seiner ökonomischen Sachkompetenz aus seinem ersten niederländischen Exil zur Rückkehr zu bewegen –, keineswegs zu einem Rundumschlag aus. Vielmehr weist er, der im Ersten Weltkrieg in derselben Kompanie wie Ernst Jünger kämpfte, was ihn jedoch zum Gegner eines jeglichen Militarismus und von der ersten Stunde an des Nationalsozialismus werden ließ, auf den offenen oder subtilen Widerstand unter eigenen Fachkollegen, unter Philologen und namentlich Marburger evangelischen Theologen hin [wobei der Name Rudolf Bultmanns nicht fällt]. Dies sei hier nicht gesagt, um ein Stück deutscher Geistesgeschichte aufzuarbeiten, sondern eines klarzustellen: Heutzutage steht es jedermann frei, ohne jede Einsicht auf der christlichen Überlieferung herumzutrampeln, doch kaum jemand macht sich klar, wohin die Verherrlichung von Tod und Untergang durch jene Geister führte, die nach wie vor hoch gehandelt werden, als wäre nichts geschehen.
Mochte nun ein Nietzsche den Göttern sein Ohr leihen – er ist damit ihren Suggestionen erlegen; den Einflüsterungen durchaus keiner ewigen Götzen, weil es solche nicht gibt, sondern der eigenen Idole, der Idole der Macht, der Selbstübersteigerung, der Vermessenheit, um nicht zu sagen: der Anmaßung. Hier liegt der Ansatz theologischer Kritik: Ihr Offenbarwerden geht dem »Offenbarwerden der Söhne Gottes« voraus (vgl. Röm 8,19; Kol 3,4; 1 Joh 3,2). Keinem zeitgenössischen Theologen ist es gelungen wie dem Maler Paul Klee, ihr Offenbarwerden vor Augen zu führen – nicht nur in Gestalt einschlägiger Motive wie des Aquarells »Götzen-Park« aus dem Jahre 1939. Ihn zu erkunden, die Götzen zu entlarven, erscheint aktueller denn je, um zu erkennen, wie der Messias selbst »alles historische Geschehen« vollendet.
Berlin, am Gedenktag »Unserer Lieben Frau auf dem Karmel« (16. Juli 2013)
Glaube und Kerygma
Es gehört zu den folgenreichsten Missverständnissen der Gegenwartstheologie, die christliche Glaubensüberlieferung historisch begründen zu wollen. Denn alles Historische ist bestimmt durch zeitgeschichtliche Grenzen. Und so zeitbedingt wie unsere Auffassung der neutestamentlichen Überlieferung, erscheint dann auch das Kerygma, der Gehalt der apostolischen Verkündigung selbst. Eingeschränkt auf deren Vollzug, also auf den jeweiligen zeitgeschichtlichen Zusammenhang der Verkündigung, muss das Kerygma »stets neu wieder gefunden werden«. So das Fazit Rudolf Bultmanns, der in einem Brief an Martin Heidegger vom 11. Dezember 1932 erklärt: »Als das zentrale Problem der Neutestamentlichen Theologie stellt sich immer deutlicher dies heraus: zu sagen, was eigentlich das christliche Kerygma sei. Es liegt ja nie einfach als gegebenes vor, sondern ist stets formuliert aus einem bestimmten glaubenden Verständnis heraus, – und zudem enthält das Neue Testament ja fast durchweg nicht direktes Kerygma, sondern vielmehr solche Aussagen (wie z. B. die paulinische Rechtfertigungslehre), in denen das glaubende Verständnis des christlichen Seins entfaltet wird, das seinerseits auf dem Kerygma beruht und auf es zurückweist. Welches das Kerygma sei, ist, da es nur im Vollzuge des Verkündigens wirkliches Kerygma ist, nie abschließend zu sagen, sondern muß stets wieder neu gefunden werden« (Rudolf Bultman – Martin Heidegger: Briefwechsel 1925–1975, Frankfurt am Main/Tübingen 2009, 186).
Bultmann irrt, insofern das Kerygma im Neuen Testament sehr wohl »als gegebenes« vorliegt, insofern der Glaube nicht darauf gründet, was wir jeweils glauben, oder wie es Bultmann formuliert, worauf »das glaubende Verständnis des christlichen Seins« beruht; vielmehr führt die »Beweiskette« bei Paulus in eine andere Richtung: »Der Glaube gründet in der Botschaft, die Botschaft im Worte Christi« (Röm 10,17). Oder wörtlich: »Also der Glaube (kommt) aus (der) Botschaft, aber die Botschaft durch (das) Wort Christi.« Hier liegt das Fundament des Glaubens. Denn keineswegs hat es sich der Apostel Paulus selbst ausgedacht, auch handelt es sich dabei nicht nur um seine persönliche Interpretation, wenn er zu Beginn von Kapitel 15 des ersten Briefes an die Korinther seinen Lesern ins Gedächtnis ruft: »Ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen; es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut [griech.: logos] festhaltet, den ich euch verkündet habe; oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen?« (1 Kor 15,1–2).
Die Frage könnte ebenso an die heutigen Leser gerichtet sein, insofern es Paulus nicht darum geht, was sie wohl glauben oder aber was man sich so jeweils unter dem Kerygma vorstellt. Kategorisch stellt er vielmehr klar, worauf seine Verkündigung bzw. der von ihm überlieferte Glaube beruht: »Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich [!] empfangen habe:
Christus ist für unsere Sünden gestorben,
gemäß der Schrift,
und ist begraben worden.
Er ist am dritten Tag auferweckt worden,
gemäß der Schrift,
und erschien dem Kephas, dann den Zwölf.
Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letzten von allen erschien er auch mir, der ›Missgeburt‹. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln; ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht – nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Ob nun ich verkünde oder die anderen: das ist unsere Botschaft, und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt« (1 Kor 15,3–11).
Bezeichnend, dass sich Paulus – obschon es ihm nicht gerade an Selbstbewusstsein gebricht, in Anbetracht der apostolischen Arbeit sich an vorderster Stelle zu sehen (vgl. etwa die sog. »Narrenrede« 2 Kor 11,16–12,13) –, was den Empfang der Glaubensüberlieferung angeht, den untersten Rang zuerkennt. Anders als der neuzeitliche Mensch, der dazu tendiert, seine eigene Erfahrung, sein Erleben oder seine Selbstevidenz, letzthin sein eigenes Ego herauszustellen, um der Überlieferung seinen Stempel aufzudrücken, weiß sich Paulus als Verkünder des Evangeliums als ein Empfangender, und zwar als der Letzte unter den Glaubenszeugen. Dabei spielt die Zeitgenossenschaft, die für einen Historiker zur Beurteilung eines Geschehens unabdingbar ist, keine Rolle. Vielmehr reiht er, der Christus zu dessen Lebzeiten auf Erden nicht begegnet ist, sich als Letzten unter die Auferstehungszeugen ein. Denn: Christusglaube ist Auferstehungsglaube oder aber ist kein Glaube, was wir auch immer ansonsten darunter verstehen mögen. Entscheidend ist der Vorrang des Petrus, dann der »Zwölf«, der mehr als fünfhundert Brüder, gleichsam der Urgemeinde; schließlich wird noch vorab Jakobus samt »allen Aposteln« erwähnt, gemeint ist der Kreis der Männer, denen die Verkündigung des Glaubens obliegt. In nichts anderem aber liegt nach 1 Kor 15,11 das Kerygma beschlossen [im griechischen Urtext heißt es: οὕτως κηρύσσομεν = so verkündigen wir, und weiter: und so seid ihr gläubig geworden].
Nirgendwo ist bei Paulus davon die Rede, dass das Kerygma »nur im Vollzuge des Verkündigens wirkliches Kerygma ist«, als wäre es Ausfluss einer ekstatischen Rede oder einer kunstvollen Rhetorik, vergleichbar einem hermetischen Gedicht, dessen Sinn sich seinem Interpreten ein fürs andere Mal aufs Neue erschließt. Davon kann bei Paulus nicht im Entferntesten die Rede sein, der gerade im Kapitel zuvor (vgl. 1 Kor 14) seine Vorbehalte gegenüber der Zungenrede anmeldet. Nicht nur hier verweist er darauf hin, was er selbst empfangen habe. Vielmehr ziemlich zu Beginn seines Briefes stellt er klar, worauf seine Verkündigung beruht: »Meine Botschaft und Verkündigung [griech.: kerygma] war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes« (1 Kor 2,4 f.). Nicht um Esprit, um eine geistvolle Rede im menschlichen Sinne, ist es Paulus zu tun als vielmehr um eine Rede »von Geist und Kraft«, von Pneuma und Dynamis, also getragen vom Geiste Gottes. Geht es doch, wie Paulus zuvor ausführt, um nicht weniger als um die Verkündigung des Mysteriums Gottes (vgl. 1 Kor 2,1): »Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten« (1 Kor 2,2). In Ihm liegt das Kerygma des Apostels beschlossen, das sehr wohl auf Weisheit beruht, wie er anschließend bekräftigt: »Und doch verkündigen wir Weisheit unter den Vollkommenen, aber nicht Weisheit dieser Welt oder der Machthaber dieser Welt, die einst entmachtet werden. Vielmehr verkünden wir das Geheimnis [griech.: mysterion] der verborgenen Weisheit Gottes, die Gott vor allen Zeiten vorausbestimmt hat zu unserer Verherrlichung. Keiner der Machthaber dieser Welt hat sie erkannt; denn hätten sie die Weisheit Gottes erkannt, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt« (1 Kor 2,6–8).
Man muss sich mal in aller Deutlichkeit die Folgerung des Apostels Paulus vor Augen führen: die Unvereinbarkeit der Weisheit der Machthaber dieses Äons, dieser Weltzeit, also der historischen Sphäre, mit dem Kerygma, mit der apostolischen Verkündigung des Mysteriums der verborgenen Weisheit Gottes. »Nein, wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist: das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben« (1 Kor 2,9).
Nur wer das buchstäblich Unvorstellbare und Unerhörte im Mysterium unserer Erlösung und Vollendung gewahrt: »das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, die Gott vor [!] allen Zeiten vorausbestimmt hat zu unserer Verherrlichung«, vermag die völlige Unangemessenheit, ja Vermessenheit einer historischen Bestimmung des apostolischen Kerygmas zu begreifen. Denn alles Historische, erst recht alles historisch Große bleibt auf den geschichtlichen Zeitraum dieses Äons, dieser Weltzeit beschränkt; verblasst vor dem »Große(n), das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«. Daher ist seine Enthüllung [griech.: apokalypsis] nicht menschlicher Weisheit, sondern dem Geist [griech.: pneuma] Gottes vorbehalten. »Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So erkennt auch keiner Gott – nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Davon reden wir auch, nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt, indem wir den Geisterfüllten das Wirken des Geistes deuten« (1 Kor 2,10–13).
Damit will Paulus keiner religiösen Esoterik das Wort reden, wie ja auch Kerygma gemäß Walter Bauers »Wörterbuch zum Neuen Testament« dem Wortsinn nach »die vom Herold ausgerufene Bekanntmachung« bedeutet, also ein öffentliches Geschehen, ganz so wie die apostolische Verkündigung ein öffentliches Geschehen darstellt. Nur anders als eine historische Bibelexegese, deren Vertreter weitgehend ihren Frieden mit der Welt, mit den Mächten ihrer Zeit geschlossen haben, bekennt der Apostel, nicht den Geist der Welt empfangen zu haben. Ja nicht zuletzt in der Geisteswelt des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts hat seine Einschätzung ein ums andere mal seine Bestätigung erfahren: »Der irdisch gesinnte Mensch lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn, und er kann es auch nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann« (1 Kor 2,14). Insofern die theologischen Überlieferungen nicht als Altweiberfabeln oder Rauschmittel abgetan werden, suchen ihre zeitbewussten Interpreten im Einvernehmen mit den Weltweisen sich des vermeintlich mythologischen Ballasts zu entledigen, der ihnen anhafte. Doch so selbstbewusst sie sich auch gegenüber einer bis in die Vorkriegszeit noch weitgehend volkskirchlich geprägten Kultur geben mögen – nichts reicht an das Selbstbewusstsein des Apostels Paulus heran, der kraft des Geistes Gottes gleichsam aus dem Nichts Kirchen zu gründen, genauer: in der heidnischen Welt die Kirche Christi zu begründen vermochte: »Der geisterfüllte Mensch urteilt über alles, ihn aber vermag niemand zu beurteilen. Denn wer begreift den Geist des Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir aber haben den Geist Christi« (1 Kor 2,15–16). Und durch diesen Geist, durch die pneumatische Fundierung seines Kerygmas, unterscheidet sich der Apostel grundlegend von seinen modernen Adepten, die aus der Philologie seiner überlieferten Texte vergeblich mit historischen Mitteln jenes Kerygma herauszufiltern suchen, das allein der apostolischen Verkündigung vorbehalten ist. Nicht die Geschichte, nicht der geschichtliche Wandel bestimmt ihr Kerygma, sondern Gottes Geist. Daher die lapidare Feststellung des Apostels: »Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm« (Röm 8,9b).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.