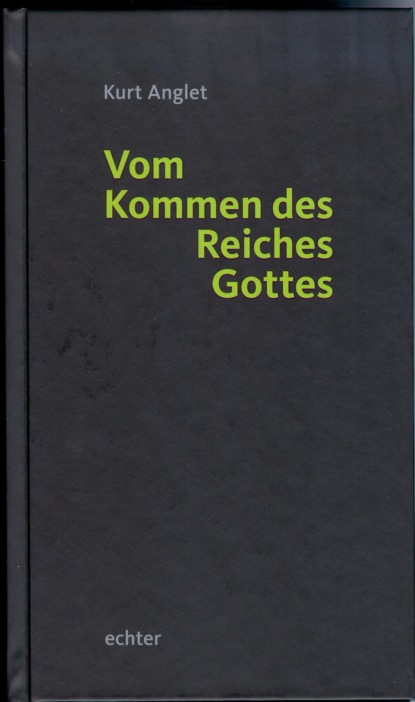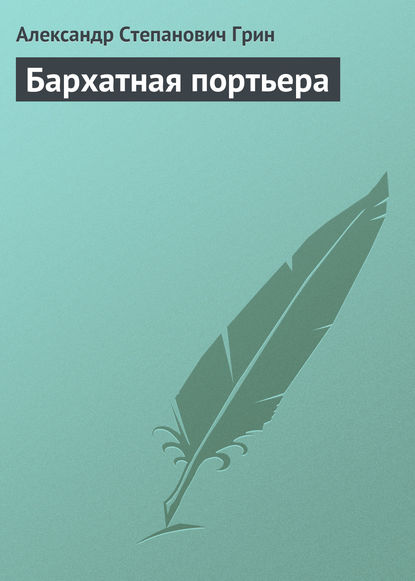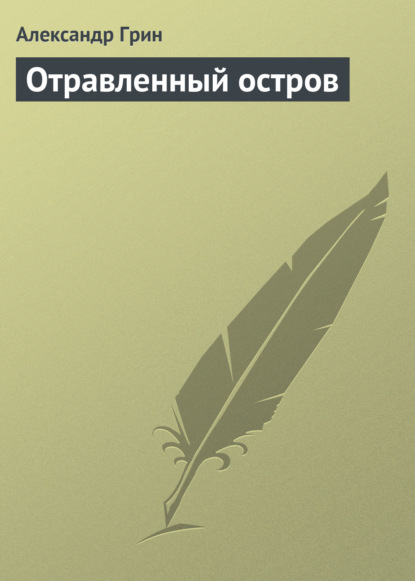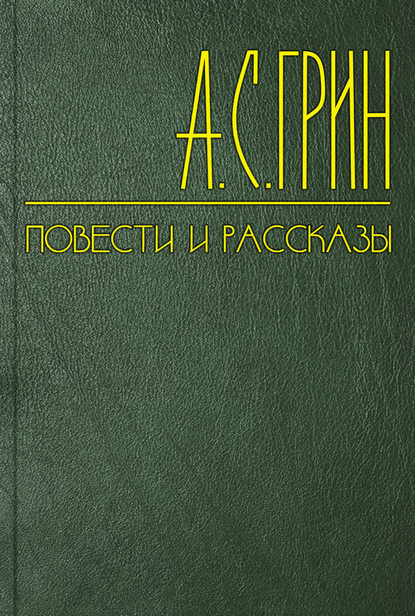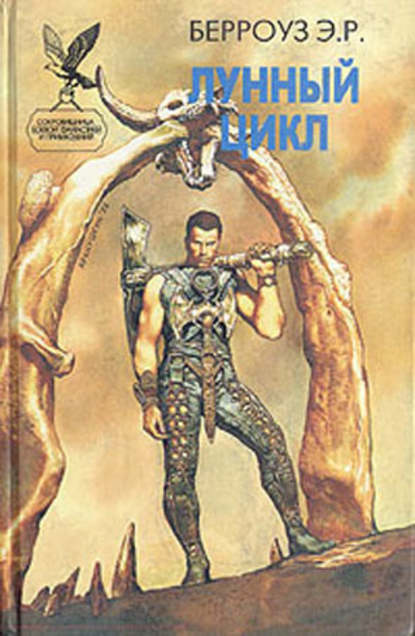- -
- 100%
- +
Der Verkennung des göttlichen bzw. des messianischen Wirkens in der Gegenwart im Zuge einer historistischen Geschichtsauffassung korrespondiert die Verkennung des Diabolischen in der Geschichte im Geiste der Aufklärung, durch deren Reduktion der Religion auf Moral alles, was mit Teufel oder Hölle zusammenhängt, ins Reich der Phantasie verwiesen wird. Schon Hegel befand mit Blick auf eine nominalistische Theologie, selbst die Lehre von der ewigen Seligkeit und der ewigen Verdammnis seien lediglich »Worte, die in sogenannter guter Gesellschaft nicht gebraucht werden dürfen; solche Ausdrücke gelten für – ἄρρτα. Wenn man sie auch nicht leugnet, so wäre man doch geniert, sich darüber zu erklären.« (Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Bd. 3, 68)
Mehr als phantasielos, geradezu grotesk mutet es daher an, wenn in einem Zeitalter, in dem mehr Menschenleben vernichtet wurden als je zuvor, Theologen »Abschied vom Teufel« (Herbert Haag) nehmen wollen oder über die Existenz der Hölle streiten. Wie real diese ist, mag ein Blick in das von dem britischen Historiker Antony Beevor edierte Kriegstagebuch des großen Romanciers Wassili Grossman belegen, dessen Stalingradroman Leben und Schicksal vom sowjetischen Geheimdienst konfisziert wurde. Grossman selbst blieb nur deshalb verschont, weil er als Kriegsberichterstatter der Armeezeitschrift Roter Stern äußerst populär war. Obschon weder Parteimitglied noch von soldatischer Statur, hat er an vorderster Front erst den Rückzug, dann den Vormarsch der Roten Armee begleitet, erlebte auf einem nur drei Kilometer breiten Landstreifen an der Wolga die Schlacht um Stalingrad mit, hatte also zahlreiche Menschen leiden und sterben gesehen und zudem die Ermordung seiner Mutter bei dem Massaker von Babi Jar zu verkraften. Was jedoch Grossman nach, wohlgemerkt nach der Befreiung des KZ Treblinka zu sehen bekam, ließ ihn nach seinem Bericht für Monate verstummen. »Und mir scheint«, heißt es am Ende, »das Herz müsste mir stehen bleiben, zusammengepresst von solcher Trauer und solchem Leid, die kein Mensch ertragen kann.« (Beevor, Ein Schriftsteller im Krieg, 377) Wie Beevor abschließend anmerkt, sei es »nicht verwunderlich, dass Grossman dieser Tortur nicht gewachsen war. Als er im August [1944] nach Moskau zurückkehrte, befiel ihn eine schwere Nervenkrise.« Denn was er zu Augen bekam – das ist die Hölle, gemäß dem Diktum Kafkas, es gebe nichts Teuflischeres als das, was ist.
Allein deshalb hat die Theologie in ihrer Methodik der Wirklichkeit Rechnung zu tragen, statt sich in Interpretationen, in die Philologie irgendwelcher Lesarten zu flüchten, die oft genug nicht einmal den überlieferten Texten gerecht werden, geschweige denn der Offenbarung, die in der Wirklichkeit statthat und so real ist, wie nur das Kreuz Christi real ist. Allein von hier aus hat eine Deutung der Geschichte zu erfolgen, nicht nach unseren Vorgaben und Maßgaben; allein von hier aus hat nicht allein der Geschichtsschreiber zu gewärtigen: »Der Messias kommt ja nicht nur als der Erlöser; er kommt als der Überwinder des Antichrist.«
Dass sich zu dieser Einsicht Benjamins – von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen – die zeitgenössische Theologie kaum durchrang, ist eine Sache; eine andere die, dass schon nach Benjamins Tod der heute herrschende Zeitgeist den Ton angab. Sollte doch in den folgenden Jahrzehnten vollauf seine Bestätigung finden, was Brecht in seinem Arbeitsjournal vom August 1941 vermerkt, nachdem er »die letzte arbeit« Benjamins, von dessen Tod er gerade erfahren hat, in den Händen hält: »günther stern [Günther Anders] gibt sie mir mit der bemerkung, sie sei dunkel und verworren, ich glaube, das Wort ›schon‹ kam darin vor.« Und nach ihrer Lektüre das Resümee: »– kurz, die kleine Arbeit ist klar und entwirrend (trotz aller metaphorik und judaismen), und man denkt mit schrecken daran, wie klein die anzahl derer ist, die bereit sind, so was wenigstens mißzuverstehen.« (B. Brecht, Arbeitsjournal. Erster Band 1938 bis 1942, hrsg, von W. Hecht, Frankfurt am Main 1973, 294) Dabei ist es bis heute geblieben, mag die Benjamin-Literatur auch ins Unabsehbare angewachsen sein. Mehr denn je findet Benjamins Feststellung am Ende der ersten These Über den Begriff der Geschichte ihre volle Bestätigung von der Theologie, »die heute bekanntlich klein und häßlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen«. (GS I.2, 693) Dem kommt die Theologie insofern entgegen, als sie es aufgegeben hat, die Zeichen der Zeit zu deuten – im Licht der Offenbarung des kommenden Gottes. Eher zieht es einen in die Vergangenheit zurück.
So hat jüngst Rémi Brague, der Inhaber des Münchener Guardini-Lehrstuhls, im Fazit seines Aufsatzes über Das Scheitern des Atheismus die Forderung erhoben: »Wir brauchen ein neues Mittelalter. Oder: Wir müssen dem neuzeitlichen Versuch, sich vom Mittelalter loszusagen, den Garaus machen. Wir brauchen ein echtes Mittelalter, auf keinen Fall dagegen das Zerrbild, das die Neuzeit daraus gemacht hat, um sich zu rechtfertigen. Ja, wir brauchen ein Mittelalter, das den Errungenschaften der Neuzeit positiv nachkommt und sie in eine neue Synthese integriert.« (Internationale Katholische Zeitschrift Communio 41 [2012], 279–288, hier 287) Gegen jenes Zerrbild ist bereits vor einem Menschenalter der Scheler-Schüler Paul Ludwig Landsberg angegangen in seiner Schrift Die Welt des Mittelalters und wir. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über den Sinn eines Zeitalters (Verlag von Friedrich Cohen, Bonn 1922); auch täte zumal unserer Zeit eine Rückbesinnung auf den mittelalterlichen Ordo-Begriff durchaus gut.
Nun hat Romano Guardini, ausgehend vom »Daseinsgefühl und Weltbild des Mittelalters« wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ein kleines Buch verfasst unter dem Titel Das Ende der Neuzeit. Ein Versuch zur Orientierung (Basel 1950; hier zit. nach der Werkbund-Ausgabe, Würzburg o. J. [1950]). Bemerkenswerterweise dachte Guardini zunächst an eine Studie zu Pascal, der anders als sein Zeitgenosse und Gegner Descartes nicht in seiner Zeit aufging, doch ist daraus ein Epochenbild geworden, das Bild einer im Untergang begriffenen Epoche. Entscheidend ist die Lossage des neuzeitlichen Menschen von der Offenbarung, um sein Dasein auf sich selbst zu begründen, ohne aber solche Werte wie die Freiheit und Einzigartigkeit der menschlichen Person, die sich ihr verdanken, zu verneinen. Auch wenn, ja weil es nach Guardini keine Rückwendung zum Mittelalter im Sinne der Romantik geben kann, müsse der Nicht-Glaubende »aus dem Nebel der Säkularisation heraus«, wie schon Nietzsche den Nicht-Christen gewarnt habe, dieser »habe noch gar nicht erkannt, was es in Wahrheit bedeute, ein solcher zu sein.« (110) Guardini geht dabei weder der Zweideutigkeit des modernen Menschenwesens nach noch der »Dialektik der Aufklärung«; ja nicht einmal – wie zehn Jahre zuvor Benjamin in seinen Aufzeichnungen Über den Begriff der Geschichte – von den zurückliegenden Katastrophen. Ausgehend von der Offenbarung, könnte man von einem Offenbarwerden des Menschen sprechen. »Wenn wir die eschatologischen Texte der Heiligen Schrift richtig verstehen«, heißt es abschließend, »werden Vertrauen und Tapferkeit überhaupt den Charakter der Endzeit bilden. Was umgebende christliche Kultur und bestätigende Tradition heißt, wird an Kraft verlieren. Das wird zu jener Gefahr des Ärgernisses gehören, von welcher gesagt ist, daß ihr, ›wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten erliegen würden‹ (Mt 24,24).« Obgleich die Endzeit, neutestamentlich gesehen, die gesamte Christuszeit umfasst, erkennt Guardini mit dem Ende der Neuzeit eine dramatische Zuspitzung: »Die Einsamkeit im Glauben wird furchtbar sein. Die Liebe wird aus der allgemeinen Welthaltung verschwinden (Mt 24,12). Sie wird nicht mehr verstanden noch gekonnt sein. Um so kostbarer wird sie werden, wenn sie vom Einsamen zum Einsamen geht; Tapferkeit des Herzens aus der Unmittelbarkeit zur Liebe Gottes, wie sie in Christus kund geworden ist. Vielleicht wird man diese Liebe ganz neu erfahren: die Souveränität ihrer Ursprünglichkeit, ihre Unabhängigkeit von der Welt, das Geheimnis ihres letzten Warum. Vielleicht wird die Liebe eine Innigkeit des Einvernehmens gewinnen, die noch nicht war. Etwas von dem, was in den Schlüsselworten für das Verständnis der Vorsehungsbotschaft Jesu liegt: daß um den Menschen, der Gottes Willen über Sein Reich zu seiner ersten Sorge macht, die Dinge sich wandeln (Mt 6,33).« Dabei konnte Guardini schwerlich Edith Steins Kreuzesliebe kennen, die damit ernst machte. Denn was Guardini im letzten Abschnitt mit Blick auf die Zukunft zu erkennen glaubt, das ist in Edith Steins Leben sowie im Leben und Sterben vieler anderer Christen in den Jahren zuvor bereits Wirklichkeit geworden. »Dieser eschatologische Charakter wird sich, scheint mir, in der kommenden religiösen Haltung anzeigen. Damit soll keine wohlfeile Apokalyptik verkündet werden. Niemand hat das Recht zu sagen, das Ende komme, wenn Christus selbst erklärt hat, die Dinge des Endes wisse der Vater allein (Mt 24,36). Wird also hier von einer Nähe des Endes gesprochen, so ist das nicht zeithaft, sondern wesensmäßig gemeint: daß unsere Existenz in die Nähe der absoluten Entscheidung und ihrer Konsequenzen gelangt; der höchsten Möglichkeiten wie der äußersten Gefahren.« Das freilich gilt für eine christliche Existenz von Anbeginn, nicht zuletzt aber für die zurückliegenden Jahre, die »das Ende der Neuzeit« markieren. Und wenngleich niemand das Recht habe, zu sagen, das Ende komme, so besitzt seine Erwartung durchaus eine »zeithafte«, also temporäre Bedeutung, insofern im kommenden Gott die ontologische Ordnung durchbrochen wird, wie auch mit Blick auf die »Offenbarung [apokalypsis] Jesu Christi« (Offb 1,1), also auf den Anfang der Apokalypse, Erik Peterson in seiner Auslegung der Offenbarung des Johannes (vgl. 14) auf den »eigenartigen Doppelsinn« hingewiesen hat; es heiße »eben nicht einfach Enthüllung Jesu Christi in seiner Zukunft, in seiner Parusie, sondern das heißt zugleich auch Offenbarung, die er seinen Knechten und im besonderen seinem Knecht Johannes schon jetzt hat zuteil werden lassen«. Über seine Zeit hinaus gilt die Aktualität des ihm Offenbarten, wie Johannes selbst bezeugt: »Dieser hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt: alles, was er geschaut hat. Selig, wer diese prophetischen Worte vorliest und wer sie hört und wer sich an das hält, was geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe.« (Offb 1,2 f.) Dass die Zeit nahe ist, folgt also nicht etwa aus menschlicher Spekulation, sondern aus prophetischer Einsicht in die Aktualität des Messianischen. Ist doch die messianische Welt »die Welt allseitiger und integraler Aktualität« (vgl. GS I.3, 1235), wie Benjamin in Neue Thesen K, im Rahmen seiner Aufzeichnungen Über den Begriff der Geschichte notiert. Die Aktualität der messianischen Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes bewusstzumachen, wie sie nahezu alle neutestamentlichen Texte bekunden, bildet das zentrale Anliegen der vorliegenden Abhandlung, ganz entgegen den bis in die zeitgenössische Theologie hinein vorherrschenden Zeitauffassungen zumal Hegels und Heideggers, die dem christlichen Begriff der messianischen bzw. eschatologischen Zeit völlig inkompatibel, ja konträr sind, wie nicht zuletzt aus den Lebenszeugnissen und dem Martyrium Edith Steins ersichtlich wird. Ganz im Gegensatz zum Geist ihrer Zeit wie dem Geist unserer Zeit, der zwischen Selbstübersteigerung und Nietzsches »Lust am Selbstuntergang« taumelt, konstatiert sie, dass die Kreuzesnachfolge Christi »eine starke und reine Freudigkeit« gebe, und die es dürften und könnten, »die Bauleute an Gottes Reich«, seien »die echtesten Gotteskinder« (vgl. GT II, 113).
Berlin, den 9. August 2012, dem 70. Todestag Edith Steins.
I. Der Kreuzestod Christi – der Anfang der Vollendung
Dass es seit längerem keine geschichtstheologische Deutung des Zeitgeschehens gibt, wie sie ein Salvian von Marseille im 5. Jahrhundert in De gubernatione Dei vorlegte, ist verständlich, da mit der Christianisierung der Völker Europas seit dem frühen Mittelalter die Geschichte der Kirche – trotz aller Spannungen und Konflikte – mit ihrer (profanen) Geschichte eng verknüpft war. Waren doch etliche Herrscher, wie das Königspaar Heinrich und Kunigunde, wie die Königin Mathilde, wie Stephan I. von Ungarn oder Ludwig IX. von Frankreich Heilige; einige wie Václav von Böhmen oder die skandinavischen Könige Erik und Knut sogar Märtyrer. Noch enger scheint das Band von profaner Herrschaft und Kirche seit dem Zeitalter der Reformation geknüpft, als Fürsten oder Könige zugleich als geistliches Oberhaupt ihrer Landeskirche figurierten. Entsprechend eng auch die Bindung im katholischen Raum, zu denken ist etwa an Reinhold Schneiders literarisches Porträt Philipp der Zweite. Oder Religion und Macht [Leipzig 1931]. Erst von der Französischen Revolution an zeichnet sich ein Bruch ab, wenngleich der Prozess der Säkularisierung bis ins 20. Jahrhundert hinein in erster Linie die geistigen und politischen Eliten erfasste, während die Volkskirchen, obschon eher in der Defensive, zumindest im ländlichen Raum weitgehend intakt blieben, ja in einigen Ländern, wie etwa Mexiko, den überlieferten Glauben erfolgreich gegen antichristliche Machthaber verteidigten.
Erst mit dem Ersten Weltkrieg, dem amerikanischen Historiker und Diplomaten George F. Kennan, der 2005 im Alter von 101 Jahren starb, zufolge »die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts«, wird mit der Selbstzerfleischung der christlichen Völker den apokalyptischen Mächten der Moderne Tür und Tor geöffnet. Doch selbst hier noch keine Scheidung, kein radikaler Bruch angesichts der Volksverbundenheit der Kirchen; bezeichnenderweise ist in der eingangs erwähnten geschichtstheologischen Untersuchung Walter Künneths Der große Abfall im Untertitel von »der Begegnung [!] zwischen Nationalsozialismus und Christentum« die Rede, obschon es sich in Wahrheit um eine handfeste Konfrontation handelte, die etlichen christlichen Glaubenszeugen, wie einem Dietrich Bonhoeffer noch in den letzten Kriegstagen, das Leben kostete. Und auch das eingangs zitierte Werk des katholischen Theologen Georg Feuerer Unsere Kirche im Kommen spricht im Untertitel von einer »Begegnung von Jetztzeit und Endzeit«, während doch aus christlicher Sicht Jetztzeit und Endzeit seit Christus sich nicht bloß »begegnen«, sondern einander entsprechen.
Denn keineswegs erst im allgemeinen Zeitgeschehen, im Verlauf der Geschichte, sondern im Christusgeschehen selbst zeichnet sich die Konstellation von messianischer Jetztzeit und eschatologischer Endzeit ab. So nach dem Matthäusevangelium beim Verhör Jesu vor dem Hohen Rat, wo es zunächst angesichts der verschiedenen Anschuldigungen heißt: »Jesus aber schwieg. Darauf sagte der Hohepriester zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns: Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Jesus antwortete: Du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch: Von jetzt an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen.« (Mt 26,63 f. – Es überrascht, dass die Parallelstelle Mk 14,62 von den Herausgebern der Einheitsübersetzung nicht angegeben ist; vice versa nicht dort auf Mt 26,64 verwiesen ist, sondern jeweils auf Mk 13,26.) In Anlehnung an zwei Schriftworte aus Dan 7,13 und Ps 110,1 bekennt der seinem Todesurteil und seiner Kreuzerhöhung entgegensehende Christus nicht nur seine Messianität, sondern in einem Atemzug seine eschatologische Herrschaft, die mit seinem Todesurteil öffentlich gemacht wird. War sie bislang über seinen Jüngerkreis hinaus weitgehend verschwiegen, lediglich ausnahmsweise im persönlichen Gespräch – ob mit der Samariterin oder mit Martha und Maria, den Schwestern des Lazarus – bekannt, so ist mit dem Eingeständnis seiner Messianität nicht allein sein Todesurteil wegen Gotteslästerung gesprochen: »Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: Er hat Gott gelästert! Wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung selbst gehört. Was ist eure Meinung? Sie antworteten: Er ist schuldig.« (Mt 26,65 f.) Was in diesem Zusammenhang leicht übersehen wird, ist der theologisch höchst bedeutsame Sachverhalt, dass hier, also »von jetzt an«, d. h. im Augenblick seiner äußersten Erniedrigung und Demütigung, seine endzeitliche Herrschaft ihren Anfang nimmt. Heißt es doch nach dem allgemeinen Schuldspruch: »Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn und riefen: Messias, du bist doch ein Prophet! Sag uns, wer hat dich geschlagen?« Doch nicht genug, denn anschließend folgt die tiefste aller Demütigungen: die Verleugnung durch Petrus (Mt 26,69–75), des Ersten seiner Jünger, der ihn vordem als Messias bekannt hat (vgl. Mt 16,13–20).
Nirgendwo wird der Zusammenhang von Jesu Messianität und seiner Hoheit als Menschensohn, zwischen seinem Kreuzestod und seiner eschatologischen Herrschaft so manifest wie hier, nach Mt 26,64 bzw. Mk 14,62. Es wird offenkundig, dass diese nicht etwa irgendwann am Ende aller Zeiten einsetzt als vielmehr mit dem Werk unserer Erlösung ihren Anfang nimmt. Theologisch gesprochen: Erlösung und Vollendung, Christologie/Soteriologie und Eschatologie gehören aufs engste zusammen: Das Kommen des Menschensohns, das Kommen des Reiches Gottes vollzieht sich nicht irgendwann nach seiner ersten Ankunft, sondern ist mit seiner ersten Ankunft gegeben. Mit ihrer Vollendung im Kreuzestod nimmt die Vollendung der Zeit ihren Anfang – nicht erst mit der Wiederkunft Christi.
Daher ist auch im Grunde genommen nicht ganz zutreffend die Rede von einer »eigentümlichen Dialektik der christlichen Eschatologie, wonach das messianische Reich zwar schon gekommen ist, aber doch erst in der zweiten Ankunft Christi seine Vollendung erfahren wird« – so Erik Peterson, dem wir die Wiederentdeckung der christlichen Eschatologie verdanken, in seinem Spätwerk Frühkirche, Judentum, Gnosis [Darmstadt 1982, 59; Erstausg.: Freiburg i. Br. 1959]. Gewiss wird das messianische Reich, das mit Christus schon gekommen ist, bei seiner zweiten Ankunft seine Vollendung erfahren. Nur setzt der Prozess der Vollendung nicht erst bei seinem zweiten Kommen ein, sondern nimmt seinen Anfang im Prozess gegen Jesus Christus, der vor dem Hohen Rat eingeleitet wird und – nach der Episode seiner Verspottung und der Verleugnung durch Petrus – mit der Auslieferung an Pilatus und dessen richterlichen Schuldspruch endet (vgl. Mt 27,26). Es folgen die Verspottung durch die (heidnischen) Soldaten sowie die Kreuzigung und der Tod Jesu – gleichsam das Ende der ersten Ankunft Jesu und der Anfang seiner eschatologischen Herrschaft, die vom Kreuz ihren Ausgang nimmt. Denn nicht erst am Ende der Zeiten, sondern vom Kreuz Christi aus erscheinen die Mächte dieser Weltzeit als Gerichtete – vorab der Hohe Rat und das Imperium Romanum, bis heute der Inbegriff aller Weltmacht. Deshalb kann mit Feuerer nur insofern davon die Rede sein, dass Unsere Kirche im Kommen ist, weil in Christus bereits das Reich Gottes gekommen und die Jetztzeit zur Endzeit geworden ist. Und deshalb vollzieht sich das »Kommen der Kirche« als Vorausbotin des mit Macht kommenden Gottesreiches unter dem Zeichen des Kreuzes [was übrigens der frühe Peterson in seiner Auslegung des ersten Korintherbriefes zutreffend beschrieben hat, insofern er die Parusie Christi als Apokalypsis, als Enthüllung, im Gegensatz zu seiner ersten Ankunft fasst, die im Mysterium vor sich ging; vgl. ebd. 397] bzw. des »geschlachteten Lammes«, das im Blutzeugnis der christlichen Märtyrer seine Entsprechung findet (vgl. Offb 12,11: »Denn sie haben ihn [den »Ankläger unserer Brüder« = Satan] besiegt durch das Blut des Lammes / und durch ihr Wort und Zeugnis; / sie hielten ihr Leben nicht fest, / bis hinein in den Tod«). Christi zweite Ankunft bildet gewissermaßen den Schlusspunkt jenes Prozesses, der von seiner Verurteilung ausgeht – nun aber um am Jüngsten Tag seinerseits den Mächten dieses Äons, dieser Weltzeit, das Urteil zu sprechen. Alle Geschichte nach Christus gleicht daher einem Prozess, dessen Urteil bis zum Jüngsten Tag aussteht.
Darum ist es kein Zufall, wenn Petrus im Haus des römischen Hauptmanns Kornelius, gleichsam dem Ursprungsort der Heidenmission, seine Rede, in der er Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen bekennt, mit den Worten beschließt: »Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen: Das ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt.« (Apg 10,42 f.) Es ist bezeichnend, dass hier, also im Hause des römischen Hauptmanns, Christus als »der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten« proklamiert wird. Denn zuvor – in seinen Reden auf dem Tempelplatz wie vor dem Hohen Rat – hat Petrus Jesus lediglich als Messias bekannt, durch dessen Name Heilungen geschehen und Israel die Sünden vergeben würden. Doch bereits hier, in seiner Rechenschaft vor dem Hohen Rat wegen der Heilung eines Gelähmten, verweist Petrus auf die universale Bedeutung des messianischen Namens Jesu: »Wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen: im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Er [Jesus] ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen.« (Apg 4,10–12)
Hier, vor dem Hohen Rat, weist Petrus im Geist der Umkehr auf den messianischen Erlöser, der Heilung und Rettung bringt, hin – nicht auf den Richter und Rächer des Bösen. Deshalb erklärt er zuvor, in seiner Rede auf dem Tempelvorplatz: »Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Führer [!]. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündigt hat: dass sein Messias leiden werde. Also kehrt um, und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden und der Herr Zeiten des Aufatmens kommen lässt und Jesus sendet als den für euch bestimmten Messias. Ihn muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung von allem, die Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat.« (Apg 3,17–21) Unter »den Zeiten der Wiederherstellung«, der Apokatastasis, ist allerdings keineswegs, wie ein Origenes († 253/254) vermeinte, eine Preisgabe des Gerichtsgedankens zu verstehen; schon im Fortgang seiner Rede verweist Petrus unter Zuspitzung zweier Zitate aus Lev 23,29 sowie Dtn 18,19 auf die Ausmerzung desjenigen aus dem Volke, der nicht auf den messianischen Propheten hört. Mehr noch deutet das Gebet der christlichen Urgemeinde um Furchtlosigkeit nach der Freilassung des Petrus und Johannes durch den Hohen Rat (vgl. Apg. 4,23–31) auf den universalen Zusammenhang von messianischer Erlösung und dem Gericht über Völker und Herrscher, insofern Gott zunächst als Schöpfer des Kosmos gepriesen wird, um dann den Beginn von Ps 2 zu zitieren: »Warum toben die Völker, / warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Die Könige der Erde stehen auf, / und die Herrscher haben sich verbündet / gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wahrhaftig, verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und Stämmen Israels, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben.« M. a. W., es geht hier nicht um irgendeine abstrakte Gerichtsidee oder um einen entsprechenden Gerechtigkeitsgedanken. Vielmehr wird hier – im Bündnis eines Herodes und Pontius Pilatus – genau der geschichtliche Schnittpunkt benannt, in dem Profan- und Heilsgeschichte, die Gewalten des alten und des neuen Äons, aufeinandertreffen, und zwar nicht aufgrund irgendeiner historischen Kontingenz, sondern »um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben«.
Das bedeutet nicht weniger, als dass sowohl die konkrete Machtausübung eines Herodes und eines Pontius Pilatus wie ihr endgültiges Scheitern ganz in der Hand Gottes liegen. Auch wird immer wieder gern auf die Gütergemeinschaft der Urgemeinde als Modell eines authentischen Christentums hingewiesen, von der im darauffolgenden Abschnitt die Rede ist (vgl. Apg 4,32–37). Doch ebenso wichtig, ja vielleicht noch wichtiger ist der Abschluss des vorausgehenden Gebets der Urgemeinde, die fortfährt: »Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes.«