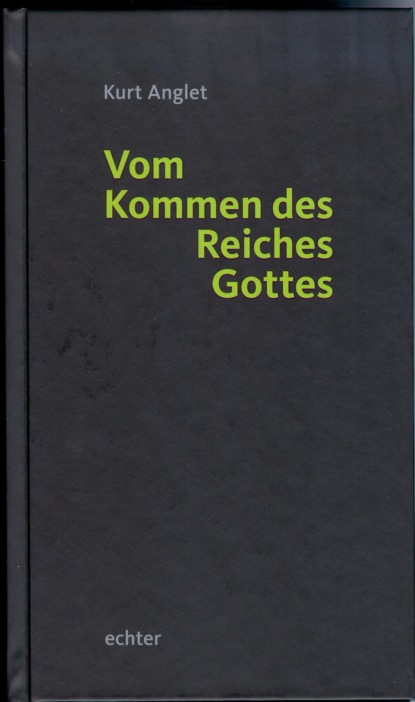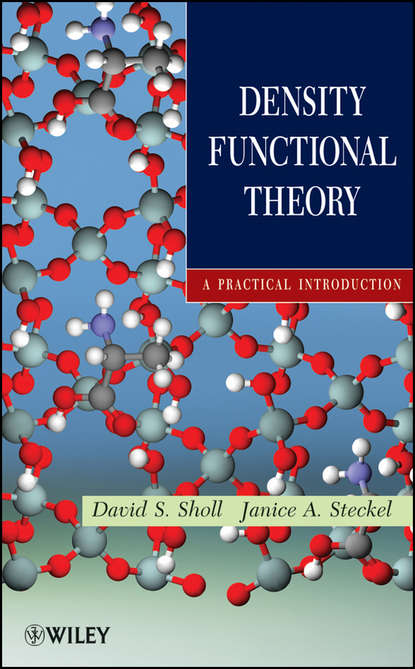- -
- 100%
- +
Denn hier ereignet sich gewissermaßen das »zweite Pfingsten« (vgl. Apg 2,1–13), die Geburtsstunde der Parrhesia, der »freimütigen Rede«, wie sie bereits die Apostel zuvor auf dem Tempelplatz und vor dem Hohen Rat bewiesen haben. Kündigte sich dort die Macht des Heiligen Geistes in einem Sturm an, unter der Ausbreitung von Feuerzungen, der Gabe, in fremden Sprachen zu reden, so jetzt in einem Beben, das der kleinen Schar der Urgemeinde die Kraft schenkt, den Drohungen der Mächtigen standzuhalten und »mit Freimut« [μετà παρρησίας = metà parrhesías] das Wort Gottes zu verkünden.
Mehr als in irgendeinem Manifest politischer Natur oder in einer gutmeinenden ethischen Absichtserklärung liegt in diesem Gebet der Urgemeinde gewissermaßen die pneumatische Sprengkraft des christlichen Glaubens. Und zwar nicht allein in einem historischen Sinne, im Hinblick auf »die Stämme Israels« wie die Völker des Römischen Imperiums. Es ist der gewaltige eschatologische Impetus jenes Geistes, der in der Kraft jenes Bebens ganze Reiche zum Einsturz bringt – eines nach dem anderen. Allein aus diesem Grunde ist eine geschichtstheologische Betrachtung einer jeden Epoche nicht allein von kultur- oder kirchengeschichtlicher Bedeutung. Vielmehr trägt sie dem im Kommen begriffenen Christus Rechnung, wie es auch im Epheser-Hymnus (Eph 1,10) heißt: »Er [Gott] hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen [wörtlich: im Blick auf den Heilsplan für die Erfüllung der Zeiten], / in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist.«
Und zwar gilt jener »Heilsplan [griech.: oikonomia] für die Erfüllung der Zeiten« bereits für die Zeiten vor Christus wie für Gegenwart und Zukunft. Mit Blick auf das Heilsgeschehen vor Christus hat Irenäus von Lyon in seinem Buch gegen die Irrlehren (Adversos haeresos, Lib. 4, Cap. 2,14) Gottes Wirken umschrieben: »Von Anfang an hat Gott den Menschen gebildet im Hinblick auf die Gaben, die er ihm schenken wollte. [ – ] Die Patriarchen erwählte er um ihres Heiles willen. Im Voraus formte er das ungelehrte Volk, um die Ungelehrigen zu lehren, Gott zu folgen. Im Voraus unterrichtete er die Propheten, um die Menschen daran zu gewöhnen, den Geist Gottes zu tragen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Der selbst niemanden braucht, gewährte denen, die ihn brauchen, seine Gemeinschaft. Denen, die sein Wohlgefallen besaßen, entwarf er wie ein Baumeister den Plan für den Aufbau des Heils.« Erst recht aber gilt dies im Hinblick »auf den Heilsplan für die Erfüllung der Zeiten«: »in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist«. Entscheidend ist also die theozentrische bzw. christozentrische Fundierung christlicher Geschichtsdeutung. M. a. W., es kann keinerlei christliche Geschichtsdeutung auf dem Fundament des Deutschen Idealismus, des Marxismus, der Lebensphilosophie, Nietzsches, Heideggers oder irgendwelcher postmoderner Geschichtskonzeptionen geben, weil alle diese säkularen Geschichtsauffassungen Gott nicht als Lenker der menschlichen Geschichte kennen, geschweige denn in Christus die anakephaleiosis, d. h. die »Zusammenfassung« alles Geschehens in Christus als Haupt erkennen. Es kennzeichnet all jene Geschichtsauffassungen, dass der Mensch – als Gestalter, ja als Schöpfer seiner Geschichte und seines Geschicks – den Platz Gottes einnimmt, und sei es auch um – wie etwa Cioran – einer ausweglosen Skepsis, der Melancholie einer unauslotbaren Trostlosigkeit zu huldigen.
Gern wird in diesem Zusammenhang auf die Errungenschaften der europäischen Freiheitsgeschichte verwiesen. Diese mögen unbestritten sein in Anbetracht von Unmündigkeit und Unterdrückung im Zeitalter des Absolutismus. Nur ist der Traum der Vernunft, nach ihren eigenen Gesetzen die Welt zu regieren, auf den Kriegsschauplätzen und in den Todeslagern des 20. Jahrhunderts zum Albtraum geworden. Goyas Capriccio »Der Traum der Vernunft gebiert Ungeheuer« (1797) greift mehr als ein Jahrhundert voraus: Angesprochen, was für ihn das erste Dokument des modernen Antisemitismus sei, antwortete Raul Hilberg, der Nestor der Holocaust-Forschung, es sei ein Brief Hitlers aus dem Jahre 1919, in dem dieser von einem »Antisemitismus der Vernunft« gegenüber dem gefühlsbetonten Antisemitismus der Vergangenheit spricht [vgl. Geschichte reicht in die Gegenwart. Ein Gespräch mit Raul Hilberg, in: NZZ Nr. 287 (10.12.2002), 34]. Denn das Monströse, buchstäblich »Ungeheuerliche« der menschlichen Vernunft tritt da zutage, wo der Mensch sich nicht mehr als der Vernehmende, also gegenüber Gott als der Gehör und Gehorsam Schenkende, begreift, sondern sich anmaßt, selbst den Platz Gottes in der Geschichte im Geiste seiner Selbstverabsolutierung, ja seiner Selbstübersteigerung einzunehmen. Nichts anderes aber ist seit Goyas Zeiten, seit der Ära Napoleons in der europäischen Geschichte etliche Male geschehen: Allein deshalb kann es keinerlei Substitution des christlichen Gottesbegriffs durch eine säkulare Geschichtskonzeption geben, selbst wo diese sich – wie noch die Kriegsmächte des Ersten Weltkriegs – auf Gott beruft. Das in aller Unmissverständlichkeit zum Ausdruck gebracht zu haben, ist nicht zuletzt das Verdienst von Erik Petersons Abhandlung Der Monotheismus als politisches Problem aus dem Jahre 1935, wo – über ihren historischen Gegenstand, die römische Kaiserzeit, hinaus mit einem Seitenhieb gegen Carl Schmitts »politische Theologie« – es abschließend heißt: »Die Lehre von der göttlichen Monarchie mußte am trinitarischen Dogma und die Interpretation der Pax Augusta an der christlichen Eschatologie scheitern. Damit ist nicht nur theologisch der Monotheismus als politisches Problem erledigt und der christliche Glaube aus der Verkettung mit dem Imperium Romanum befreit worden, sondern auch grundsätzlich der Bruch mit jeder ›politischen Theologie‹ vollzogen, die die christliche Verkündigung zur Rechtfertigung einer politischen Situation missbraucht. Nur auf dem Boden des Judentums oder Heidentums kann es so etwas wie eine ›politische Theologie‹ geben. Doch die christliche Verkündigung von dem dreieinigen Gott steht jenseits von Judentum und Heidentum, gibt es doch das Geheimnis der Dreieinigkeit nur in der Gottheit selber, aber nicht in der Kreatur. Wie denn auch der Friede, den der Christ sucht, von keinem Kaiser gewährt wird, sondern allein ein Geschenk dessen ist, der ›höher ist als alle Vernunft‹.« [Hervorh. K. A.]
Wenn aber Gott allein der Schenkende, der Mensch jedoch der Empfangende ist, wie auch aus den oben zitierten Ausführungen des Irenäus von Lyon ersichtlich wird, dann kann es ebenso wenig eine politische Fundierung des Gottesreiches auf dem Boden des Profanen in einer Art Synthese von christlicher Reich-Gottes-Erwartung und politischer Weltverantwortung geben. Es entbehrt nicht der Ironie, dass nicht etwa ein christlicher Traditionalist oder ein politisch Konservativer das in aller Unmissverständlichkeit zum Ausdruck gebracht hat, sondern der später dem Marxismus zugewandte Philosoph Walter Benjamin, und zwar im Anschluss an die eingangs zitierten Aussagen des Theologisch-politischen Fragments: »Darum kann die Ordnung des Profanen nicht am Gedanken des Gottesreiches aufgebaut werden, darum hat die Theokratie keinen politischen sondern allein einen religiösen Sinn. Die politische Bedeutung der Theokratie mit aller Intensität geleugnet zu haben ist das größte Verdienst von Blochs ›Geist der Utopie‹.« (GS II.1, 203) Denn nicht nur hat der Versuch ihrer politischen Fundierung eine Verwirrung der Begriffe zur Folge. Vielmehr nehmen unsere »Optionen«, unsere Ideen und Wunschvorstellungen den Platz ein, der ausschließlich Gott bzw. seinem Gesalbten gebührt. Und wie kein »Gesalbter« im Sinne eines profanen Herrschers dessen Platz behaupten kann, so obliegt das Kommen des Gottesreiches allein Gott und seinem Gesalbten, dem Messias und Menschensohn, durch die Geschichte hindurch – nicht zuletzt durch unsere Zeit hindurch, soweit sie dem dreieinigen Gott den Rücken gekehrt hat, um sich selbst zu inthronisieren. Nicht etwa auf dessen erklärte Feinde bezieht sich das Wort Jesu, sondern auf diejenigen, die unter Berufung auf Gott eine politische Theokratie zu errichten trachten: »Seit den Tagen Johannes’ des Täufers bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan; die Gewalttätigen reißen es an sich.« (Mt 11,12) – Bis heute, d. h. bis auf den heutigen Tag wird dem Himmelreich und denen, die daran bauen, Gewalt angetan.
II. Kleiner Exkurs zu den drei großen K – eine kleine Geschichtstheologie der Moderne
Daher auch unsere Hegel-Kritik in früheren Abhandlungen wie auch die entschiedene Absage an Heidegger, dessen Popularität nicht zuletzt darin gründet, dass seine Philosophie unter vermeintlichem Rückgang auf den Ursprung des Denkens dem Gott Israels und Gott Jesu Christi den Rücken kehrt; bildet doch die Abkehr, die Lossage von Gott geradezu das Siegel eines Zeitalters, das aus sich heraus, aus seinen eigenen Quellen und Methoden seine Evidenz zu schöpfen trachtet. Und selbst wenn ein Heidegger nicht den Richtlinien einer säkularen Wissenschaft folgt, ja sie verachtet und das Sein des Menschen und seiner »Geschichtlichkeit« von jenem Ursprung her zu bestimmen sucht, wie in den Beiträge(n) zur Philosophie (Vom Ereignis), seiner sog. Philosophie der »Kehre« aus den dreißiger Jahren, die erst posthum 1989 anlässlich seines 100. Geburtstags erschien, ist dem vorletzten Kapitel DER LETZTE GOTT folgendes Epitheton vorangestellt: »Der ganz Andere gegen / die Gewesenen, zumal gegen / den christlichen.« – Es handelt sich in der Tat um den »Gott dieses Äons, dieser Weltzeit, der das Denken der Ungläubigen verblendet hat« (2 Kor 4,4). Hier, nicht erst im nationalsozialistischen Engagement Heideggers, wird der antichristliche Charakter eines Denkens offenbar, das sich ganz dieser Weltzeit verschrieben hat – einem »Chronos ohne Kairos«; einer Zeit, die keine Gnade, keine Erlösung kennt, sondern folgerichtig – ganz wie in der oben genannten Schrift – in einer Welt des Todes terminiert.
Dass die Moderne keineswegs identisch ist mit den nihilistischen Tendenzen des Zeitalters; ja eine authentische Moderne von Anfang an aus dem Geist des Judentums oder des Christentums gegen seine Todesmächte ankämpft, ist bereits eingangs gesagt worden. Wie ein Fanal auf das folgende Jahrhundert liest sich daher Karl Kraus’ Apokalypse (Offener Brief an das Publikum) aus dem Jahre 1908 mit dem Bekenntnis: »Es ist meine Religion zu glauben, daß [das] Manometer auf 99 steht. An allen Enden dringen die Gase aus der Welthirnjauche, kein Atemholen bleibt der Kultur und am Ende liegt eine tote Menschheit neben ihren Werken, die zu erfinden ihr so viel Geist gekostet hat, daß ihr keiner mehr übrig blieb, sie zu nützen.« Bedenkt man, dass für Kraus die Luftschifffahrt das Modell für das Tempo des Fortschritts abgibt, so könnte man im digitalen Zeitalter darüber nur müde lächeln, wo doch monatlich eine Summe von 390 Billionen Dollar um den Globus gejagt wird, um seinen Teil am Mehrwert aller erwirtschafteten Gelder abzuschöpfen. Doch die Fehlkalkulationen waren damals nicht geringer, als man meinte, mit Hilfe der Innovationen zumal auf dem Gebiete der Kriegstechnik schneller voranzukommen, um am Ende im Sumpf der Schützengräben steckenzubleiben. Als Kraus seinen Brief 1922 seinem Buch Untergang der Welt durch schwarze Magie voranstellte, lachte keiner mehr, der zuvor in seinen Polemiken nicht mehr zu erkennen glaubte als eine Ansammlung satirischer Übertreibungen. Nicht erst hier dringt Kraus auf nicht weniger als auf die Entzauberung der Macht der modernen Medien im Zeichen der »Enthüllung«, der Apokalypsis, jener falschen Propheten, die Völkerhass und Krieg schönredeten, um sich nach dem Untergang aus der Verantwortung zu stehlen. Schon vor Kriegsbeginn hat Kraus in seinem Ein-Mann-Feldzug in der Fackel gegen ihr Lügengebaren angekämpft, bis hinein in die Mimik des Ausdrucks, die das Groteske der Presseberichte seiner Zeit buchstäblich aufspießt, um es auf die Anklagebank zu bringen, dagegen einen Prozess anzustrengen. Daher Benjamins treffende Charakteristik nicht so sehr in dem großen Kraus-Essay, sondern in dem kleinen Porträt (vgl. GS. II, 624 f.), demzufolge sich in Kraus »der großartigste Durchbruch des halachischen Schriftums mitten durch das Massiv der deutschen Sprache« ereigne. Ja man verstehe »nichts von diesem Mann, solange man nicht erkennt, daß mit Notwendigkeit alles, ausnahmslos Alles, Sprache und Sache, für ihn sich in der Sphäre des Rechts abspielt«. Erst von hier aus wird verständlich, wieso später Theodor Haecker in seinen Tag- und Nachtbüchern bekennt, er wolle die Fackel nicht geschrieben haben (vgl. ebd. 146). Denn in ihr wird auf dem Boden einer großen überkommenen Kultur einer Welt, einer Zeit der Prozess gemacht, die sich anschickt, ebendiese Kultur abzuschaffen. Bevor ihr Kraus in Die letzten Tage der Menschheit auch ein literarisches Denkmal setzte, hat er sie auf dem Feld der Sprache ausfindig zu machen gesucht, der Sprache seiner Zeit, der »grossen Zeit«. So lautet der Eingangsaufsatz zu Weltgericht: »IN DIESER GROSSEN ZEIT [ – ] die ich noch gekannt habe, wie sie so klein war; die wieder klein werden wird, wenn ihr dazu noch Zeit bleibt; und die wir, weil im Bereich organischen Wachstums derlei Verwandlung nicht möglich ist, lieber als eine dicke Zeit und wahrlich auch schwere Zeit ansprechen wollen; in dieser Zeit, in der eben das geschieht, was man sich nicht vorstellen konnte, und in der geschehen muß, was man sich nicht mehr vorstellen kann, und könnte man es, es geschähe nicht –; in dieser ernsten Zeit, die sich zu Tode gelacht hat vor der Möglichkeit, daß sie ernst genommen werden könnte; von ihrer Tragik überrascht, nach Zerstreuung langt, und sich selbst auf frischer Tat ertappend, nach Worten sucht; in dieser lauten Zeit, die da dröhnt von der schauerlichen Symphonie der Taten, die Berichte hervorbringen, und der Berichte, welche Taten verschulden: in dieser da mögen sie von mir kein einziges Wort erwarten. Keines außer diesem, das eben noch Schweigen vor der Mißdeutung bewahrt. Zu tief sitzt mir die Ehrfurcht vor der Unabänderlichkeit, vor der Subordination der Sprache vor dem Unglück.«
Das »Schweigen vor der Mißdeutung« bewahren vermag nur einer, dem die falsche Eindeutigkeit der handfesten Parolen ebenso zuwider ist wie die Zweideutigkeit des Wortreichtums in Presse und Literatur, die in jenen Prozess verstrickt sind, und gegen die daher Kraus ankämpft – als ein von Presse und offiziellem Schrifttum Attackierter. Als solcher hat Kraus gegen seine Zeit, gegen die Mächte seiner Zeit gekämpft; wissend, ja in »Ehrfurcht vor der Unabänderlichkeit, vor der Subordination der Sprache vor dem Unglück«, was nicht weniger besagt, als dass alle Anklage der Klage der Unglücklichen eingedenk sein muss. Daher das Schweigen vor dem Sprechen, wie es dem Gebet eigentümlich ist, das sich ja nicht in einem leeren Wortschwall ergießen soll; aber nicht weniger eigentümlich auch der Anklage, die sich gegen jene wortreichen Ankläger zur Wehr setzt, die den ungeliebten Zeitgenossen durch Phrasen und Parolen einzuschüchtern, mundtot oder einfach lächerlich zu machen suchten. »Daß dieser Mann, einer der verschwindend wenigen, die eine Anschauung von Freiheit haben, ihr nicht anders dienen kann, denn als oberster Ankläger, das stellt seine gewaltige Dialektik am reinsten dar. Ein Dasein, das, eben hierin, das heißeste Gebet um Erlösung ist, das heute über jüdische Lippen kommt.« Anscheinend ein Selbstwiderspruch, »Dialektik«, insofern als oberster Ankläger im Allgemeinen allein derjenige auftreten kann, der in einem Staatswesen, in einem öffentlichen Raum höchste Autorität besitzt. Weder in diesem noch in jenem besaß Kraus Autorität – einzig aufgrund der Autorität göttlichen Rechts, das höher steht als alle profanen Gesetze, die in Staat und Gesellschaft herrschen, weil jenes Bewusstsein, genauer: Sprachbewusstsein, die Ehrfurcht des Anklägers vor den Klagen der Unglücklichen einschließt. In diesem Sinne war Kraus’ Wirken und Schreiben Anklage gegen die Mächte und Kräfte seiner Zeit und Gebet – »das heißeste Gebet um Erlösung, das heute über jüdische Lippen kommt«. Beides war es freilich insoweit, als ihm in all jenen Jahren, selbst in der Kriegszeit, ein Freiraum blieb, um aus einer noch gegenwärtigen großen europäischen Kultur und aus seiner eigenen jüdisch-christlichen Überlieferung zu schöpfen und ein entsprechendes Publikum zu erreichen.
Genau jener Freiraum, der sowohl im Habsburger Reich als auch in den neuen Nationalstaaten Ostmitteleuropas noch bestand, wird den Menschen alsbald genommen, und zwar sowohl in der jungen Sowjetunion wie auch unter der heraufziehenden NS-Diktatur. »Mir fällt zu Hitler nichts ein.« So lautet der erste Satz seines Buches Die dritte Walpurgisnacht aus dem Jahre 1933, ursprünglich als Heft der Fackel gedacht, die in den folgenden Jahren bis zu Kraus’ Tod (1936) kaum noch erscheinen sollte. Von einem Zeitpolemiker werde nach einem populären Missverständnis »Leistung verlangt, die als Stellungnahme bezeichnet wird, und der ja, sooft ein Übel nur einigermaßen seiner Anregbarkeit entgegenkam, auch das getan hat, was man die Stirn bieten nennt. Aber es gibt Übel, vor denen sie nicht bloß aufhört, eine Metapher zu sein, sondern das Gehirn hinter ihr, das doch an solchen Handlungen seinen Anteil hat, sich keines Gedankens mehr fähig dächte. Ich fühle mich wie vor den Kopf geschlagen, und wenn ich, bevor ich es wäre, mich gleichwohl nicht begnügen möchte, so sprachlos zu scheinen, wie ich bin, so gehorche ich dem Zwang, auch über ein Versagen Rechenschaft zu geben, Aufschluß über die Lage, in die mich ein so vollkommener Umsturz im deutschen Sprachbereich versetzt hat, über das persönliche Erschlaffen bei Erweckung einer Nation und Aufrichtung einer Diktatur, die heute alles beherrscht außer der Sprache.« Und auch das sollte sich bald ändern – wir schreiben wohlgemerkt erst das Jahr 1933 –, insofern nicht nur bald ein Publikationsverbot missliebiger Schriften erlassen, sondern die Sprache zu einem Propaganda- und Machtinstrument nationaler Erweckung und diktatorischer Bevormundung herabgewürdigt werden wird. Das Groteske, das Kraus süffisant aus den Zeilen bzw. zwischen den Zeilen der österreichischen Kriegs- oder Vorkriegspresse herauslas, um es in aller Öffentlichkeit auf die Anklagebank zu zerren, ist inzwischen fester Bestandteil der Wirklichkeit, des menschlichen Alltags geworden. Anklage wie Gebet werden bald nur noch stumm über die Lippen der Unglücklichen gelangen oder – als Schrei.
Es ist das Verdienst von Kraus’ Zeitgenossen Franz Kafka, gegen das Verstummen angeschrieben und zugleich den expressionistischen »Schrei« hinter sich gelassen zu haben. Da wir uns mit Kafka ausgiebig andernorts befasst haben, sei hier nur so viel gesagt: Es leuchtete uns nie die existenzialistische Kafka-Deutung der Nachkriegszeit ein, die in ihm einen düsteren und dunklen Zeitgenossen erblickte. Kafka selbst musste bei der Vorstellung seiner Prosa ein Lachen unterdrücken, und man braucht nicht allein Erzählungen wie Elf Söhne oder Frühes Leid lesen, um seinen herzhaften Humor zu spüren; selbst sehr ernsthafte Texte wie Verwandlung oder Der Prozess enthalten Stellen von einer unvergleichlichen Komik. Hier jedoch mag ein Hinweis genügen, um Einblick in die theologische Dimension seines Werkes zu gewinnen, und zwar am Beispiel seines letzten unvollendeten Hauptwerkes, des Schloss-Fragments, von dem eingangs bereits anlässlich des Unverständnisses Karl Barths die Rede war.
Man muss jedoch nur einmal dessen Schlussteil, das sog. Olga-Fragment, lesen, um zu begreifen, dass hier nicht nur die Konzeption des Romans, ja jeglichen Romans, jeglicher Literatur gesprengt wird: Denn was Olga, neben Amalia eine der beiden Schwestern der Barnabas’schen Familie, berichtet, vermag dem Leser wie dem Autor gleichermaßen die Sprache zu verschlagen. Ihre Erzählung ist keine bloße Literatur mehr, sondern nimmt die Wirklichkeit, das Schicksal von Millionen, keine zehn Jahre nach Kafkas Tod (1924) vorweg: die Ausgrenzung ihrer Familie, ihre schrittweise Entrechtung, schließlich das Warten am Rande der Gesellschaft auf die Deportation, auf den Tod. Und während sich in unseren Tagen so mancher Verfasser von Bestsellern sog. KZ-Romane aufspielt, als wäre er dabei gewesen, finden wir hier die unglaubliche Selbstzurücknahme Kafkas, immerhin des Autors jener Schilderung und des Schöpfers ihrer Figuren, der seinem Protagonisten folgende Worte in den Mund legt: »In der Erzählung Olgas eröffnete sich ihm eine so große, fast unglaubwürdige Welt, daß er es sich nicht versagen konnte, mit seinen kleinen Erlebnissen an sie zu rühren, um sich ebenso von ihrem Dasein als auch von dem eigenen deutlicher zu überzeugen.«
Bedenkt man, dass es Kafka allein durch seinen frühen Tod nicht »vergönnt« war, jene »große, fast unglaubwürdige Welt« am eigenen Leibe zu erfahren, so lässt sich nur ahnen, was es mit jenen »kleinen Erlebnissen« auf sich hat, »um sich ebenso von ihrem Dasein als auch von dem eigenen deutlicher zu überzeugen«. Hier dreht sich nicht nur einer um die eigene Person wie nur allzu oft in der zeitgenössischen Romanliteratur, die sich in der Darstellung irgendwelcher Selbstbefindlichkeiten erschöpft. Vielmehr sieht Kafka nur allzu genau, wohin buchstäblich der Zug der Zeit geht; immerhin haben seine drei Schwestern und andere ihm nahestehende Menschen ihr Leben in Auschwitz verloren. Anstatt um irgendwelche Selbstevidenzen zu ringen, »sich selbst neu zu erfinden« oder wie ähnliche Phrasen lauten mögen, erkennt hier einer sehr genau, dass nicht allein sein Leben auf dem Spiel steht. Und wenn Kafka einmal in einer Tagebuchnotiz »Schreiben als Form des Gebetes« definiert, dann bedarf es keiner großen Phantasie, um zu erraten, für wen er wohl Fürsprache hält. In keinem anderen literarischen Werk der Moderne finden auf vergleichbare Weise Paraklese und Prophetie zueinander.
Wäre als Dritter der großen K der Maler Paul Klee zu nennen, der ein ungeheueres visionäres Werk geschaffen hat. Allein im letzten Lebensjahr – er starb im Juni 1940 an Sklerodermie – waren es 365 Bilder. Nicht nur in seinen letzten Lebensjahren, als ihm seine Schweizer Heimat zum Exil bzw. Asyl wurde [Klee war deutscher Staatsbürger], sondern weit zuvor weist sein Werk auf die große Katastrophe hin. Doch anders als die Expressionisten, deren Bilder des Krieges sich gleichsam im Ausdruck trostlosen Grauens und Schmerzes vergruben, scheinen selbst die menschlichen Gestalten, die in ihren Gesichtern oder auf ihren Leibern die Stigmata des (nahen) Todes tragen, vom Standpunkt der Erlösung aus auf das ihnen zugefügte Leid herabzublicken – als Transfigurierte, als vom Leid Verklärte. Nirgendwo finden sich bei Klee, selbst da nicht, wo aus den Gesichtern Trauer, ja Verzweiflung sprechen, auch nur Anklänge von Hass oder ohnmächtiger Wut, die nach Rache schreit. Bezeichnenderweise trägt eine Bleistiftzeichnung aus dem Jahre 1939, die das Antlitz eines leidgeprüften Menschen zeigt, den Titel: vergib ihnen!
Möglich, dass Klee, der vor der Entscheidung stand, statt Maler Musiker zu werden und sich insbesondere von Mozart inspiriert zeigte, von ihm her jene geradezu kosmische Heiterkeit empfangen hat, in die alles Erdenschwere eingetaucht scheint. Zudem weist eine Tagebuchnotiz hinsichtlich seines eigenen künstlerischen Selbstverständnisses auf eine besondere Gottesnähe, die ihm – anders als seinem gefallenen Malerfreund Franz Marc – alles Faustische fremd erscheinen lässt, den Blick auf den Zustand der Erlösung hin ebnete: »Ich / suche mir bei Gott einen Platz für mich, und we