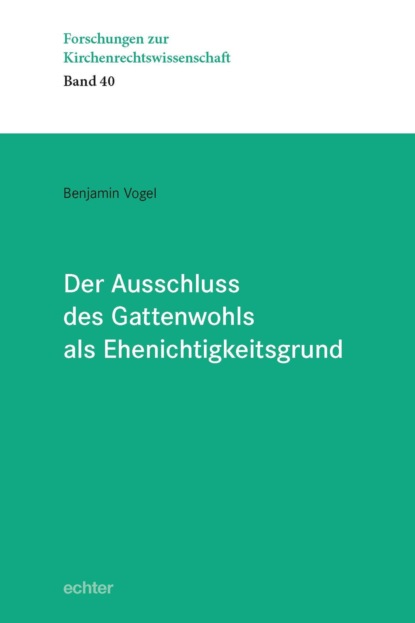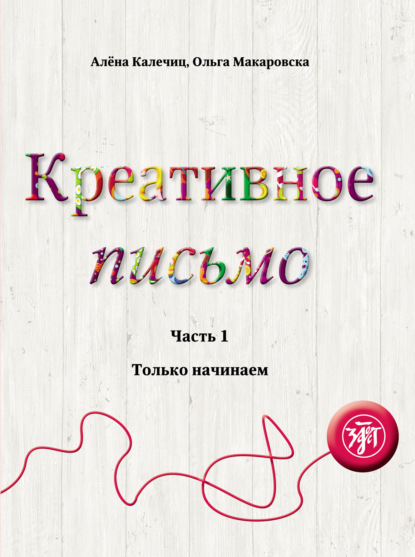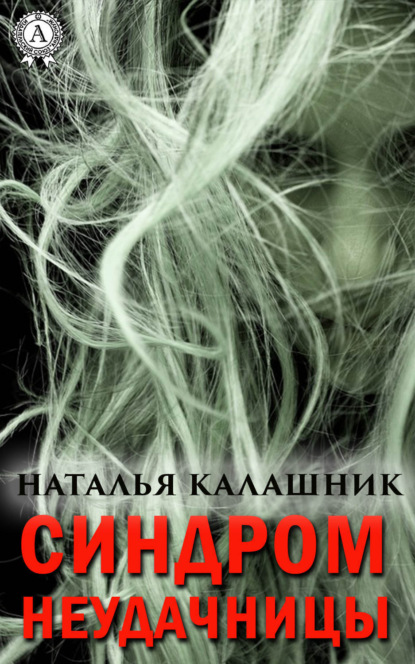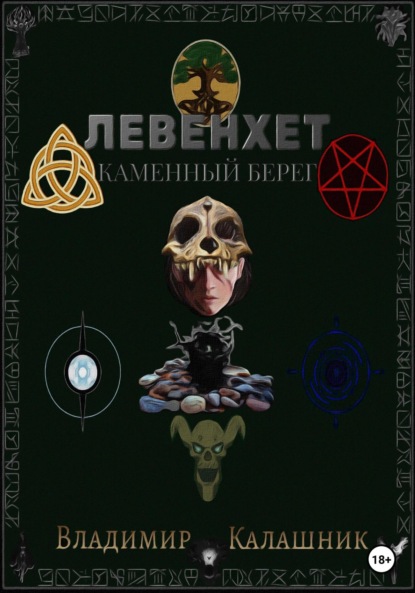Das Recht katholischer Laien auf Anerkennung ihrer bürgerlichen Freiheiten (c. 227 CIC / c. 402 CCEO)
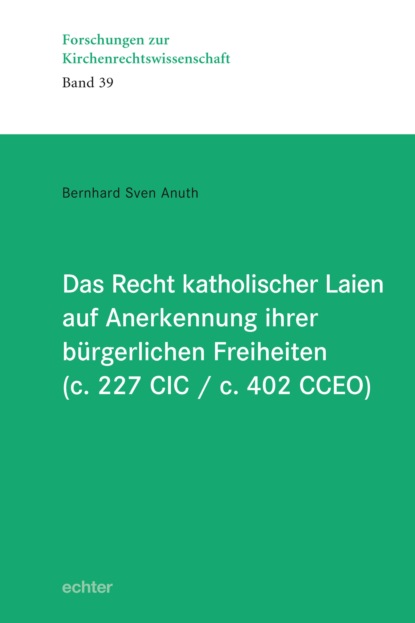
- -
- 100%
- +
44 SCHMIDT, Kirche, 177.
45 Ebd., 177f.
46 Vgl. BERKMANN, Kirche, 80: „So wie nämlich die bürgerliche Autorität die religiöse Freiheit des Individuums anzuerkennen hat, so hat in spiegelbildlicher Weise die religiöse Autorität dessen bürgerliche Freiheit anzuerkennen.“
47 Ebd., 35.
48 Vgl. ebd., 36. Dabei versteht er eine weltliche und eine kirchliche Rechtsnorm dann als „komplementär, wenn sie sich gegenseitig ergänzen. Sie sind nicht komplementär, wenn sie nicht gleichzeitig erfüllbar sind, also wenn einem weltlichen Gebot ein kirchliches Verbot desselben Inhalts gegenübersteht oder umgekehrt. Komplementarietät [sic!] erschöpft sich aber nicht in der Widerspruchsfreiheit, sondern erfordert auch, dass die Normen aus beiden Bereichen so miteinander zusammenhängen, dass sie eine sinnvolle Regelungseinheit ergeben. […] Im Bereich der Rechte Einzelner besteht die typische Konstellation, die dem Komplementärprinzip entspricht, darin, dass einem Recht auf der einen Seite eine Pflicht auf der anderen gegenübersteht“ (ebd., 36f.).
49 Sollte nämlich c. 227 CIC die bürgerliche Freiheit nicht auch für Kleriker und Ordensleute anerkennen, „so wäre zunächst nach einer anderen Rechtsgrundlage zu suchen. Sonst bliebe nur die Feststellung, dass die individuelle bürgerliche Freiheit in der kirchlichen Rechtsordnung auf einen bestimmten Teil der Rechtsunterworfenen beschränkt ist und daher nur eine teilweise Komplementarität zur Religionsfreiheit in der weltlichen Rechtsordnung besteht, die ja allen garantiert wird“ (ebd., 83f.).
50 Zwar sprächen Wortlaut und rechtssystematische Einordnung von c. 227 „eindeutig für eine Beschränkung auf die Laien“ (ebd. 84). Dennoch kommt Berkmann zu dem Ergebnis, „dass die bürgerliche Freiheit grundsätzlich allen Christgläubigen zukommt und damit der religiösen Freiheit des weltlichen Bereichs hinsichtlich des personalen Geltungsbereiches tatsächlich komplementär ist“ (ebd., 87).
51 Ebd., 92. Vgl. für die Einzelaspekte nachfolgend ebd., 93–105.
52 Vgl. H. PREE, Die politische und gewerkschaftliche Betätigung geistlicher Personen im CIC (1983) und im CCEO (1990), in: Folia Canonica 6 (2003) 7–40 und DERS., Kirchliche Sendung und weltliches Mandat. Zur Rechtsstellung geistlicher Personen in der zivilen Sphäre, in: H. de Wall / M. Germann (Hg.), Bürgerliche Freiheit und Christliche Verantwortung. FS Christoph Link, Tübingen 2003, 371–385.
53 PREE, Autorität (2010); vgl. bereits o. Anm. 19.
54 DERS., Libertad (2005); DERS., Freiheit (2011); vgl. bereits o. Anm. 19.
55 DERS., Autorität, 1128. Vgl. DERS., Freiheit, 362.
56 DERS., Freiheit, 374. Vor dem Hintergrund der Anerkennung der iusta autonomia rerum terrenarum und der Religionsfreiheit stehe c. 227 auch dafür, dass „der Laie durch sein Wirken in rebus civitatis terrenae zum Protagonisten der Beseelung der zeitlichen Wirklichkeit von innen her mit dem Geist des Evangeliums“ geworden sei (ebd.).
57 DERS., Autorität, 1128. Vgl. o. Anm. 33 und DERS., Freiheit, 374, wonach der „mit res civitatis terrenae umschriebene Schutzbereich des Rechts […] die Grenze des kirchlichen Jurisdiktionsanspruches, auch für den Laien als Katholiken“ (H. i. O.), bezeichne. Vgl. bereits DERS., Libertad, 277.
58 DERS., Autorität, 1129.
59 Vgl. BLANCO, María, Protezione della libertà e dell’identità cristiana dei laici, in: IusEccl 23 (2011) 297–318. Die Autorin hatte sich schon 18 Jahre zuvor unter dem Titel „La libertad de los fieles en lo temporal“, in: Persona y derecho / Fidelium Iura 3 (1993) 13–35, mit c. 227 befasst.
60 Vgl. NAVARRO, Luis, Les ressources du droit canonique pour comprendre le rôle du fidèle dans la société civile, in: ACan 54 (2012) 149–165.
61 Vgl. BLANCO, Protezione, 308–311 sowie bereits DIES., Libertad, bes. 29–32.
62 Vgl. NAVARRO, Ressources, 161.
63 Vgl. ebd., 161. Im weltlichen Recht entspreche c. 227 das Recht auf Religionsfreiheit als „droit parallèle“ (ebd., 164). Vgl. BLANCO, Protezione, 315f.
64 Vgl. ebd., 313f
65 Vgl. AYMANS-MÖRSDORF, KanR I, 72.
66 Vgl. cc. 16-22 CIC und cc. 1498-1504 CCEO.
67 Zu dem aus philosophischer und theologischer Sicht grundsätzlich bestehenden Problem der Annahme einer feststehenden „eigenen Wortbedeutung“ vgl. TORFS, Propria verborum significatio, 179–192.
68 Vgl. SOCHA, in: MKCIC 17, Rn. 8.
69 Es gilt die Grundannahme, „daß der Gesetzgeber die Worte so wählt, daß sie seinen Willen in der dem Gegenstand angemessenen Weise zum Ausdruck bringen.“ (MAY/EGLER, Einführung, 195; vgl. SOCHA, in: MKCIC 17 [1990], Rn. 7 sowie entsprechend schon MÖRSDORF, Lb I, 108: „es ist nicht anzunehmen, daß der Gesetzgeber etwas anderes gewollt hat, als in seinen klaren Worten ausgesprochen ist. Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio. Verba clara non admittunt interpretationem neque voluntatis coniecturam.“). Wer diese Voraussetzung grundsätzlich in Frage stelle, so SOCHA, in: MKCIC 17 [1990], Rn. 7 mit CASTILLO LARA, Interpretatione, 284 (vgl. dt.: DERS., Auslegung, 225), beraube die kirchlichen Gesetze „ihrer verpflichtenden Kraft, untergräbt das Vertrauen in die kirchliche Rechtsordnung, macht letztlich jede sinnvolle, rational überprüfbare Kommunikation unmöglich“. Daher gilt: Führt die Analyse „des sprachlichen Erscheinungsbildes zu einem eindeutigen Gesetzesverständnis, […] endet die Aufgabe des Interpreten“ (SOCHA, in: MKCIC 17 [1990], Rn. 7). Vgl. AYMANS-MÖRSDORF, KanR I, 182; BIER, Diözesanbischofsamt, 79f.; JESTAEDT, Auslegung, 103f.; LÜDECKE, Grundnormen, 77. Die im 2. HS von c. 17 genannten Regeln werden daher auch als „Aushilfsregeln“ bezeichnet (so z. B. AYMANS-MÖRSDORF, KanR I, 183 und bis 2012 auch SOCHA, in: MKCIC [1990], 17 Rn. 3). Mit Überarbeitung seines Kommentars zu cc. 1-22 für die 47. Ergänzungslieferung des MKCIC vom Feb. 2012 hat Hubert Socha seine oben zitierte Meinung allerdings geändert. „In den letzten Jahren“ sei „unter den Kommentatoren die aus der Tradition, Reflexion und persönlichen Erfahrung gewonnene Einsicht“ gewachsen, dass „die in 17 gewählte Ausdrucksweise lediglich ein sprachliches Stilmittel“ sei (ebd., Rn. 7b). Mit diesem Argument vertritt Socha nun die Auffassung, bei der Interpretation müssten „stets auch die in 17 Satz 2 genannten Wege beschritten werden“ (DERS., in: MKCIC 17, Rn. 11). Vor ihm ging z. B. schon PUZA, Kirchenrecht, 127 davon aus, c. 17 lege nicht eine Rangfolge der Interpretationsregeln fest. Auch HEIMERL/PREE, Kirchenrecht, 44 wollen eine zwingende Hierarchie der Interpretationsmethoden unbeschadet des subsidiären Charakters der in c. 17, 2. HS genannten nicht gelten lassen. Der Gesetzgeber könne eine andere als die klare Wortbedeutung eines Gesetzes beabsichtigt haben (vgl. ebd.). SCHÜLLER, Barmherzigkeit, 226 sah darin 1993 eine sich durchsetzende Ansicht. Dem ist entgegenzuhalten: Es kommt allein dem Gesetzgeber zu, eine solche Abweichung durch Gesetzesänderung oder authentische Interpretation zu korrigieren. Solange er dies nicht tut, gilt: „Nicht was der Gesetzgeber hätte bestimmen wollen, ist Gegenstand der Interpretation, sondern was er bestimmt hat. Gegen den klaren und eindeutigen Wortlaut eines Gesetzes kann keine noch so gut bewiesene Auffassung des Gesetzgebers durchdringen; denn nicht sie, sondern das Gesetz ist im Gesetzblatt verkündet“ (MAY/EGLER, Einführung, 209). Vgl. BIER, Diözesanbischofsamt, 80 Anm. 7 bzw. DERS., Einführung, 156.
C. 17 normiert den Vorrang der grammatikalisch-logischen Interpretation vor den übrigen subsidiären Auslegungsmethoden. Für deren Anwendung wird eine Präferenzordnung nicht vorgegeben. „Es ist Aufgabe der Ausleger herauszufinden, welche dieser Mittel für die Interpretation einer konkreten Norm am ehesten zielführend sind“ (DERS., Einführung, 155). Zu dem daraus resultierenden Problem der Relevanz unterschiedlicher Auslegungsverfahren und - ergebnisse sowie insbesondere dem Vorschlag B. Th. Drößlers, nur das Ergebnis einer nichtauthentischen Interpretation sei „sachlich zutreffend, das dem einer jeweils und jederzeit möglichen authentischen Interpretation entspricht“ (DRÖßLER, Bemerkungen, 28), vgl. die Diskussion bei LÜDECKE, Grundnormen, 78–81. Demnach „bleibt dem Kanonisten methodisch doch nur die kumulative Anwendung der unterschiedlichen subsidiären Interpretationsmethoden.“ Allerdings könne sein Auslegungsergebnis „jederzeit durch eine authentische Interpretation überholt werden“ (ebd., 81).
70 DRÖßLER, Bemerkungen, 15. Vgl. zustimmend SOCHA, in: MKCIC 17, Rn. 3; SCHMITZ, Wertungen, 26; LÜDECKE, Grundnormen, 76f.
71 WIJLENS, Bishops, 213 Anm. 6 sowie 221. Vgl. LEDERHILGER, Kirchenrecht, 258f. sowie für die Gegenmeinung z. B. SCHIMA, Meinungsfreiheit, 165 sowie im Folgenden.
72 MÜLLER, Kirchenrecht, 378. Tatsächlich wäre ein „rechtspositivistischer“ Ansatz nur zu konstatieren und zu kritisieren, wenn „die Auffassung vertreten würde, jeder beliebige Inhalt könne Recht sein und was legal sei, sei stets auch legitim“ (BIER, Einführung, 162). Das ist in der Kanonistik jedoch nicht der Fall, denn: „Niemand bestreitet ernsthaft, kirchliches Recht müsse durch übergeordnete rechtliche Maßgaben (göttliches Recht, moralische Wahrheit) legitimiert sein. Gerade wegen der Rückbindung an das göttliche Recht kann die kirchliche Rechtsordnung per definitionem rechtspositivistisch nicht erfasst werden“ (ebd., H. i. O.). Einen solchen Positivismus, der „das Naturrecht und das positive göttliche Recht sowie die lebenswichtige Beziehung eines jeden Rechts zur Gemeinschaft und Sendung der Kirche praktisch vergißt“, hat auch PAPST BENEDIKT XVI., Rota-Ansprache v. 21. Jan. 2012, 8 zurückgewiesen. Eine entsprechende „Auffassung würde eine deutliche Verarmung mit sich bringen“: Werde das Kirchenrecht mit dem System kirchlicher Gesetze identifiziert, „dann bestünde die Kenntnis dessen, was in der Kirche rechtlich ist, im wesentlichen darin zu verstehen, was die Rechtstexte bestimmen.“ Dies aber beraube „die Arbeit des Auslegers der lebenswichtigen Verbindung mit der kirchlichen Wirklichkeit“. „In letzter Zeit“, so der frühere Papst, hätten „einige Denkströmungen vor einer übertriebenen Treue gegenüber den Gesetzen der Kirche […] gewarnt“ und „hermeneutische Wege vorgeschlagen, die einen Ansatz zulassen, der den theologischen Grundlagen und den auch pastoralen Anliegen der Kirchengesetzgebung besser entspricht. Dies hat zu einer Kreativität im rechtlichen Bereich geführt, bei der die einzelne Situation zum entscheidenden Faktor bei der Feststellung der wahren Bedeutung der Rechtsvorschrift im konkreten Fall wird. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, ‚oikonomia‘ – sehr geschätzt in der östlichen Tradition – sind einige der Begriffe, auf die man bei dieser Auslegungstätigkeit zurückgreift.“ Hierzu stellte Papst Benedikt XVI. klar: Dieser Ansatz überwinde den kritisierten Positivismus nicht, sondern ersetze ihn lediglich durch einen anderen, „in dem die menschliche Auslegungstätigkeit sich zum Protagonisten aufschwingt bei der Bestimmung dessen, was rechtlich ist.“ Es fehle das Bewusstsein für ein objektives Recht, insofern das Recht „Spielball von Überlegungen“ bleibe, „die den Anspruch erheben, theologisch oder pastoral zu sein, am Ende jedoch der Gefahr der Willkür ausgesetzt sind.“ So aber werde die Rechtshermeneutik ausgehöhlt. Letztlich bestehe „kein Interesse daran, die Gesetzesweisung zu verstehen, da sie jeder Lösung dynamisch angepaßt werden kann, auch wenn diese dem Buchstaben des Gesetzes widerspricht“ (ebd.).
73 PAPST JOHANNES PAUL II., ApKonst „Sacra disciplinae leges“, XIX.
74 SOBANSKI, Interpretationsregeln, 705. Dabei versteht Sobanski „die die Interpretation betreffenden Weisungen […] als Ausdruck einer bestimmten ekklesiologischen Option […], die in der Literatur als ecclesiologia societatis bezeichnet wird“ (ebd.).
75 Für GEROSA, Gesetzesauslegung, 109 verpflichtet die „Besonderheit des Rechts der Kirche […] dazu, daß der Codex des kanonischen Rechts stets im Licht der Konzilslehren ausgelegt und angewendet wird.“ Vgl. PUZA, Kirchenrecht, 127. Für BORRAS, Auslegung, 314 hat die „konziliare Lehre von der Kirche […] die Funktion eines Proto-Textes, der das Abschließen des kanonischen Textes des Codex verhindert.“ MÜLLER, Codex und Konzil, 479 vertritt die Meinung, die „konziliare Lehre insgesamt“ bilde „den Kontext für die Interpretation der Normen der kirchlichen Gesetzbücher“ (zur Kritik an seiner These vgl. BIER, Diözesanbischofsamt, 81f. Anm. 8). Ähnlich WIJLENS, Verhältnisbestimmung, 337f.; DIES., II. Vatikanum, 8 sowie DIES., Bishops, 221 unter Bezugnahme auf die Arbeiten von L. Örsy (vgl. grundlegend ÖRSY, Theology, bes. 53–58). Für SOBANSKI, Interpretationsregeln, 705 steht fest: „Obwohl die Weisungen des can. 17 ein statisches Interpretationsmodell abbilden, so muß doch mit Rücksicht auf die den Kodex selbst begründenden Motive […] festgestellt werden, daß nur eine dynamische Auslegung zum rechten Verständnis des Kirchenrechts führt.“ Vgl. BAUSENHART, Desiderate, 363, wonach der „für den Codex konstitutive Bezug auf das Konzil […] das Verständnis des CIC als eines autonomen Textcorpus [verbietet], das in seinen Normen allein nach philologischen, grammatischen und logischen Methoden auszulegen wäre. Die in c. 17 CIC niedergelegte Interpretationsregel ist zwar zunächst kanon-immanent formuliert, gibt aber doch auch den Blick frei auf kanon-externe Faktoren wie ‚die Absicht des Gesetzgebers‘, der hinreichend deutlich gemacht hat, dass der CIC/1983 im Licht des Zweiten Vatikanischen Konzils zu verstehen sei.“ Auch DEMEL/MÜLLER, Einführung, 13 haben 2007 stellvertretend für die Autor(inn)en der Festschrift für Peter Krämer betont, „nach wie vor“ sei das II. Vatikanum „der maßgebliche Interpretationsrahmen für das kirchliche Recht.“
76 GEROSA, Gesetzesauslegung, 139.
77 HILBERATH, „Nur der Geist …“, 269. Es sei in ekklesiologischer Hinsicht „unzureichend, den Gesetzgeber zugleich und allein zur absoluten Auslegungsinstanz zu erklären bzw. eine solche hermeneutische Praxis zu etablieren und zu dulden. Weder sollten allein die Kanonisten herausfinden, was der Wille des Gesetzgebers war, noch darf sich dieser allein von hierher inspirieren oder instruieren lassen. Die Dogmatiker sind nicht nur Tagträumer, sondern auch Anwälte und Interpreten wichtiger Konzilstexte […]. […] Die Canones des Codex und ihre Interpretation sind daran auszurichten, was wir im Verbund der Subjekte in der Communio der Kirche als Intention des Zweiten Vatikanischen Konzils erkennen“ (DERS., CIC, 48). Wer in dieser Weise das Konzil über den Wortlaut des Gesetzes stellt, wird tatsächlich mitunter bedauernd feststellen, konziliare Vorgaben seien im Codex nicht rezipiert. „Genauer“, so BIER, Einführung, 161, „müsste indes formuliert werden: Der Gesetzgeber hat konziliare Vorgaben nicht in der vom jeweiligen Ausleger gewünschten Weise berücksichtigt. Denn dass der Gesetzgeber alle relevanten Vorgaben in der von ihm für sachgerecht angesehenen Weise aufgenommen hat, dafür verbürgt er sich durch den Hinweis, der Codex sei die Übersetzung des Konzils in die Sprache des Rechts“ (H. i. O.).
78 Vgl. MECKEL, Konzil und Codex. Die Arbeit war bis zum 30. Mai 2016 noch nicht publiziert und konnte daher in der vorliegenden Studie nicht berücksichtigt werden.
79 Vgl. DRÖßLER, Bemerkungen, 17; SCHMITZ, Wertungen, 26; GEHR, Qualifikation, 191; BIER, Diözesanbischofsamt, 81. Mit Inkrafttreten des CIC/1983 ist der Legitimationsgrund einer streng konzilskonformen Auslegung, „ein durch die Summe der Konzilsbeschlüsse des II. Vaticanum gegenüber dem CIC/1917 verursachter ‚Verfassungswandel‘, entfallen. […] Selbstverständlich bleiben die Dokumente des II. Vaticanum für die Gesetzesauslegung auch weiterhin relevant, aber nur insofern, als sie nun im Rahmen der gesetzlichen Interpretationsmethoden, z. B. als Entstehungsumstände der Normen des CIC oder als Wille des Gesetzgebers zu berücksichtigen sind“ (DRÖßLER, Bemerkungen, 17f.). Zur Bewertung einer Auslegung im „Geist des Konzils“ vor dem CIC/1983 vgl. SCHULZ, Geist, bes. 459f. sowie GEHR, Qualifikation, bes. 188–192.
80 Vgl. PAPST JOHANNES PAUL II., ApKonst „Sacra disciplinae leges“, XIII sowie dem entsprechend jüngst REES, Papst, 48: Der CIC/1983 sei „das unmittelbare Ergebnis des Zweiten Vatikanischen Konzils und von dessen Ekklesiologie her bestimmt.“
81 Vgl. PAPST JOHANNES PAUL II., ApKonst „Sacra disciplinae leges“, XIX. Dabei sei „sicher, daß die Forderungen des Konzils, wie die praktischen, dem Dienst der Kirche gegebenen Richtlinien in dem neuen Kodex genaue und gewissenhafte, bisweilen bis in die wörtliche Formulierung gehende Entsprechungen finden“ (DERS., Ansprache v. 3. Feb. 1983, 154).
82 Vgl. DERS., ApKonst „Sacra disciplinae leges“, XII.
83 DERS., Ansprache v. 26. Jan. 1984, 131.
84 Vgl. z. B. DERS., Ansprache v. 21. Nov. 1983, 518; DERS., Ansprache v. 26. Jan. 1984, 131. - Von diesem „letzten Konzilsdokument“ wünschte der Papst: „Gebe also Gott, dass […] was das Haupt anordnet, vom Leib eingehalten wird“ (DERS., ApKonst „Sacra disciplinae leges“, XIII). Damit aber besteht kein Zweifel: Für Johannes Paul II. „ist der Codex, was er nach Johannes XXIII. sein sollte: die Krönung des II. Vatikanischen Konzils“ (LÜDECKE, Codex, 45; H. i. O.). Nachdrücklich gegen diese Sicht haben sich 2007 unter dem Titel „Krönung oder Entwertung des Konzils?“ die Autor(inn)en der Festschrift für Peter Krämer ausgesprochen (vgl. DEMEL/MÜLLER, Einführung, 12f.).
85 BIER, Diözesanbischofsamt, 86. Der CIC ist die in päpstlicher Autorität vorgenommene rechtliche Transformation des II. Vatikanums (vgl. LÜDECKE, Codice, 348). Es ist daher unzulässig, das Konzil gegen den CIC auszuspielen. „Die Rezeption und die Auslegung der Konzilsdokumente seit 1983 können nicht mehr absehen von der Interpretation, die der CIC als „letztes Konzilsdokument“ implizit vorgibt.“ (BIER, Rechtsstellung, 21). Anderer Meinung ist GRAULICH, Anpassung, 388: Eine „rechte Interpretation des CIC/1983“ könne „nicht vom Kontext des Konzils und vor allem nicht von seinen Dokumenten absehen“. Der Text der Konzilsbeschlüsse gehöre „zum Kontext des Gesetzes [i. S. v. c. 17] und ist in jedem Fall von Anfang an bei seiner Interpretation zu berücksichtigen.“ (ebd., 388). Vgl. MECKEL, Aktion, 97. Bei aller inhaltlichen Kritik spricht allerdings auch HÜNERMANN, Rezeption, 87 vom CIC „als wesentlicher Form des Rezeptionsvorganges des Zweiten Vatikanischen Konzils durch Papst und Kurie“. Gleichwohl hält er Vertretern einer codexkonformen Auslegung vor, c. 17 diene ihnen „als Schutzschild, um jeden Versuch auszuschließen, unter Rückgriff auf Dokumente des II. Vatikanischen Konzils gewisse Grenzen der Gesetzestexte aufzuweisen“ (DERS., CIC, 18). Hünermann übersieht dabei, dass der kirchliche Gesetzgeber diesen „Schutzschild“ errichtet und die Ausleger(innen) darauf verpflichtet hat. Vgl. dazu im Folgenden.
86 LÜDECKE, „Krönung“, 236 sowie DERS., Codice, 348. Auch LÜDICKE, Bischofsamt, 74f. konzediert, die Konzilsbeschlüsse seien „nicht ‚geltendes Recht‘, sondern Programm für die Gestaltung des Rechtes. Dieselbe Autorität, die die Konzilsdokumente unterzeichnet hat, hat auch den Codex in Kraft gesetzt.“ Wenn dieses Programm im CIC nicht adäquat umgesetzt worden sei, bleibe es „doch das ‚Gewissen‘ des Rechtes in der Kirche, bleibt der Auftrag an den Gesetzgeber, das Leben der Kirche auch rechtlich nach der Lehre des im Konzil wirkenden Bischofskollegiums zu gestalten.“ (ebd., 75). SCHMIEDL, Ende, 18f. kann Lüdeckes Position zwar nicht zustimmen, erkennt aber an, dass sich bis heute „in allen Anweisungen und Schreiben der vatikanischen Behörden […] die Ambivalenz von Berufung auf das Konzil bei gleichzeitiger Fortschreibung seiner oft nur im Allgemeinen gebliebenen Texte“ zeigt.
87 SOCHA, in: MKCIC 17 [1990], Rn. 7 mit exemplarischem Verweis auf PREE, Interpretation, 162–163 u. 205–207; SCHULZ, Geist, 454–459 und POTZ, Interpretation, 63 u. 73–75.
88 SOCHA, in: MKCIC 17 [1990], Rn. 7. Vgl. LÜDECKE, Grundnormen, 81. Nach DRÖßLER, Bemerkungen, 14 können die Interpretationsnormen des CIC daher „als eindrucksvoller Beleg gelten für die Kontinuitätsthese bezüglich der Rechtsentwicklung in der kanonischen Gesetzgebung.“ Für JESTAEDT, Auslegung, 114f. legen die positivierten Auslegungsregeln des CIC/1983 „– nicht anders als die Rechtserzeugungsbefugnisse – beredtes Zeugnis davon ab“, dass sich die kodikarischen Normen „einem Gesetzesverständnis verpflichtet [fühlen], welches eben nicht als pluralistisch, offen oder dynamisch gekennzeichnet werden kann.“
89 Merkmal wissenschaftlicher Interpretation „ist die Berücksichtigung der kodikarischen Interpretationsnormen. Ihren Ergebnissen kommt im Unterschied zu denen, die sich auf andere oder keine Interpretationsmethoden stützen, eine Wahrheitsvermutung zu“ (LÜDECKE, Grundnormen, 78). ANDRÉS GUTIÉRREZ, Zölibat, 15 spricht in Bezug auf c. 17 1. HS sogar von „der ersten und bindenden goldenen Regel der Kirche“. Mag man das Gesetzesverständnis des CIC/1983 kanonistisch auch „bemängeln; ändern durch die methodologische Apperzeption kann man es nicht. Nicht zuletzt würden dadurch die Regeln kodikarischer Selbstauslegung missachtet – und damit geltendes Kirchenrecht verletzt! –, wenn aus – tatsächlich oder vermeintlich – höherer ekklesiologischer und kanonistischer Einsicht heraus dem kanonischen Recht ein Regime konziliar inspirierter Fremdauslegung verordnet würde“ (JESTAEDT, Auslegung, 114f.; H. i. O.).
90 Vgl. PAPST JOHANNES PAUL II., ApKonst „Sacri canones“ v. 18. Okt. 1990, 1038: „Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, qui nunc in lucem proditur, veluti novum complementum magisterii a Concilio Vaticano II propositi habendus est, quo universae Ecclesiae ordinatio canonica tandem expletur“. Vgl. LEDERHILGER, Kirchenrecht, 249.
91 MÜLLER, Kirchenrecht, 355. Für solche Ergebnisse verweist Müller exemplarisch auf die nach LÜDECKE, Grundnormen, 534 weiterhin gültige Unterscheidung von lehrender und belehrter Kirche, dessen Problematisierung der vera aequalitas des c. 208 hinsichtlich der ständischen und hierarchischen Struktur der katholischen Kirche (vgl. ebd., 103) sowie auf Biers Schlussfolgerung, die kodikarischen Bestimmungen zeichneten „den Diözesanbischof rechtlich als päpstlichen Beamten“ (BIER, Rechtsstellung, 376).
92 MAY/EGLER, Einführung, 188.
93 LÜDECKE, Grundnormen, 74. Vgl. BIER, Rechtsstellung, 22.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.