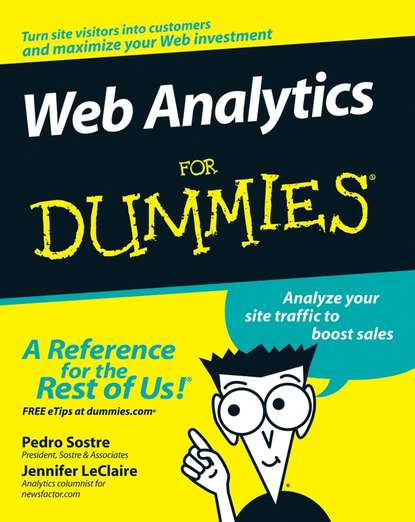Mein Onkel der Leopardenmann

- -
- 100%
- +
Bandundu beugt sich vertraulich zu mir. „Ich habe da ein Projekt, Herr Oberstleutnant“, sagt er halblaut.
„Ich bin ganz Ohr.“
„Ich schreibe an einem Buch über diese Tiermenschen. Wir müssen sie ausfindig machen. Die müssen uns helfen, verstehen Sie?“
Ich schüttle vorsichtig den Kopf.
„Ich will damit sagen …“, Bandundu zögert kurz, „… wir müssen sie in die Armee integrieren.“ Er mustert mich fast ängstlich, gewärtig, ein spöttisches Grinsen um meine Mundwinkel flackern zu sehen.
Es ist wohl dieser Blick, der es mir ermöglicht, todernst zu bleiben. „Verdammt gute Idee, Herr Oberstleutnant.“
Bandundus Augen hinter den Brillengläsern beginnen zu leuchten. „Stellen Sie sich vor: eine Krokodilkompanie, eine Leopardenkompanie, eine Schlangenkompanie … schwarze Mambas“, zischt er verschwörerisch. „Niemand könnte uns widerstehen. Und wir würden endlich von einer Armee der Verlierer zu einer Armee der Sieger werden.“ Er lehnt sich mit der Andeutung eines Seufzers zurück, das Abendrot wie den Schein der künftigen Glorie der FARDC3 auf seinem Gesicht.
Die Armee der Demokratischen Republik Kongo hat noch nie gewonnen. Ist immer nur davongelaufen. Vor allen. Seit Jahren halten ein paar hundert Rebellen in Gummistiefeln zwanzigtausend kongolesische Soldaten in der Provinz Kivu in Atem und fügen ihnen eine Schlappe nach der anderen zu. Jahrzehntelang haben Berater aus Europa, Amerika, Russland, China versucht, aus diesem korrupten Haufen eine schlagkräftige Truppe zu machen. Vergebens. Bandundu, der kühle Rechner, hat es erkannt: Der ganze westliche Firlefanz wird nie funktionieren. Die Kongolesen müssen sich selbst helfen. Die Krokodilmänner müssen her.
„Wenn ich fertig bin, übergebe ich mein Buch dem Präsidenten“, flüstert er mir zu.
„Was heckt ihr beiden da schon wieder für abenteuerliche Geschichten aus?“, bellt der Oberst Laurentiu.
„Nichts“, sagt Bandundu.
„Nichts“, sage ich. Schließlich handelt es sich um ein militärisches Geheimnis.
Ehe Laurentiu nachhaken kann, tritt Monsieur Maisha an unseren Tisch. Das Schwein sei jetzt fertig.
Als ich mich durch die knusprige Kruste säble, kommt mir ein beunruhigender Gedanke: Ob es wohl versucht hat, sich zurückzuverwandeln, als ihm Monsieur Maisha die Kehle durchgeschnitten hat? – Es gibt keine Schweinemenschen, beruhige ich mich. Aber ich wage nicht, den Oberstleutnant Bandundu danach zu fragen. Aus Angst, er könnte mit vollem Mund antworten: „Natürlich. Meine Tante zum Beispiel, die hier in Kikwit …“

Tante?
1Mützig: populäres, helles französisches Bier
2Mundele, lingala: ein Weißer
3FARDC: Forces Armées de la République Démocratique du Congo, die kongolesischen Streitkräfte
MALHEUREUSEMENT
EINE BEDAUERLICHE GESCHICHTE
Kisangani, das ehemalige Stanleyville, war einst einer der wichtigsten Handelsplätze und Verkehrsknotenpunkte am Kongo. Von hier aus ist der große Fluss schiffbar. Ältere Menschen erinnern sich noch an die Zeit, als in Kisangani regelmäßig Passagier- und Frachtschiffe an- und ablegten, die Kräne quietschten und Eisenbahnzüge in Richtung Osten rollten. Nach fünfundfünfzig Jahren Unabhängigkeit ist davon nicht viel mehr übrig als eine Handvoll Einbäume. Malheureusement.
„Schlau, wie du hier die Gegenströmung ausnützt“, sage ich zu dem Mann, der im Heck des Einbaums steht und das spitze Ruderblatt durch die braunen Strudel des Kongo zieht. Wir sind unterwegs zum rive gauche, dem pittoresken ehemaligen Villenviertel von Kisangani am linken Ufer des Kongo.
Der schlaue Fährmann nickt zwischen angespannten Nackenmuskeln. „Malheureusement“, setzt er dann an, und ich wünsche mir wieder einmal, ich hätte den Mund gehalten.
„Malheureusement“, „bedauerlicherweise“, ist der rituelle Auftakt jeder neuen Strophe des Großen Kongolesischen Klageliedes. Ich bin inzwischen überzeugt, dass so ziemlich jeder Kongolese spätestens bei der Erstkommunion (oder wahlweise der ersten Anprobe des Penisköchers) einen heiligen Eid ablegen muss, es sofort anzustimmen, sobald ein Mundele die geringsten Anzeichen zeigt, sich für seine Lebensumstände zu interessieren. Ein schlichtes „Guten Tag“ kann schon verhängnisvoll sein. Auf das „Malheureusement“ folgt gewöhnlich eine Schilderung der eigenen trostlosen Lage – die kranke Frau und die drogensüchtigen Kinder etwa – gefolgt von einer Darstellung der unhaltbaren Wirtschaftssituation, der Korruption, des Krieges, kurz: des Leids des Schwarzen Kontinents. Und über all dem schwebt ein großer, stiller Vorwurf. Denn wir wissen doch beide, mein Bruder mit der trügerisch unschuldigen, weißen Haut, wer in Wahrheit schuld ist an der ganzen Misere hier. Und daher hielte ich einen kleinen Wiedergutmachungsbeitrag hier und jetzt in meine aufgehaltene Hand für das Mindeste.

Im EInbaum
Ich schalte meine Hirnschleuse auf Durchzug, während das Lied des Fährmanns dahinströmt wie der große, träge Fluss, den wir queren. „Gibt keine Arbeit und keinen Lohn in diesem Land“, sagt er, während seine sehnigen Arme vor Schweiß glänzen. Wir haben für die Überfahrt den stolzen Weißenpreis von fünfzehn Dollar vereinbart. Fünfzehn Dollar für eine Stunde Arbeit. Ein kongolesischer Admiral verdient hundert Dollar im Monat. Ich wünsche mir, mein Kamerad, der Konteradmiral Jean de Dieu Amisi, wäre mit an Bord. „Maul halten und rudern!“, würde der zu seinem Landsmann sagen. Kongolesen sind im Umgang miteinander von einer erfrischenden Direktheit. Lingala, die Sprache, die an den Ufern des Großen Flusses gesprochen wird, kennt weder ein Wort für „bitte“ noch eines für „danke“. Ja, der Admiral Amisi würde seine Botschaft klar an den Mann bringen. Leider hat er die Überfahrt aufs rive gauche ebenso klar abgelehnt. Nicht im Einbaum, hat er gesagt, nicht bei all den Krokodilen, die sich hier herumtreiben.
Malheureusement sehe ich kein einziges Krokodil, bis sich der Bug unserer Quasselbarke endlich ans linke Ufer schiebt. „Nichts als Arbeitslose!“, keift mir der Fährmann nach. „Rückfahrt in einer Stunde“, rufe ich ihm über die Schulter zu und springe erleichtert an Land.
Viktor, mein Chauffeur, der die ganze Überfahrt lang geschwiegen hat, führt mich die Allee hinauf, an der die alten Villen stehen. Es ist ein bisschen wie in einem tropischen Zentralfriedhof. Die verfallenden Häuser der gefallenen Kolonialherren sind zu Mausoleen ihrer selbst geworden. In allen Stadien der Verwesung schielen sie uns aus leeren Fensterhöhlen nach.

Das Villenmausoleum von Kisangani
„Muss einmal schön gewesen sein hier“, liegt mir auf der Zunge. Ich schlucke es schnell hinunter, um den angenehm schweigsamen Viktor nicht zu einem Malheureusement zu provozieren.
Dabei fällt mir ein kongolesischer General ein, den ich auf den reparaturbedürftigen Zustand der Wasserleitung in seiner Kaserne angesprochen habe. „Haben die Belgier gebaut“, hat er geantwortet, „malheureusement haben sie sie nicht in Stand gehalten.“ Eine Feststellung, in der rechtschaffene Empörung über diese pflichtvergessenen Hallodris mitgeschwungen ist.

Grasende Dampflok
Aus dem brusthohen Gras zu meiner Linken schiebt sich der Schlot einer abenteuerlustigen kleinen Dampflokomotive. Ich reibe mir die Augen.
„Der alte Bahnhof“, erklärt Viktor.
Ich zücke meinen Fotoapparat.
„Oho, so geht das nicht!“, tönt es von links unten. An der Wand eines heruntergekommenen Stationsgebäudes lungern drei Müßiggänger. Oder Eisenbahner, was bösen Zungen zufolge fast dasselbe ist. Im Kongo mehr als anderswo.
Ich stelle mich vor und werde an den Herrn Inspektor verwiesen, der im Erdgeschoss des Gebäudes logiert. „Kein Problem“, sagt der Herr Inspektor auf meine Bitte um einen kleinen Bahnhofsrundgang. Er werde mir sogleich einen Termin beim Herrn Bahnhofsvorstand arrangieren. Ein weiterer Bediensteter wird in den ersten Stock geschickt, um mich anzukündigen. Insgesamt entdecke ich etwa ein Dutzend Männer, die sich in dem Stationsgebäude verstecken. Wenig später werde ich nach oben gebeten. Eine steile, breite Treppe, Teakholz geölt, führt mich in das schönste Büro, das ich im Kongo je gesehen habe: holzgetäfelt bis an die Decke, schwere, messingbeschlagene Möbel aus den Dreißigerjahren. Der Bahnhofsvorstand ist etwas jünger, ein jovialer Herr Mitte sechzig, schätze ich. Ich entschuldige mich dafür, ihm seine kostbare Zeit zu stehlen, und er lächelt müde.
Malheureusement verkehre von diesem Bahnhof nur mehr ein Zug pro Woche. Ich wundere mich, dass überhaupt noch einer fährt, denn die Geleise sind unter dem hohen Gras kaum zu erkennen.
Der Bahnhofsvorstand führt mich auf seinen kleinen Balkon und zeigt mir die Kräne, die unten am Flussufer aufragen. Da hätten früher die Schiffe aus Kinshasa angelegt, sagt er. Ihre Fracht sei direkt auf die Züge verladen und weiter in Richtung Osten transportiert worden.

Im Bahnhofsviertel
Ob die Kräne noch funktionierten.
Aber nein!
Warum sie dann noch herumstünden?
„Malheureusement“, sagt der Bahnhofsvorstand, „fehlen uns die Mittel, um sie abzubauen.“
Ein weiterer Kernsatz in der Mannwerdung des jungen Kongolesen: Wenn dich wer fragt, warum du nicht tust, was getan werden sollte, sag einfach: „Bedauerlicherweise fehlen uns die Mittel.“
Ich erinnere mich an einen Oberst, den ich aufgefordert habe, die Lagekarte an die Wand seines Büros zu hängen, damit alle sie sehen könnten. „Malheureusement fehlen uns dafür die Mittel“, hat er mir gesagt, ohne im Geringsten rot zu werden. Mit dem Schämen haben es manche Kongolesen nicht so.

„Einbaum auf Bahnsteig 1 zum Einsteigen bereit!“
Schließlich wird der Inspektor angewiesen, uns eine kleine Führung über das Bahnhofsgelände zu geben. Er zeigt uns einen Werkzeugschuppen, eine ausgeschlachtete Diesellok, verrostete Waggons im Grünen, einen Einbaum am Trockenen. Was zum Teufel macht der da?
Diebe, erklärt der Inspektor. Sie seien damit über den Fluss gekommen, um Eisenteile zu stehlen. Man habe sie vertrieben und ihr Flaggschiff hierhergeschafft. Gute Idee, finde ich. So hat keiner was davon. Eine klassische Lose-Lose-Situation.
Nach einer knappen Stunde verlassen Viktor und ich den freundlichen Hafenbahnhof und schlendern still zurück durch die Allee der Toten Villen. „Muss wirklich schön gewesen sein hier in der Kolonialzeit“, entschlüpft es mir zu meinem eigenen Schrecken.
Viktor blickt auf. „Malheureusement“, hebt er an, wie das Gesetz des Dschungels es befiehlt. „Malheureusement sind wir keine Kolonie mehr.“
GUESTHOUSE MELISSA
MITTAGSMAHL UND MODESCHAU
Kinshasa ist eine Stadt von ungefähr vierzehn Millionen Einwohnern, genau weiß das niemand. Wer dort fein essen gehen möchte und genügend Geld im Sack hat, kann sich an ausgezeichneter französischer, italienischer oder chinesischer Küche delektieren. Aber dazu muss man nicht über den Äquator fliegen, oder? Also ab in ein richtig kongolesisches Etablissement.

Ruhe vor dem Sturm
Das Guesthouse Melissa ist leer. Mehr als leer. Verlassen. Der ummauerte Innenhof wirkt, als hätte sich seit Jahren keiner mehr hineingetraut. Der Pool in der Mitte erinnert an einen aufgelassenen Fischteich, auf dessen trübem Grund vielleicht noch der eine oder andere bemooste Karpfen schief seine Kreise zieht.
Wir schauen Hendryk an. „Freunde“, hat Hendryk am Vortag gesagt, „morgen machen wir einmal was anderes: Wir feiern mit meinen kongolesischen Bekannten. Mittagessen und Modeschau im Guesthouse Melissa in Limete.“
Wir hätten es natürlich besser wissen müssen. Es ist Vorsicht geboten, wenn ein Etablissement sich „Melissa“ nennt. Und ganz besonders, wenn es sich in Limete befindet, der Bronx von Kinshasa. Aber nun sind wir einmal hier, am bröckelnden Ufer des Moderpools, und es ist keiner mehr da. Was wiederum kein Wunder ist, denn das Mittagessen war auf zwölf Uhr dreißig angesetzt. Jetzt ist es vierzehn Uhr dreißig. Schuld ist Arlette.
Arlette ist Hendryks kongolesische Freundin, eine hübsche, rundliche Person, deren erste große Liebe wohl noch in die Zeit des seligen Diktators Mobutu fällt. Hendryk trägt sie auf Händen, ungeachtet ihrer schwerwiegenden Hüften. Im Augenblick aber wirkt Hendryk ein wenig genervt, denn wie gesagt: Arlette ist schuld an unserer Verspätung. Als wir aufbrechen wollten, war sie noch im „Salon“, einer Bretterbude in einer staubigen Straße von Limete, um sich ihr Haarteil anheften zu lassen, einen verwegenen Dutt, der ein wenig an einen Bandkeramikbecher aus schwarzem Plastik erinnert. Dann hat sie drei ihrer Pagnes1 probiert, nur um sich schließlich für einen einzigartig unspektakulären Minihosenrock zu entscheiden, der ihre Hüften zur Geltung bringt. Vorteilhaft? – Fragen Sie nicht. Hendryks vorwurfsvolle Blicke bringen sie nicht im Geringsten in Verlegenheit. Im Gegenteil, Arlette lacht. „Das habt ihr jetzt von eurer Hetzerei. Das ist ein kongolesisches Mittagessen!“
„Das ist gar kein Mittagessen“, maule ich.
Arlette lächelt weiter: „Wir sind die Ersten.“
Balu der Bär ist der Erste von uns, der sich wieder fängt. L’ours Balou ist der Spitzname von Philippe, dem französischen Fallschirmpionier. (Sachen gibt’s in der französischen Armee!) Philippe probierts mit Gemütlichkeit, die sich auch einstellt, als nach einer gefühlten halben Stunde eine Kellnerin aus dem Haus schlurft. Ihr Gang sagt deutlich, dass es hart ist, am Teich der Toten Karpfen zu leben. Aber schließlich kredenzt sie uns doch eine Runde Bier.
„A votre soif “2, sagt Balu und lehnt sich in seinem hellblauen Plastiksessel zurück. Balu weiß, was Durst ist. Er war schon in Mali, an der Elfenbeinküste und im Tschad eingesetzt und hat kürzlich eine Uhr für Afrikaner konstruiert, erzählt er. Das Ziffernblatt halb weiß, halb schwarz; nur zwei Anzeigen: Tag – Nacht.
Alle lachen, bis auf Arlette. Die nickt zufrieden: „Endlich hat einer von euch Mundele3 kapiert, was wesentlich ist.“
Eine Stunde später wird der Grill hereingetragen. Als die Dämmerung hereinbricht, ist die Holzkohlenglut so weit, dass man die ersten Würste auflegen kann. Uns wird bis dahin nicht fad, denn schön langsam tröpfeln andere frühe Gäste in den Hof. Und die sind sehenswert. Schließlich kommt man zu einer Modeschau, und da präsentiert man seinen feinsten Zwirn. Das Wetter begünstigt kühne Kombinationen, denn es ist Winter in Kinshasa. Das Thermometer fällt auf klirrende siebenundzwanzig Grad. Wann, wenn nicht jetzt, kann man seine Pelzjacke ausführen. Zu Shorts, versteht sich – und immer cool bleiben, Moninga!4

„Cool, Moninga!“
Die Würste sind perfekt, ebenso wie die Pommes frites, von den Kongolesen liebevoll Fou-fou belge genannt, belgisches Fou-fou.5
Jetzt fehlt nur noch die Modeschau. Leider lässt es sich die veranstaltende Agentur nicht nehmen, zuerst ihre anderen Künstler zu präsentieren. Das Programm beginnt mit einem Komödianten, der uns zwanzig Minuten lang mit einem Monolog bearbeitet, der nach einer wüsten Schimpftirade klingt, die wir nicht verstehen, und die niemand lustig findet. Ich an seiner Stelle hätte mich nach spätestens zehn Minuten im Pool ersäuft. Er aber ist völlig schmerzfrei. „Wie war ich?“, fragt er mich nach seinem von allen heiß ersehnten Abgang. „Kitoko mingi – Spitzenklasse“, antworte ich. Ich muss mich einmal erkundigen, was „Schleimer“ auf Lingala heißt.
Danach kommt eine Boygroup, die es schafft, die kongolesische Rumba zu so etwas wie Hip-Hop zu vergewaltigen. Wobei Kenner natürlich wissen, dass die kongolesische Rumba die Wurzel aller populären Musik ist.6

Am Catwalk von Limete
Wie auch immer, selbst Balu der Bär drängt mittlerweile zum Aufbruch. Ich muss meine Freunde mit einer weiteren Runde Bier zum Bleiben zwingen. Eine lohnende Investition, zeigt sich gegen zweiundzwanzig Uhr. Denn die Modeschau auf den geborstenen Fliesen rund um den Weiher der Verzweifelten Welse reißt alle vom Hocker, die sich von diesem Abend nicht mehr viel erwartet haben. Die natürliche Anmut, mit der sich die Models aus der Gosse von Limete bewegen, ist atemberaubend.
Noch während die Rufe nach Zugabe über den Pool wogen, geselle ich mich zur Chefin der Agentur, die aus dem Hintergrund heraus zufrieden ihren Erfolg belauert. Madame Carine ist von einer etwas unheimlichen Schönheit; ein ehemaliges Topmodel, sagt sie. Ich bin geneigt, ihr aufs Wort zu glauben. Ihre sanfte, tiefe Stimme ist berückend. „Tanz, Gesang, Sprache, Auftreten, das ist es, was wir unseren Künstlern vermitteln. Unser Traum …“, ihr Blick scheint sich kurz in einer smaragdenen Zukunft zu verlieren, „… unser Traum ist, dass vielleicht einer von ihnen einmal ein echter Filmstar wird.“
Recht so, Madame Carine! Wo wären wir ohne unsere Träume!
„Wir wollen diesen jungen Menschen von der Straße helfen, es im Leben zu etwas zu bringen.“
Großartig, Madame, ich bewundere Sie!
„Freilich sind unsere Mittel begrenzt.“ – Oh, oh, das Gespräch nimmt eine beunruhigende Wendung. Plötzlich bin ich es, den Madame belauert. Ich bin Beute, wird mir klar, denn ich bin ein Mundele. Und die Mundele kommen gemeinhin nicht in den Kongo, um sich zu amüsieren (was man daran erkennt, dass sie 1. nicht tanzen können und 2. die kongolesische Rumba nicht zu schätzen wissen). Nein, die Mundele kommen, um zu helfen. Auf gut Lingala: um Hinz und Kunz Geld in den Rachen zu stopfen. Also warum nicht auch jungen, künftigen Filmstars aus dem Guesthouse Melissa?

Madame Carine
„Wir haben noch nicht einmal eigene Proberäumlichkeiten“, schnurrt Madame Carine.
„Echt schlimm. Aber das wird schon. Bon courage, Madame.“ Ich weiche einen halben Schritt zurück.
Aber die Mutter Teresa von Limete gibt nicht auf. Ihre schläfrigen Augen weiten sich, und ich muss plötzlich an die Schlange Kaa denken. Ich werfe einen hilfesuchenden Blick hinüber zu Balu dem Bären, aber der ist gerade beim Zahlen. Ich werde weich. „Na ja, ich kenne natürlich schon ein paar Leute, die immer wieder große Feste geben.“
„Wunderbar. Wir vermitteln auch Musiker und Servierkräfte.“
Warum eigentlich nicht? Warum sollte ich mich nicht ein wenig engagieren als Vermittler zwischen den Welten, um den Kassenmagneten von morgen aus der Patsche zu helfen. Wer weiß, vielleicht hat ja auch eine Halle Berry einmal am Fischteich angefangen. Ich bin drauf und dran, Madame Carine meine Visitenkarte zu übergeben.
„Natürlich stellen wir auch Komödianten.“
Nein, um Himmels willen! Der Bann ist gebrochen. „Ein unvergesslicher Bursche, Madame. Ich werde darüber nachdenken. Es war sehr schön, au revoir!“ Ich reiße mich los und haste meinen Kameraden nach, die sich anschicken, den Hof zu verlassen. Ehe ich das Tor erreiche, schleudert mir Madame Carine ihren letzten Trumpf nach: „Babysitter! Wir vermitteln auch Babysitter!“
Am Weg zum Auto laufe ich dem Burschen mit der Pelzjacke in die Arme, den ich am Nachmittag fotografiert habe. „Wie wär’s mit einem kleinen Bier, Moninga?“, ruft er.
Entkräftet von meiner Begegnung mit Madame Carine drücke ich ihm tausend Kongolesische Francs7 in die Hand. So viel kostet ein kleines Bier im Guesthouse Melissa. Was wäre ich schließlich für ein Mundele, wenn ich nicht einem alten Freund ein Bierchen spendierte? Zum Mittagessen.
1Pagnes: die farbenfrohen, gemusterten Kleider der zentralafrikanischen Frauen
2„A votre soif“: „Auf euren Durst.“
3Mundele: die Weißen
4Moninga, lingala: Kumpel, „brother“
5Fou-fou: Knödel aus Maniokmehl, Hauptnahrungsmittel der Kongolesen
6Siehe auch „Jazz au jardin“ aus der Reihe „Kongolesische Nächte“ desselben Autors
71000 Kongolesische Francs: ca. 1 Euro
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.