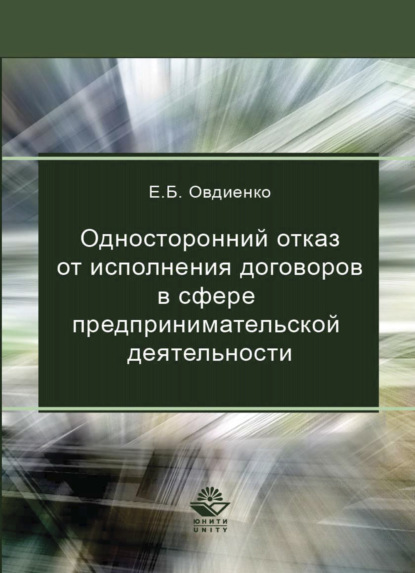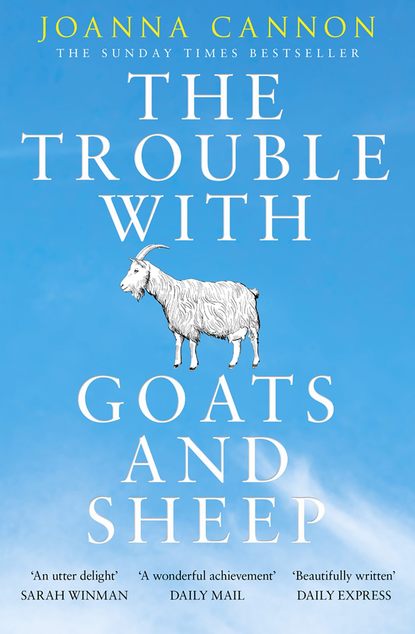- -
- 100%
- +
Ich versuchte mir das vorzustellen. In den Artikeln hatte ich nichts darüber gefunden, ob beide Russisch konnten. Aber selbst wenn. Man wäre damit nicht weit gekommen, lebten doch vor allem Chinesen, koreanische Fischer und irgendwelche nordsibirischen Ureinwohner in Wladiwostok. Stämme, von denen ich noch nie etwas gehört hatte: Jurchen, Mandschu und Golden.
Was also mochte sie damals dazu bewegt haben, sich in dieser gottverlassenen Einöde anzusiedeln? Eine Gegend, in der von September bis Mai Winter herrschte, wo es gerade einmal ein paar Holzhütten mit nicht einmal hundert Einwohnern gab? Mir war es unbegreiflich, denn Wladiwostok war ein winziger Marinevorposten, der gerade zwei Jahre zuvor gegründet worden war. Dort gab es weder die Verlockungen einer Großstadt, die die gebürtigen Hamburger aus eigenem Erleben kannten, noch die klimatischen Vorzüge südlicher Gefilde. Vielleicht war es einfach der Erfolg, der sie beflügelte und die unendlichen Möglichkeiten, die sie als Unternehmer in Wladiwostok hatten. Sie waren jung, hier konnten sie ausprobieren, was in Hamburg nie gegangen wäre. In kürzester Zeit wurden sie unsagbar reich. Mit dem Ersten Weltkrieg kam der Niedergang. Die Deutschen waren schließlich Kriegsgegner. Adolph Dattan wurde wegen Spionage verhaftet und für Jahre ins Innere Sibirien verbannt. Dann kamen die Bolschewiki an die Macht. Wladiwostok erreichten sie 1925. Sie läuteten unwiderruflich das Ende ein. Das Unternehmen hielt sich trotzdem noch bis 1930.
Was passierte in den letzten Jahren und wie konnte das alles überhaupt gehen?
Mit diesen Fragen und den ersten, eher diffusen Eindrücken kam ich nach Naumburg, wo ich Siegfried Bornecker und seine Schwester Ursula treffen sollte. Die Bahn machte dem perfekten Ablaufplan Borneckers einen Strich durch die Rechnung. Beide hatten Verspätung. Ich wartete wie verabredet in der Bahnhofsbäckerei.
Zuerst kam Ursula, eine kleine, zierliche Dame mit offenem und interessiert verschmitztem Blick. Ursula ging am Stock. Den habe sie nur, erklärte sie lachend, weil die Passanten so furchtbar nett wären. Seitdem sie den Stock habe, würde man in der Bahn für sie aufstehen und ihr sogar die Einkäufe in ihre Wohnung tragen. Im rauen Berlin war das etwas wert. Eigentlich bräuchte sie ihn nicht, denn sie sei noch gut zu Fuß. Und in der Tat, vor mir stand eine agile Person, die ich deutlich jünger geschätzt hatte. Ursula lächelte und ihre wachen Augen verliehen ihr trotz ihres hohen Alters einen Hauch Jugendlichkeit. Kaum hatte sie Platz genommen, erzählte sie von ihrem Leben und überhäufte mich mit einem Schwall an Fragen. Dann hielt sie plötzlich inne, griff meinen Arm, schüttelte den Kopf und lachte über sich selbst.
„Ich weiß, ich weiß. Ich bin immer so. Aber ich kann mich nur schwer zurückhalten, denn mich interessiert so vieles … Was mich aber am meisten interessiert, ist, wie Sie zu Russland gekommen sind? Was hat Sie zu den Russen gebracht?“
Ich fand sie großartig und dachte etwas beklommen an Paul, meinen achtzehnjährigen Sohn, und an diese Facebook-Generation, die so überhaupt nicht neugierig schien und offenbar nie den Drang verspürte, jenseits von Wikipedia einer Sache auf den Grund zu gehen. Die Gemütlichen, die kaum noch aus ihren Zimmern rauskamen, die keine Fragen stellten, nicht provozierten, sondern sich mit einem Brei aus Filmchen, lustigen Spots und den Posts der „Freunde“ begnügten. Dieses Rumhängen machte mir manchmal Angst.
Ich erzählte Ursula wie alles angefangen hatte. Nach einer Viertelstunde waren wir so ins Gespräch vertieft, dass sich Siegfried Bornecker vor uns stehend durch lautes Räuspern bemerkbar machen musste. Alle drei lachten wir. Auch Bornecker sah viel jünger aus, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Er trug einen Rucksack, der überhaupt nicht zu seinem Mantel aus edlem Zwirn passte. Bornecker war braun gebrannt und wirkte insgesamt sehr vital, keineswegs wie ein Rentner jenseits der achtzig. Er meinte, er käme gerade aus Italien – Skifahren in den Dolomiten. Von München aus sei das ja nicht weit …
Wie geplant fuhren wir mit dem Taxi zum Dom und gingen in eines der beiden Gasthäuser. Siegfried Bornecker ging zielstrebig voran und wählte einen geeigneten Tisch für unser Vorhaben – hell genug und groß genug. Es war bizarr, denn er betrachtete den Schankraum als sein ausgelagertes Büro. Bornecker nahm den Tisch in Beschlag, breitete Unterlagen darauf aus und schickte den Kellner, der unsere Bestellung aufnehmen wollte, zwei Mal weg. Ich fragte mich, ob das der übliche Gang der Dinge war, wenn sie für ein paar Stunden nach Naumburg einflogen, um ihre Geschäfte zu erledigen. Der Kellner tat mir leid, aber ich wollte mich nicht einmischen. Wir hatten so viel zu erzählen, dass auch ich es als störend empfunden hätte, etwas zu essen. Als der Kellner den dritten Anlauf nahm, bestellten wir schließlich.
Ich mochte beide auf Anhieb. Die Art, wie sie von ihren Großeltern sprachen, die Ernsthaftigkeit, mit der Siegfried Bornecker versuchte, die letzten Rätsel des Verschwindens seines Großvaters zu entschlüsseln, ohne dabei verbohrt zu sein, imponierte mir. Und mir gefiel eines ganz besonders. Obwohl die Familie damals den Großteil ihres Besitzes verloren hatte, Adolph Dattan ohne Grund in der Verbannung hatte ausharren müssen und dann von Sowjets zur Geschäftsaufgabe gezwungen wurde, hegten sie keinen Groll gegen Russen. Vielleicht war es einfach zu lange her. Siegfried und Ursula waren in Hamburg groß geworden, sie hatten nie einen unmittelbaren Bezug zum Naumburger Familiensitz gehabt, weil dieser in der „Ostzone“ lag. Sie hatten nie in einer Diktatur gelebt und deshalb betrachteten sie das Unrecht, das der Familie angetan wurde, nie als ihrige. Es war etwas, das nicht unmittelbar sie betraf. Wahrscheinlich lag es auch daran, dass Adolph Dattan trotz des immensen Verlustes nicht als Armer zurückgekehrt war. Er hatte seiner Familie einiges hinterlassen, zumindest schienen sie nicht an materieller Not zu leiden. Was sollten sie also verflossenem Geld nachtrauern?
Kaum hatten wir gegessen, kam auch schon der Schornsteinfeger, um die Kehrmodalitäten für verschiedene Immobilien zu klären. Auf dem Tisch häuften sich die Papiere. Einzugsermächtigungen wurden erteilt, Rechnungen geprüft, Gutachten in Auftrag gegeben. Immerhin durfte der Kellner jetzt ohne zweite Nachfrage einen Kaffee bringen. Es amüsierte mich, Ursula und Siegfried bei ihren Geschäften zu beobachten, weil sie so normal bodenständig waren und fast beschaulich wirkten, obwohl sie hier am Tisch Millionenobjekte verwalteten.
Der Handwerker verschwand und uns blieb nur noch eine Viertelstunde bis zum nächsten Termin in der Dattan-Villa. Bislang hatten wir nur geplaudert, aber nichts Handfestes verabredet. Ich wusste nicht einmal, ob ich nun die Richtige war. Offenbar hatte Siegfried Bornecker bemerkt, dass ich darüber nachdachte.
„Wissen Sie Frau Stehr, wir wollen niemandem schaden. Wir wollen nichts zurückhaben. Jahrzehntelang haben wir nicht einmal gewusst, dass es das alles noch gibt – die Kaufhäuser, die Wohnhäuser, das Elektrizitätswerk und die Landhäuser. Meine Mutter hatte mir von klein auf eingetrichtert, dass ich nie nach Russland fahren dürfe, weil dort das Böse warte. Ich musste ihr das hoch und heilig versprechen. Und daran habe ich mich gehalten. 1997 ist sie dann gestorben und drei Jahre später bin ich das erste Mal gefahren. Es war wie eine Reise in eine andere Welt. Die Vorstellung, dass mein Großvater dies alles mitgeschaffen haben sollte, kam mir fast unheimlich vor. Ab da begann mich das ganz konkret zu interessieren, weil ich ein Bild im Kopf hatte. Ich fing an, nach allen nur denkbaren Hinweisen zur Familiengeschichte zu suchen. Und ich erfuhr, dass mein Großvater offenbar Tagebuch geführt hatte. Ich wusste es von Georg Albers. Er hatte die Geschäfte von seinem Vater übernommen. Und dieser hatte damals eine Firmenchronik zum 75-jährigen Geschäftsjubiläum herausgegeben. Georg Albers war im Besitz der Unterlagen. Bei meinem Besuch merkte ich sofort, dass ich nicht sonderlich willkommen war, auch wenn er sich höflich und korrekt verhielt. Es war eine kühle Atmosphäre, eine unnahbare Stimmung, die vor allem von seiner Frau ausging. Vielleicht hätte er allein sich ganz anders verhalten, aber seine Gattin ließ nur ein kurzes Gespräch unter vier Augen zu. Irgendetwas schien ihr zu missfallen. Mir war klar, dass ich Albers bei diesem Treffen regelrecht ausquetschen musste. Ich wollte so viel wie möglich erfahren und alle verfügbaren Materialien bekommen, ahnte ich doch, dass es keinen zweiten Besuch geben würde. Albers gab mir einiges, darunter ein paar lose Seiten, die wie Tagebuchnotizen aussahen, jedoch fehlten Datums- oder Ortsangaben. Jahre später sortierte ich den Nachlass meines Onkels Gori.“
Siegfried Bornecker hielt inne.
„Warum erzähle ich Ihnen das, Anna?“ Er schaute mich eindringlich und auffordernd an. Doch ich wollte nichts sagen, sondern einfach nur zuhören. Deshalb zuckte ich bloß mit den Schultern und machte ein fragendes Gesicht.
„Weil Gori etwas hatte, worum es uns hier und heute geht. Wissen Sie, was ich zwischen dem ganzen Schriftkram, den er gehortet hatte, fand?“ Ich schüttelte den Kopf.
„Tagebuchnotizen von meinem Großvater. Er hatte in der Verbannung Tagebuch geschrieben. Es waren keine hastigen Notizen, handschriftlich mit dem Bleistift gekritzelt, sondern ausführliche Reflexionen, säuberlich mit der Schreibmaschine getippt. Darunter auch die Blätter, die ich bereits von Albers erhalten hatte und nicht einordnen konnte. Nun wusste ich, was es damit auf sich hatte. Diese Notizen hatten ein Deckblatt. Und nur wegen dieser einen Seite sitzen wir heute hier zusammen.“
Ich grübelte, was auf dieser einen Seite gestanden haben mochte. Es musste etwas gewesen sein, das nun von außerordentlicher Bedeutung war. Was steht auf so einem Deckblatt? Der Name, vielleicht auch noch Ort und Zeitpunkt der Aufzeichnung. Was sollte daran also so besonders, so außergewöhnlich sein? Bornecker wusste doch, wo sein Großvater in der Verbannung gesteckt hatte. Auch den Zeitraum hatte er mir genannt. Was also bewegte ihn so dermaßen?
Dann holte er dieses eine, dieses wichtige Blatt aus einer Mappe und legte es vor mir auf den Tisch. Ich schaute auf das Blatt und Bornecker beobachtete mich dabei ganz genau. Und auf einmal war mir klar, dass das die Prüfung war. Das, was ich nun sagen würde, entschied darüber, ob ich den Auftrag erhielt oder nicht. Ich las:
A. Dattan
MEINE VERBANNUNG IN DEN NARYMER KREIS,
Gouvernement Tomsk, West-Sibirien.
IV. Teil
Von Januar 1919 bis Januar 1920
Bornecker schaute mich noch immer prüfend an. Ich kam mir vor, wie ein rettender Prinz im Märchen. Einer, der den Drachen in der Höhle besiegen musste, um die Prinzessin zu retten. Einer, der nur dann Zutritt zur Drachenhöhle erhielt, nachdem er die alles entscheidende Frage richtig beantwortet hatte.
Aber ich hatte keine Ahnung. Was sollte ich sagen? Was ich las, war belanglos. Es war banal. Ich schaute noch einmal auf die fünf Zeilen und dann ging mir ein Licht auf. Aber natürlich … Ich hatte gelesen, dass Adolph Dattan bereits im Januar 1915 verbannt worden war. Das war es, vor mir lag das Deckblatt vom vierten Teil. Es musste noch mindestens drei weitere Teile geben.
„Sie suchen Teil 1, 2 und 3, Herr Bornecker. Habe ich recht? Und ich soll sie Ihnen beschaffen, aus Russland, stimmt’s?“
Bornecker strahlte. Die Drachenhöhle öffnete sich und die Rettung der Prinzessin konnte beginnen.
Danach ging alles ganz schnell. Wir beredeten ein paar organisatorische Dinge und verabredeten ein nächstes Treffen. Als wir das Café verließen, wurde Siegfried Bornecker plötzlich wieder ernst.
„Wissen Sie Frau Stehr, Sie haben zwar gesagt, dass ich fit und jung aussehe. Das war sehr charmant, aber man weiß nie, was passiert. Im Oktober haben wir unser Familientreffen. Alle zwei Jahre kommen die Dattan-Erben zusammen, es ist mittlerweile ein Großereignis. Ich würde gern bis dahin die Sammlung abschließen. Und ich möchte gern eine Chronik der Unternehmensgeschichte in Auftrag geben.
Wissen Sie, das Jahr 2014 ist ein besonderes Jahr. Vor 150 Jahren begann alles, dort im wilden Osten, bei den vierundvierzig Holzhütten. Am 16. September 1864 erreichte die Meta mit der ersten Hamburger Warenladung den Hafen von Wladiwostok. Ich möchte ein Buch schreiben, aber dazu brauche ich Sie. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, glauben Sie mir, Anna.“
Was sollte ich dazu sagen? Ich wusste nicht, ob ich diesen Erwartungen je gerecht werden könnte. Was wäre, wenn ich nichts finden würde? Die Enttäuschung wäre größer denn je. Ich dachte plötzlich wieder an die Annonce: Bei zufriedenstellenden Rechercheergebnissen erwartet den Bewerber eine überdurchschnittliche Bezahlung. So ein Quatsch – zufriedenstellende Rechercheergebnisse … Was wäre zufriedenstellend? Nur das Tagebuch. Was wäre, wenn ich nichts oder etwas ganz anderes entdecken würde? Kein ernst zu nehmender Forscher konnte das Ergebnis vorhersehen. Kein seriöser Wissenschaftler konnte sich auf so etwas einlassen. Ich war Historikerin, kein Detektiv. Ich musste die Reißleine ziehen, auch wenn ich ihm gern geholfen hätte, auch wenn ich gern nach Russland gefahren wäre. Die Erwartungen waren einfach zu hoch.
„Es tut mir schrecklich leid, Herr Bornecker, aber es geht doch nicht. Ich kann den Auftrag nicht annehmen.“
Siegfried Bornecker sah mich entsetzt an. Es war, als ob ich ihm ins Gesicht geschlagen hätte.
„Ich kann Ihnen das nicht versprechen. Das Tagebuch kann überall sein, wenn es überhaupt noch existiert. Wer weiß, ob es nicht zerstört wurde, ob es überhaupt in Russland liegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es finde, ist winzig klein. Vielleicht entdecke ich stattdessen Dinge, die nicht in Ihr Bild passen, von denen Sie lieber nichts wissen wollen. Vielleicht ist es besser, sich mit den Lücken abzufinden.“
Plötzlich lachte Bornecker. Ich wusste nicht, was es da zu Lachen gab, denn ich hatte ihm gerade eine Abfuhr erteilt.
„Ich habe Sie richtig eingeschätzt, Anna. Ich wusste, dass Sie das sagen würden, ich wusste, dass Sie zweifeln würden, weil Sie die Sache ernst nehmen. Das beruhigt mich. Und trotzdem. Wenn ich suche, ist die Chance noch unvergleichlich viel kleiner. Sie fahren, Anna Stehr. Ich weiß, Sie sind die Richtige. Wenn jemand etwas findet, dann Sie. Den Test mit dem Deckblatt habe ich mit drei Historikern gemacht. Mit drei renommierten Historikern, wohlgemerkt. Der Erste hat minutenlang das Papier studiert und aus der Analyse der Fasern das Alter des Blattes geschlussfolgert. Der Zweite hat mir einen Vortrag über die Schrifttype der verwendeten Schreibmaschine gehalten und die Vorzüge der Erika Nr. 1, der ersten deutschen Reiseschreibmaschine, gepriesen. Und wissen Sie, was der Dritte gesagt hat? Dass der Narymer Kreis nach der Gebietsreform von 1918 genau genommen gar nicht mehr im Gouvernement Tomsk lag, sondern knapp hinter der Grenzlinie. Ich kann das alles nicht beurteilen Anna, aber auf das Naheliegende ist keiner dieser drei Experten gekommen, weil sie zu spezialisiert sind – Gefangene in ihrem Elfenbeinturm der Wissenschaft. Sie sind anders, Anna. Sie wissen auch viel, aber Sie sind trotzdem normal und haben einen klaren Blick. Sie denken logisch und trotzdem haben Sie sich die Neugier eines Kindes bewahrt. Ich weiß, das klingt schrecklich naiv und kitschig, aber es ist so. Und deshalb werden Sie fahren, Anna. Wenn Sie nichts finden, bin ich der Letzte, der damit nicht leben kann. Sie werden natürlich trotzdem angemessen bezahlt. Vergessen Sie die Annonce, das war wirklich Unsinn, was ich da geschrieben habe. Aber ich habe noch nie eine Anzeige aufgegeben und ich wollte, dass das jemand findet. Jemand wie Sie. Schlagen Sie ein, Anna!“
Bornecker hielt mir seine Hand hin. Ich wusste nicht, ob ich gerade einen Pakt mit dem Teufel schloss, irgendetwas warnte mich, aber plötzlich war meine Hand in seiner. Ursula freute sich wie ein Kind und umschloss herzlich unsere beiden Hände. Der historische Händedruck, dachte ich kurz …
Dann fuhren wir zum alten Familiensitz, den die Erben unlängst veräußert hatten. Eine riesige Villa, direkt an der historischen Stadtmauer. Im Nachhinein bereute ich es, nicht mit ins Haus gegangen zu sein.
Ursula und Siegfried hatten es mir angeboten. Aber ich hatte abgelehnt, weil sie einen Termin mit der neuen Besitzerin hatten. Da wollte ich nicht stören. Jetzt war mir klar, dass ich nie mehr so einfach in diese Villa kommen würde.
Versal & Flober
Die Fahrt in die Stadt mit dem Aeroexpress dauerte eine Dreiviertelstunde. Der Flughafen lag weit draußen. Wir fuhren am Meer entlang, durch kleine Dörfer. Alles schien wie vor zwanzig Jahren. Dann aber kamen die ersten Vorortsiedlungen – neu gebaute Häuser, darunter kitschige Villen und protzige Anwesen. Ein Sammelsurium verschiedenster Stile. Neureiche Hässlichkeit. Dann durchfuhren wir die obligatorischen Neubauviertel. Da war sie, die alt bekannte Sowjettristesse, gut konserviert. Schließlich erreichten wir das Zentrum. Der Bahnhof lag direkt oberhalb des Hafens. Von Weitem waren Verladekräne und Frachter zu sehen und schrille Lautsprecherdurchsagen zu hören. Offenbar koordinierten sie das Be- und Entladen. Auf Anhieb mochte ich die Nähe zum Meer und diese Geschäftigkeit. Es war eine spröde Schönheit. Nichts, das mit einem verwinkelten Küstenort an der Amalfi-Küste zu vergleichen war. Das, was da unten vor mir lag, war kein Touristenmeer. Ich sah riesige Containerschiffe. Hier löschte man Ladung, belud aufs Neue. Frachter wurden betankt und gewartet. Container auf Züge geladen. Ich dachte, dass die Gleise da unten nicht irgendwelche Gleise waren. Dort, am Hafen, endete die Transsibirische Eisenbahn nach knapp 10 000 Kilometern Strecke. Die Züge, die von hier auf die Reise gingen, hätten einen weiten Weg vor sich. Aber warum ans Wegfahren denken, ich war ja gerade erst angekommen. Ab ins Hotel, dachte ich. Gut, dass ich mir eine kleine Wegbeschreibung ausgedruckt hatte, denn weder auf dem Flughafen noch auf dem Bahnhof war ein Stadtplan zu bekommen. Zumindest das hatte sich nicht geändert. Das Hotel war nicht weit weg. Siegfried Bornecker hatte darauf bestanden, mich die ersten Nächte im Stadtzentrum unterzubringen. Aber nicht irgendwo. Nein, es sollte das Versal sein, wo er mich „mit allem Komfort und ein bisschen so wie früher“ einquartieren wollte.
„Wenn Sie erst einmal dort sind, Anna, können Sie unterkommen, wo es Ihnen beliebt. Machen Sie mit Ihren Spesen, was Sie wollen, aber ich möchte, dass Sie, wenn Sie ankommen, zumindest ein einziges Mal den Geist der alten Zeit atmen, auch wenn die Konkurrenz damals dort saß.“
Die Konkurrenz … Tschurin & Co. hatten damals ein Konditorgeschäft dort. Ich holte meinen Google-Plan aus der Tasche. Der Weg war einfach: einmal nach rechts, dann an der nächsten großen Kreuzung links. Ich musste zur Swetlanskaja Ulitza, damals wie heute eine Prachtstraße und gleichzeitig die Hauptschlagader der Stadt. Vom Bahnhof waren es zehn Minuten, höchstens eine Viertelstunde.
Als ich in das Hotel eintrat, wusste ich, was Bornecker gemeint hatte. Mich empfing ein Vestibül mit verschnörkelten, goldverzierten Stuckdecken, von denen ausladende Kronleuchter herabhingen. Die Säulen und Rundbögen an der Seite gaben dem Raum eine herrschaftliche Atmosphäre. An den Fenstern hingen edle Brokatvorhänge. Der Marmorboden spiegelte fast besorgniserregend. Ich ging zur Rezeption und erst da verstand ich, was der Name des Hotels eigentlich bedeutete. Ich kam darauf, als ich auf meinen Pass wartend, den Namen des Hotel-Cafés las: Flober. Komisch, dachte ich, was für ein ulkiger Name, klingt überhaupt nicht russisch. An der Wand hing ein Plakat, das für eine Lesung im Café warb. Das Flober schien ein Literaturcafé zu sein. Auf dem Tresen pries ein Schild Leckereien der hauseigenen französischen Patisserie an. Und plötzlich machte es Klick. Ich las noch einmal und musste lachen. Ich war im Hotel Versailles und das Café war das Flaubert. Das fing ja gut an. So eine Verballhornung … Versal & Flober.
Die Dame an der Rezeption versprühte den Charme einer Dezhurnaja aus fernen Sowjetzeiten. Damals saßen sie nicht nur an der Rezeption, sondern im Aufgang jeder Hoteletage. Rund um die Uhr hielten sie Wache, sorgten angeblich für den Gast, aber eigentlich für Ruhe und Ordnung. Doch der über Jahrzehnte in Fleisch und Blut übergegangene Kommandoton, der bei der ersten Begrüßung noch durchschimmerte, schien auf eigenartige Weise abgeschliffen. Offenbar hatte Marina – ein Schild neben dem Patisserie-Hinweis verriet mir ihren Namen – einen Kurs in „Wie begrüße ich Hotelgäste freundlich?“ absolviert. Sie mühte sich redlich. Schon wieder musste ich lachen.
Mein Zimmer war nicht halb so glamourös wie die Lobby, aber egal, ich hatte ein Dach über dem Kopf und konnte den schweren Rucksack abwerfen. Endlich duschen. Nach dem langen Flug war das dringend nötig.
Als Allererstes wollte ich das Kaufhaus sehen, schließlich das Ziel meiner Reise. Kunst & Albers, das erste Haus am Platze, lag natürlich auch auf der Swetlanskaja. Ich hatte es also nicht weit. Das Kaufhaus war immer noch Kaufhaus, schon von Weitem sah ich die Leute hineinströmen und mit Einkaufstaschen bepackt hinauskommen. Es war komisch. Für mich war es ein mythisch aufgeladener Ort. Bornecker hatte so viel darüber erzählt, ich hatte Unmengen dazu gelesen. Für mich war es viel mehr als einfach nur ein Kaufhaus. Davor stehend fragte ich mich, ob die Passanten eine Ahnung davon hatten, was hier vor über hundert Jahren passiert war. So ein Quatsch, dachte ich.
Eigentlich war schon der erste Blick von außen ernüchternd. Ich weiß selbst nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht lag es daran, dass vieles von dem, was ich gelesen hatte, die Anfangszeit beschrieb. Damals war das stattliche Gebäude das einzige Bauwerk aus Stein und Eisen weit und breit. Die Baumaterialien hatte man extra aus Hamburg per Schiff herangeschafft. Das Kaufhaus thronte wie ein Monolith über der Innenstadt. Ringsherum gab es nur Holzhütten, die Straße war nicht einmal befestigt. Heute sah alles anders aus. Kunst & Albers, das seit der Verstaatlichung unter dem Namen GUM firmierte, war komplett umbaut. GUM war die Abkürzung für „Staatliches Kaufhaus“. Es markierte in jeder sowjetischen Stadt den zentralen Einkaufspunkt. Das berühmteste stand in Moskau, direkt am Roten Platz.
Als ich ins Innere trat, dachte ich, dass der Einkaufstempel zwar immer noch GUM hieß, es aber kein Kaufhaus mehr war, ein staatliches schon gar nicht. Ich bemerkte, dass von den großzügigen Hallen kaum noch etwas geblieben war. Der einstige Glanz war verschwunden. Offenbar hatte man das Gebäude an verschiedene Händler verpachtet und die Mietfläche dementsprechend aufgeteilt. Dafür hatte man umbauen müssen. Was ich sah, war übel: ein Kiosk neben dem anderen, Miniboutiquen, winzige Läden – abgehangene Decken, dazwischen Rigips-Wände. Die prächtigen Räume mit den edlen Holzvertäfelungen, den Regaleinbauten, den Säulen und Stuckverzierungen gab es nicht mehr. Geblieben war nur noch die Hülle. Nur zwei Relikte konnte ich ausmachen: einen Raum im Erdgeschoss mit den schönen Hamburger Mosaikfliesen, mit denen die Fußböden kunstvoll ausgelegt waren, und zwei gusseiserne Heizkörper in einer Nische im Eingangsbereich. Wahrscheinlich hatte man beides bei den Renovierungsarbeiten übersehen. Nur deshalb hatten sie als Überbleibsel einer längst vergangenen Ära überlebt.
Ich ging schnell raus, wollte ich mir nicht gleich den ersten Tag verderben. Der Nebel über der Bucht war verschwunden, herrlichster Sonnenschein empfing mich. Auch wenn ich todmüde war, weil der Jetlag an mir zehrte, wollte ich noch ans Meer. Ich schlenderte die Flaniermeile hinunter zur Strandpromenade und setzte mich ans Ufer. Ja, hier konnte man es aushalten. Die Stimmung war viel entspannter als in Moskau, die Menschen saßen auf Bänken, aßen Eis und flanierten, statt mit Tunnelblick und ausgestreckten Ellenbogen aneinander vorbeizuhetzen. Festpavillons an der Promenade kündigten ein Filmfestival in den nächsten Tagen an.
Ich musste an Zuhause denken. Martin und Paul waren nicht sonderlich begeistert von dieser Reise. Verübeln konnte ich es ihnen nicht, war ich doch erst vor einem Jahr völlig überstürzt auf eine schottische Insel aufgebrochen und drei Monate dort geblieben. Martin beobachtete diese Rastlosigkeit mit Sorge. Doch eigentlich gab es keinen Grund dazu, denn genau genommen war die Tour hierher ein ganz normaler Job und alles war wohlgeordnet. Außerdem wusste er nur zu gut, dass es überhaupt keinen Sinn hatte, mir Dinge auszureden, weil ich es dann erst recht machen würde. Manchmal tat er mir leid. Andererseits … er selbst arbeitete zwölf Stunden am Tag, hatte nie Zeit. Was sollte er sich also aufregen? Vielleicht würde ich nicht lange bleiben, wer weiß, was mich hier erwartete. Dieses Tagebuch konnte sonst wo liegen. Eigentlich war es wahrscheinlicher, dass ich es in Kolpaschewo oder in Tomsk finden würde. Dort, wo sich Dattan während seiner Verbannung aufgehalten hatte. Warum also ausgerechnet Wladiwostok? Warum hätte er es hier lassen sollen? Wenn er die Aufzeichnungen auf dem langen und beschwerlichen Weg von Kolpaschewo bis Wladiwostok mitgenommen hatte, warum sollte er dann nur einen Teil der Unterlagen mit in seine Heimat, nach Naumburg, genommen und einen Teil hier zurückgelassen haben? Das war vollkommen unlogisch. Mittlerweile war ich der Ansicht, dass die Suche in Deutschland oder bei den Angehörigen, die nunmehr über die ganze Welt verstreut lebten, viel sinnvoller wäre. Es war grotesk, denn ursprünglich war ich diejenige, die unbedingt hierher wollte. Aber irgendwann war ich von der Suche nach dem Tagebuch so eingenommen, dass ich jede Fährte verfolgte, egal, wohin sie führte. Mein herbeigesehntes Russlandabenteuer geriet dabei fast ins Hintertreffen. Doch Bornecker mochte nicht auf mich hören, er wollte unbedingt, dass ich dort begann, wo auch damals alles begonnen hatte. Er bestand darauf, weil er felsenfest daran glaubte, dass die Suche nach der Nadel im Heuhaufen nur dann gelänge, wenn allem Anfang ein besonderer Zauber innewohne. Und dieser Zauber konnte sich nur am authentischen Ort entfalten. Ich tat ihm den Gefallen. Schließlich war ich diejenige, die unbedingt nach Russland wollte, für die die Recherche anfangs nur willkommener Anlass war. Bornecker war es, der dieses Abenteuer bezahlte. Außerdem war er jemand, dem man nichts abschlagen konnte. Jetzt fand ich, dass er richtig gelegen hatte. Ich war froh, diesen weiten Weg auf mich genommen zu haben.