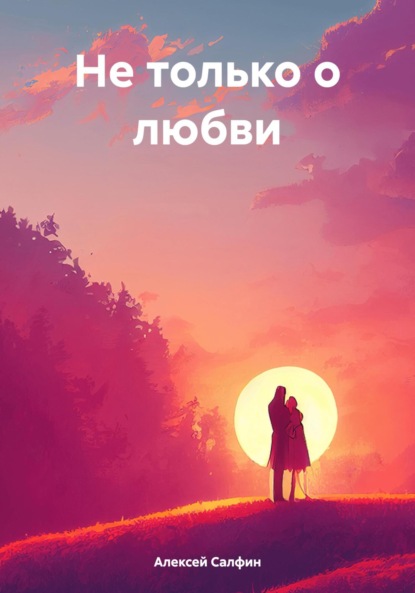- -
- 100%
- +
Im Archiv des Fernen Ostens
Am nächsten Tag ging ich ins Archiv. Es befand sich mitten im Zentrum, nur ein paar Minuten zu Fuß. Zu Hause hatte ich mir über meine Kontakte zu verschiedenen Dozenten ein paar Empfehlungsschreiben ausstellen lassen. Ohne ein amtliches Schreiben ging in Russland nichts. Stempel waren wichtig. Und ich hatte meinen Besuch und den Grund meiner Recherche angekündigt. Natürlich hatte ich das Tagebuch nicht erwähnt. In Russland erwähnte man das, was man wollte, besser nie sofort und nie direkt. Man umkreiste die Dinge behutsam.
Der Wachhabende am Eingang kontrollierte meinen Pass, notierte sich die Daten und schickte mich direkt in den Lesesaal. Meine Sachen sollte ich einschließen. Im Lesesaal begrüßte mich eine hagere Dame um die fünfzig. Auch dort der obligatorische Eintrag ins Besucherbuch und die Frage nach dem Empfehlungsschreiben, das mich berechtigte, dort zu recherchieren. Ich wusste es. Auf meine erste Anfrage hin hatte man mir mitgeteilt, dass ich nichts dergleichen bräuchte und einfach so kommen könne. Ich wollte mich darauf nicht verlassen, weil ich wusste, dass in Russland Stempel verehrt, gefürchtet und geliebt wurden. Wer einen Stempel hatte, hatte das Sagen, wer etwas Gestempeltes vorzeigen konnte, hatte recht. Eine Unternehmung war erst dann von Bedeutung, wenn sie durch ein Schreiben unterfüttert war. Je gewichtiger der Absender, umso bedeutungsvoller das Vorhaben. Ich war froh, meinen Erfahrungen vertraut zu haben.
Nachdem ich eine Reihe von Papieren ausgefüllt hatte, wurden mir sogleich die ersten Akten gebracht. Sie hatten das aufgrund meiner E-Mail-Anfrage schon vorbereitet. So etwas hatte ich in Moskau nie erlebt. Dort musste man grundsätzlich erst einmal zwei Tage warten.
Das war es also, das Archiv des Fernen Ostens. Es hörte sich groß an. Groß und sagenumwoben. Was ich sah, war alles andere als das. Der Lesesaal war unwesentlich viel größer als unser Wohnzimmer. Dennoch beherbergte er sechzehn kleine Arbeitstische, in vier Reihen aufgestellt. Auf der rechten Seite des Raumes gab es ein paar Computerarbeitsplätze und in der Ecke stand der Schreibtisch von Ljudmila Petrowna. Ich setzte mich in die zweite Reihe. Ein bisschen fühlte ich mich wie in der Schule. Vielleicht lag es auch am strengen Blick der Aktenverwalterin. Aber immerhin saß sie mit uns in einem Raum, war Teil des Ganzen. In Moskau bekam man seine Akten aus einer Luke herausgereicht. Der Lesesaal war durch eine Wand von den Akten und den Archivmitarbeitern getrennt. Nur das unscheinbare Fenster bildete die Verbindung zu den dahinter befindlichen Aktenregalen. Doch der Aktenbereich war tiefer gelegen, weil er offenbar zu einem anderen Gebäudeteil gehörte. Jeder, der etwas bestellen wollte oder eine Frage an die Archivare hatte, musste sich in Bückhaltung begeben, weil die Mitarbeiter wegen des Höhenunterschiedes ansonsten nur die Bäuche der Archivnutzer gesehen hätten. Man hätte in die Hocke gehen können, weil die Ausgabeluke ohnehin niedrig war. Doch um etwas Würde zu behalten und dies zu vermeiden, hing man schräg oder kopfüber. Ich hatte es gehasst damals, weil die Archivare ohnehin in einer Machtposition waren und diese nun auch noch mit der körperlichen Erniedrigung der Nutzer Tag für Tag feierten. Und ich hatte eine Theorie aufgestellt: Je wichtiger die Angelegenheit war und je weiter man in den Osten kam, umso niedriger und kleiner wurden die Fenster. In Zentralasien gab es auf Bahnhöfen winzige vergitterte Fahrkartenverkaufsfenster, vor denen Menschentrauben hingen. Hier war ich nun am östlichsten Ende angekommen. Nach meiner Theorie hätte ich am Boden liegend mit der Lupe das Fenster suchen müssen, aber nichts dergleichen. Es gab kein Fenster, nicht einmal eine Trennwand. Man begegnete sich auf Augenhöhe, auch wenn vor Ljudmilas Augen eine großformatige Brille saß. Es war so ein ehemaliges Sowjetmodel aus jener Zeit, als große Brillengläser noch ein Zeichen vorbildlicher Gesundheitsfürsorge waren. Das Archiv des Fernen Ostens war mir sympathisch.
Vor mir lag ein Aktenstapel und schon ein flüchtiger Blick verdarb mir die Laune. Das meiste waren handschriftlich verfasste Dokumente, zudem noch in alter Schreibweise. Irgendwelche Schriftwechsel der Stadtverwaltung. Ich bräuchte eine Ewigkeit, wenn ich das alles durchackern wollte. Deshalb entschied ich mich sofort, es gar nicht erst zu versuchen. Die nächsten Stunden verbrachte ich mit Blättern. Ab und zu fand ich mal eine Seite, die entfernt etwas mit Dattan zu tun hatte, aber alles war belanglos und brachte mich nicht weiter. Egal. Ich hatte ein paar Wochen Zeit. Morgen würde ich mir ein paar Findbücher kommen lassen, für heute war es genug.
Wohnungssuche
Ich ging ins Hotel. Schon jetzt nervte mich, dass ich mir nichts kochen konnte. Fast Food hasste ich. Ich musste mir eine Wohnung suchen. In der Stadt hatte ich an Bushaltestellen Dutzende Zettel mit Wohnungsinseraten gesehen. Doch fast überall las ich die gleiche Telefonnummer. Außerdem stand dort nicht, in welchem Stadtteil die Wohnung überhaupt lag. Eins war von Anfang an klar. Ich wollte auf keinen Fall in einem Neubaublock in einem der Außenbezirke wohnen, sondern im Zentrum, am besten irgendwo am Meer. Ich brauchte einen Stadtplan. Die Stadt schien riesig, sie franzte in alle Richtungen aus, und obwohl hier nur 500 000 Menschen lebten, hatte man den Eindruck, in einer Mega-City zu sein.
Im Hotel hatte ich WLAN. Ich setzte mich mit meinem Laptop in die Lobby und fing an zu suchen. Kaum hatte ich die ersten Seiten aufgerufen, ärgerte ich mich über mich selbst. Da war ich vor Ort, konnte mit den Leuten reden, konnte durch die Straßen streifen und dort nach Inseraten suchen oder mir eine Zeitung mit Annoncen kaufen. Aber was tat ich? Ich hing im Netz. Das hätte ich auch in Berlin tun können. Dafür hätte ich keine 12 000 Kilometer fliegen müssen. Ich war sauer, denn das, was ich im Internet sah, war viel ausführlicher und besser als die nichtssagenden Klebezettel. Was brachte die Realität, die ich mit eigenen Augen sah? Ich schrieb drei Anbietern eine kurze Mail, dann klappte ich den Computer zu. Irgendwie gefiel mir das nicht. Früher hatte ich einfach gefragt. Je abwegiger die Frage schien, umso Erfolg versprechender war oft die Antwort. Warum es nicht einfach so machen wie früher?
Ich ging zur Rezeption. Marina sortierte ein paar Papiere, dann blickte sie zu mir auf. Bisher hatte ich nur sie hier gesehen, offenbar schien sie rund um die Uhr zu arbeiten. Ich hätte lieber jemand anderen angesprochen, denn Marina schien jede Frage zu stören. Aber manchmal täuschte man sich. Wie oft hatte ich erlebt, dass gerade die Grantigen und Unnahbaren sich als die Herzlichsten entpuppten, sobald das Eis gebrochen war.
„Marina Iwanowna, hätten Sie mal ein Sekündchen Zeit, nur ganz kurz“, versuchte ich es betont freundlich. „Ich habe eine klitzekleine Frage, vielleicht können Sie mir helfen.“ Wer in Russland etwas will, dachte ich bei mir, muss in Verniedlichungen reden. Da erhob sich Marina sogleich aus ihrem Sessel, verschränkte die Arme vor ihrer Brust, legte den Kopf schräg und kräuselte die Stirn. Das alles ohne ein Wort. Oje, was hatte ich da nur wieder für eine Schnapsidee. Aber jetzt stand sie da. Sollte ich lieber nach einer Zeitung oder etwas anderem fragen? Nein. Auf in den Kampf!
„Marina Iwanowna, ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage. Vielleicht auch ein wenig unpassend, hier im Hotel. Wissen Sie, ich habe das Zimmer hier im Hotel für drei Nächte gebucht. In Wirklichkeit bleibe ich aber länger, vielleicht sogar sehr viel länger. Ich bin aber nicht der Typ, der sich in Hotels auf Dauer wohlfühlt. Wissen Sie, ich koche gerne und ich brauche ein privates Umfeld, eine Atmosphäre, die mir vertraut ist. Ich mag es nicht, wenn ständig jemand hinter mir herräumt, auch wenn es praktisch ist. Deshalb wollte ich Sie fragen, ob Sie vielleicht jemanden kennen, der mir ein Zimmer oder eine Wohnung hier im Zentrum vermieten könnte. Gern auch ohne Rechnung. Vielleicht ein Verwandter von Ihnen?“
Marina stand unverändert da. Der strenge Blick hinter der Riesenbrille war schwer zu deuten. Dann setzte sie in ruhigem Ton an. „Junge Frau, Sie fragen mich, die Empfangssekretärin eines der besten Hotels in Wladiwostok, ehemals das Grandhotel, ob sie Ihnen privat, unter der Hand, ein Zimmer vermietet? Würden Sie das bei sich zu Hause auch so machen? Im Adlon oder im Hilton? Wir sind hier nicht auf dem Basar, junge Dame!“
Dann setzte sie sich wieder in ihren Sessel und ordnete weiter Papiere, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Das hatte gesessen. Was sollte ich sagen? Natürlich wäre ich in Deutschland nie auf so eine Idee gekommen. Aber in Russland? Da habe ich es nie anders gemacht. Ich fühlte mich ertappt und eilte davon. Erst einmal raus an die Luft, dachte ich.
Als ich vor dem Hotel stand, wusste ich nicht, wohin. Irgendwie nervte alles. Bornecker hatte es gut gemeint mit diesem Hotel, aber ich hätte mir von Anfang an etwas auf eigene Faust suchen sollen. Ich lief ziellos umher. Eigentlich war es Zeit fürs Abendessen, aber mir war der Appetit vergangen. Vor dem Kino Okean, ein alter Sowjetfilmpalast direkt an der Strandpromenade, sah ich eine Menschenmenge. Irgendetwas schien dort los zu sein. Es gab eine Filmpremiere, irgendeine Komödie. Die Vorstellung begann in wenigen Minuten. Ich kaufte eilig eine Karte und ging hinein.
Das war genau das Richtige. Die nächsten anderthalb Stunden bräuchte ich mir zumindest keine Gedanken zu machen über Akten, die ich nicht lesen konnte, über eine Bleibe, die ich nicht hatte. Gut, dass es Komödien gab, denn plötzlich war ich wieder voller Zuversicht. Alles halb so wild, dachte ich, ich könnte auch erst einmal in ein Hostel ziehen. Irgendeine Lösung würde sich finden.
Nadezhda, meine Hoffnung
Als ich am nächsten Morgen zum Frühstück ging, fand ich unter meiner Zimmertür einen Zettel. Irgendjemand musste ihn in der Nacht unter der Tür hindurchgeschoben haben. Ich hob das zusammengefaltete Blatt auf und las:
Sehr geehrte Frau Anna,
natürlich weiß ich etwas, aber was sollte ich gestern sagen? Ich musste so reagieren, denn Jurij, unser Junior-Chef, saß im Hinterzimmer. Entschuldigen Sie, dass ich so streng war. Ein bisschen taten Sie mir leid. Sie müssen unbedingt mit meiner Tante Nadezhda sprechen. Sie hat eine Wohnung, die sie vermietet. Nicht besonders groß, nur ein Zimmer, und auch nicht sehr komfortabel, aber für eine Person sollte es reichen. Das Gute – es ist nicht weit vom Stadtzentrum entfernt und direkt am Meer mit einer wunderbaren Aussicht. Hinten, auf dem Egerscheld, eine sichere Gegend. Sie haben verdammtes Glück, denn die Wohnung war drei Jahre lang vermietet. Jetzt ist sie frei, erst seit Kurzem. Nadezhda Walentinowna wird Ihnen alles zeigen, wenn Sie mögen. Mit ihr reden Sie auch über den Preis. Keine Angst, alles wird gut. Nadezhda wartet um elf Uhr am Kiosk neben dem Hotel. Sprechen Sie mich an der Rezeption nicht darauf an. In diesem Haus, kein Wort darüber.
Gruß
Marina Iwanowna Apraksina
Ich musste lachen. Gestern noch hatte ich gegrübelt, war ernsthaft ins Zweifeln geraten. Darüber, ob ich mich tatsächlich falsch verhalten hatte, darüber, ob das Land, das ich so gut zu kennen glaubte, in den letzten Jahren nicht doch ganz anders geworden war. Gestern kam ich mir vor, wie jemand, der unwiederbringlich den Anschluss verpasst hatte, jemand, der nur noch an einer Erinnerung hing, eine Erinnerung an etwas, das es längst nicht mehr gab. Nun war wieder alles im Lot. Nadezhda, die Hoffnung. Gestern noch war ich so unglücklich gewesen und heute schon wies mir die Hoffnung den Weg. Es war verrückt, aber hier war es immer so: Größtmögliche Einschränkung und absolute Freiheit lagen in Russland so dicht beieinander wie sonst nirgendwo. Wie pflegte Jan immer zu sagen: „Entweder du bekommst nichts oder musst viel zahlen oder du bekommst alles und zwar geschenkt. Ein Dazwischen gibt es in Russland nicht.“ Wahrscheinlich stimmte das. Allerdings begleitete uns diese Lebensweisheit vor über zwanzig Jahren auf unseren Reisen. Ich hatte geglaubt, dass sich in der Zwischenzeit doch einiges verändert hatte.
Nach dem Frühstück checkte ich aus, ließ aber mein Gepäck im Hotel. Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass die Wohnung meine einzige Chance sei. Nadezhda sollte ruhig etwas im Ungewissen bleiben. Marina tat geschäftig gelangweilt wie immer und ich verabschiedete mich wie ein ganz normaler Hotelgast unverbindlich freundlich. Als ich aus dem Hotel heraustrat, sah ich sie sofort. Eine kleine drahtige Frau, bestimmt schon um die siebzig. Auch sie hatte so eine große Brille. Komisch, von fast allem hatten sie sich getrennt, nur die sowjetischen Brillen hatten offenbar überlebt. Nadezhda erkannte mich sofort und kam auf mich zu. „Guten Morgen Anna, was für ein Glück, dass wir uns treffen. Ich suche eine Mieterin und Sie eine Wohnung. Meine Nichte hat mir erzählt, dass Sie aus dem fernen Berlin gekommen sind. Was hat Sie denn hierher verschlagen, ans Ende des russischen Reiches?“ Sie fasste sich an den Hinterkopf und verzog das Gesicht. Offenbar litt sie an Migräne. „Naja, immerhin haben Sie Glück mit dem Wetter. Kommen Sie, wir nehmen den Bus. Zu Fuß ist es zu weit, das schaffe ich heute nicht, auch wenn die Sonne so herrlich scheint.“ Ich hatte noch keine Bustickets. Auch hatte ich nirgendwo einen Automaten oder ein Tickethäuschen gesehen. Nadezhda erklärte, dass man beim Fahrer bezahle, alles kein Problem. Sie plapperte ohne Unterlass und eilte im Stechschritt los, ich hatte fast Mühe hinterherzukommen.
„Das stimmt. Ich will hier etwas erforschen und ich möchte einer Person, die früher einmal hier gelebt hat, nachspüren. Vielleicht kennen Sie ihn? Es geht um Adolph Dattan.“ Nadezhda blieb stehen. „Gehört habe ich den Namen schon einmal, aber ich komme nicht darauf. War er Künstler?“
Wir liefen wieder weiter. „Nein, er war der letzte Geschäftsführer und Teilhaber von Kunst & Albers, dem großen Kaufhaus auf der Swetlanskaja.“
„Achja, richtig, das GUM. Eine wahre Augenweide, nicht wahr?“
Ich dachte an den zerstückelten Innenraum und an die vergammelte Hinterfassade, an die Birken, die auf den Balkonen gediehen. Nein, das Thema wollte ich jetzt nicht diskutieren und nickte deshalb nur.
Der Bus kam, wir fuhren ein paar Stationen. Bezahlt wurde beim Ausstieg. Egal wie viele Stationen man fuhr, der Preis war immer der gleiche, 17 Rubel. Wir liefen ein Stück. Ständig kamen uns Matrosen entgegen. Dann standen wir vor einem fünfgeschossigen Haus direkt am Meer. So, wie Marina es beschrieben hatte. Aber was war das denn? Genau vor das Haus hatte man ein Hochhaus hingesetzt, nur eine Straßenbreite dazwischen, obwohl nicht einmal 100 Meter bis zur Brandung blieben. Würde mir jemand so ein Monstrum vor die Nase setzen, müsste ich mich arg zusammenreißen, um friedliche Koexistenz zu praktizieren. Wir gingen in die dritte Etage. Irgendwie wirkte das Haus nicht wie ein normales Wohnhaus, sondern wie ein Wohnheim. Der Flur, von dem die Wohnungen abgingen, war fast hundert Meter lang. An der Decke flackerten Neonlampen, am Boden wellte sich ein hellbrauner PVC-Belag und an den Seiten bröckelte ein himmelblauer Ölsockel von den Wänden. Nadezhda schloss die Tür auf und da standen wir auch schon mitten im Zimmer. Vorn, direkt neben der Eingangstür war ein Tisch, auf dem eine Kochplatte stand, daneben ein Abtropfgitter für das Geschirr. Eine Küche gab es nicht. Der etwas überdimensionierte Kühlschrank – ein amerikanisch wirkendes Modell aus den Siebzigern – stand deshalb mitten im Zimmer. Die Einrichtung war spartanisch: ein Schlafsofa, ein Regal, ein Fernseher und ein Stuhl. An der Decke hing eine Neonleuchte, der Fußbodenbelag war der gleiche wie im Treppenhaus. Direkt gegenüber von der Kochecke, also rechts neben dem Eingang, befand sich das Bad. Ich schaute hinein und stellte sofort fest: Alles Marke Eigenbau, natürlich ohne Fenster, wo sollte das auch sein? Man hatte einfach eine Ecke vom Zimmer mit Spanplatten abgetrennt und Toilettenbecken, Duschtasse und Waschbecken darin installiert, ohne die Wände zu fliesen oder auch nur zu isolieren. Eine Duschkabine gab es nicht, von oben hing nur ringsherum ein lila geblümter Duschvorhang, der aussah, wie die Gummitischdecke von meiner Oma. Alles in allem waren es nicht mehr als 20 Quadratmeter. Nun ja. Luxus sah anders aus. Ich war nicht verwöhnt und konnte mit wenig auskommen, aber das hier war ganz schön wenig. Das Einzige, was diese Bruchbude zu bieten hatte und was für alles entschädigte, waren die drei großen Fenster. Der grandiose Blick aufs Meer, das einen Steinwurf entfernt vor sich hin plätscherte, hatte schon was. Wirklich toll. Ich überlegte. Vielleicht könnte ich eine Lampe kaufen, ein paar Kerzen aufstellen. Ich brauchte nicht viel, um mich wohlzufühlen. Trotzdem musste ich über den Preis verhandeln. Nadezhda schaute mich an, als ob sie mit mir den Spiegelsaal von Versailles präsentiert hätte. Ich erwartete nichts Gutes.
„Es ist nicht ganz so, wie ich mir meine zukünftige Bleibe vorgestellt hatte“, sagte ich etwas zögerlich, „aber vielleicht sagen Sie mir erst einmal, was Sie dafür haben wollen.“
Nadezhda setzte sich hin und schob ihre Brille nach oben. „Wissen Sie Anna, es ist äußerst schwierig, eine Wohnung zu finden, hier in Wladiwostok. Aus den umliegenden Dörfern und Kleinstädten wollen alle hierher und sie kommen in Scharen. Wenn sie in den Außenbezirken etwas finden, können sie schon froh sein. Aber hier sind sie direkt am Meer und trotzdem mitten in der Stadt. Es ist ruhig, kein Straßenlärm, der stört. Das gibt es so gut wie gar nicht auf dem Markt. Und …“
Nadezhda hielt den Atem an, um mit bedeutungsschwangerem Blick und tiefer Stimme fortzufahren. „Das kommt noch hinzu. Nicht zu unterschätzen. Das Haus befindet sich auf dem Campus der Meeres-Universität. Alles ist umzäunt und überwacht, hier gibt es keine Überfälle, keine Bettler, keine Störenfriede. So eine in jeder Hinsicht vorteilhafte Wohnung finden Sie woanders nicht noch einmal.“ Ich schaute mich um. Mein Blick glitt über die vergilbte, an einigen Stellen abgeschabte Blümchentapete in sepia, die vielleicht gerade noch zu Breschnews Zeiten modern war. An der Wand zum Bad entdeckte ich ein faustgroßes Bohrloch, durch das ein Kabel hing. Der durchfallbraune Bodenbelag warf Blasen und sah aus wie ein überdimensioniertes Pickelgesicht. An der Decke hing eine blanke Neonleuchte. Ich fragte mich, was nun kommen würde. Nadezhda wollte gerade ansetzen und genau in dem Moment rüttelte der Kühlschrank und sprang an. Ein Dröhnen durchzog das Zimmer. Nun fühlte ich mich auch noch wie in einer Motorenhalle. Das Ding würde als Erstes rausfliegen, dachte ich bei mir. Nadezhda musste nun deutlich lauter sprechen.
„Ich denke, wenn Sie mir 35 Eurochen die Nacht zahlen, wäre das ein gutes Geschäft für Sie. Ich mache das nur, weil Sie so interessiert an der Geschichte unserer Stadt sind. Von einem Fremden würde ich mehr nehmen.“
Ich überschlug das kurz. Pro Monat wären das über 1 000 Euro. Euro, nicht Eurochen. Es war absurd. Aber was sollte ich sagen, in Russland hatten alle, die im Immobiliengeschäft tätig waren, völlig übergeschnappte Vorstellungen. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass der Wohnungsmarkt der einzige Bereich war, in dem sich für Normalbürger überhaupt noch einigermaßen Geld verdienen ließ. Die Menschen vermieteten, anstatt zu arbeiten. Es gab Familien, die in einer Wohnung zusammengepfercht dahinvegetierten, nur um die andere Wohnung teuer zu vermieten.
„Nadezhda Walentinowna, es tut mir leid, aber das geht nicht. Entschuldigen Sie, dass ich Sie ganz umsonst bemüht habe und Sie Ihre Zeit mit mir verschwendet haben, aber es geht einfach nicht. Wissen Sie zu Hause bezahle ich das Gleiche, aber da habe ich eine Wohnung mit fünf Zimmern. Riesige Räume mit tollen Stuckdecken und wunderschönen Holzfußböden, eine Wohnung mit Küche und zwei Bädern, mit Wintergarten, Balkon und Garten. Und dazu in einem Villenviertel, eine echte Nobelgegend. Da kann ich für das, was ich hier sehe, nicht das Gleiche bezahlen. Es ist ja nicht einmal eine Wohnung, sondern nur ein Zimmer. Und schauen Sie sich doch einmal um, alles ist provisorisch und abgenutzt.“
Ich überlegte, was so ein Zimmer bei uns kosten würde. Das Problem war, dass so etwas überhaupt niemand anbieten würde. „Ich kann Ihnen 300 Euro im Monat geben. Das ist in etwa der Monatslohn einer Verkäuferin. Ich denke, dass das real ist.“
Nadezhda sah aus, als ob sie gerade von einer Tarantel gestochen worden war. „Nein, 500!“
„Wissen Sie, ich gebe Ihnen 350, aber das ist mein letztes Wort. Bei uns würde man so ein Zimmer überhaupt nicht vermieten. Man würde es erst einmal renovieren und auf Vordermann bringen, bevor man es anbietet. Ich nehme es nur wegen des Ausblicks. Wenn Sie nichts dagegen haben, könnte ich es streichen, dann würde es schon viel freundlicher aussehen. Vielleicht eine neue Decke fürs Sofa, eine gemütlichere Lampe. Ich könnte es etwas netter machen. Was meinen Sie dazu? Vielleicht hätten Sie ja auch noch einen kleineren Kühlschrank. Ich brauche so ein Riesengerät gar nicht.“
Nadezhdas Gesicht heiterte sich etwas auf. Sie überlegte, rechnete hin und her. Man sah es ihr an. „Gut, abgemacht. Sie zahlen mir 350 Euro und machen es hübscher. Und ich hole nächste Woche den Kühlschrank ab und bringe Ihnen einen Kleineren. Wissen Sie denn, wie lange Sie bleiben wollen?“
Das war ein wunder Punkt. Nach meinem gestrigen Tag im Archiv hatte ich das Gefühl, keinen Tag länger bleiben zu müssen. Aber wer weiß, was sich alles noch ergeben würde.
„Einen Monat auf jeden Fall, vielleicht auch zwei oder drei.“
Dann ließ sie sich meinen Pass geben, füllte allerhand Zettel aus und verschwand mit den Unterlagen. Unten am Treppenaufgang wurde kontrolliert. Hinter einem Fenster taten drei Damen in Kittelschürzen ihren Dienst, die Dezhurnajas. Neuankömmlinge und Fremde wurden sofort erkannt. Hatten Sie weder Passierschein noch Ausweis dabei, konnte es ungemütlich werden. Mancher Besuchswunsch endete an diesem Fenster. Damit es mir nicht auch so ging, wurden die Alten im Kontrollkabuff gut informiert. Nadezhda schrieb mir ihre Telefonnummer und Mailadresse auf und ich gab ihr die erste Rate. Der Schlüssel steckte innen. In Russland schloss fast jeder nach Betreten der Wohnung von innen ab. Manche hatten Stahltüren mit mehreren Schließbolzen. Ich hatte drei Bolzen. Nadezhda schärfte mir ein, das Schließreglement auch so zu handhaben. „Und wenn irgendetwas sein sollte Anna, dann gehen Sie bitte zu Wolodja. Er wohnt schräg gegenüber, in der 324. Er kann Ihnen helfen. Ansonsten sprechen Sie lieber niemanden an. Und grüßen Sie hier am besten auch keinen. Zu viel Freundlichkeit fällt nur auf. Bitte auch keine Gespräche auf dem Flur. Besser nicht. Und immer schön ans Abschließen denken.“ Dann war sie weg.
Da saß ich nun in meiner neuen Bleibe. Ich öffnete das Fenster und lehnte mich aufs Fensterbrett. Was für ein herrlicher Ausblick: am Horizont die Silhouette einer Insel, davor ein paar Segelboote, dazu das gleichmäßige Plätschern der Wellen und das Möwengeschrei. Fast einen Tick zu idyllisch. Trotzdem, so wollte ich immer schon wohnen. Ich brauchte mich ja nicht umzudrehen … Mir fiel ein, dass ich noch nach der Internetverbindung hatte fragen wollen. Blöd, dass ich das vergessen hatte. Egal, ich würde ihr noch vom Hotel aus eine Mail schicken. Ohnehin sollte ich mich auf den Weg machen, denn ich wollte auch noch einmal ins Archiv. Gestern hatte ich wegen der Akten so gedrängelt, da konnten die Mitarbeiter schnell pikiert sein, wenn ich mich schon am zweiten Tag nicht blicken ließe.
Erste Begegnungen im Block
Ich wollte gerade das Fenster schließen, als ich ein sanftes Klopfen an der Tür hörte. Erst dachte ich, dass die Geräusche vom Nachbarn kämen, aber dann wurde das Klopfen energischer. Und ich hörte eine Stimme.
„Olga, bist du es?“
Was sollte ich machen? Ich hatte gerade erst den Schlüssel bekommen, Nadezhda hatte mich indirekt vor den Nachbarn gewarnt und ich war nicht Olga. Aber was sollte mir eine Frau mit solch zarter Stimme schon antun? Leider hatte ich keinen Spion. Egal, ich schloss auf. Vor mir stand eine zierliche Frau um die dreißig. Sie sah blass und kränklich aus, fast ein bisschen abgemagert. Ihre krumme Haltung ließ sie älter wirken. Sie war in eine dicke Strickjacke gewickelt, die ihr eindeutig zu groß war. Darunter kam eine graue Jogging-Hose zum Vorschein. Die Haare trug sie kurz, einfach abgeschnitten, ohne erkennbare Frisur. Ihr Äußeres entsprach nicht dem Standard der sonst eher schicken und rausgeputzten Russinnen.