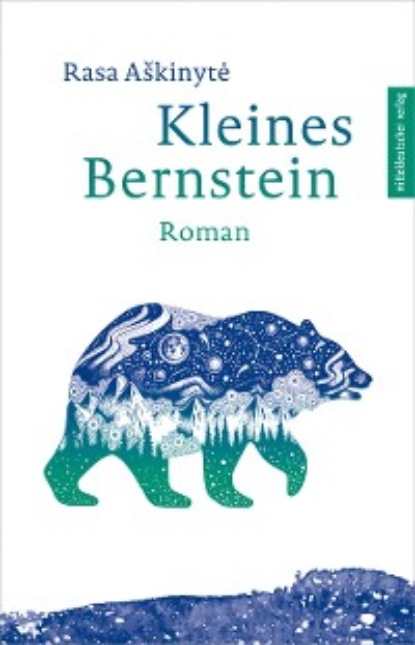- -
- 100%
- +
Kirnis rückte die Schuhriemen zurecht, nahm seinen Schild und den Speer mit der schmalen und kurzen Spitze zur Hand, scharf genug, dass er bei Bedarf sowohl aus einiger Entfernung als auch aus der Nähe kämpfen konnte. Als zweitstärkster Mann folgte er auf Gondas’ Vater, Kirnis war schlau und erfahren, auch wenn es noch viele andere Männer gab, ging er immer neben dem Anführer und kämpfte um kein Haar schlechter.
»Nein, Kirnis, du musst hierbleiben«, sagte Gondas’ Vater. Kirnis blinzelte in die Sonne schauend, schnappte nach Luft, wusste nicht, was er sagen sollte.
»Jetzt, Kirnis, wo ich den Sohn Gondas habe, ist es deine Pflicht, dort zu sein, wo er ist, um ihn zu beschützen.«
Kirnis blinzelte in die Sonne schauend, schnappte nach Luft, wusste nicht, ob das eine Ehre oder sein Niedergang war, doch dem Stammesführer widersetzt man sich nicht.
Es verging kein Tag, und Gondas’ Vater versammelte die stärksten Männer und die schärfsten Speere – man konnte ja nie wissen, ob jene Krieger und Händler Gutes oder Böses im Sinn hatten, sie würden unsere Länder durchqueren, wer weiß, ob in Frieden oder raubend und mordend –, und sie setzten sich, kaum hatten sich die Morgennebel gelichtet, auf ihre Pferde oder liefen in Richtung Küste los, ihre Kinder und Frauen ließen sie in der Obhut von Kirnis und einiger Vertrauter zurück. Unruhe stellte sich ein. Kirnis wusste als alter Krieger mit gutem Riecher, was das bedeutete.
Ein seltsames dumpfes Grollen kam immer näher, Kirnis wusste, das war kein Gewitter und auch keiner der anderen natürlichen Donner. Pferdehufe polterten über die Erde. Ihre Erde. Dem alten und mutigen Krieger Kirnis stockte das Herz. Am Klang erkannte er, wie ungleich die Kräfte verteilt sein würden. Diese verfluchten Langobarden, so nannten sie die Germanenstämme: Wer weiß, welcher genau es diesmal war, die Gotonen, Lugier oder auch Burgunden, grausam und gierig, sie hatten alle nur eins im Sinn – fette Beute. Kirnis hatte schon Siedlungen gesehen, die sie verwüstet hatten, obwohl er noch keinem von ihnen begegnet und auch keinen niedergekämpft hatte.
Kirnis wusste, die wenigen Männer wären nicht genug, er wusste, dass die Schutzzäune mit den spitzen Pfosten die Langobarden nicht aufhalten würden. Sie mussten möglichst schnell fliehen, in die Erdhöhlen kriechen, die sie für das Getreide gegraben und von außen gut mit Mist abgedeckt hatten, vielleicht würden diese Scheusale sie ja dort nicht finden.
›Gondas. Ich muss immer da sein, wo er ist, und ihn beschützen.‹ Kirnis packte Gondas, steckte ihn unter einen Arm und stürmte wie ein Wilder davon. Den Speer in der einen Hand, den Schild in der anderen, die Mutter folgte ihm laut kreischend, sie begriff vielleicht nicht einmal, was in ihn gefahren war, warum er mit ihrem Kind davonlief, mit ihrem Leben, sie hatte doch kein anderes; die vom Geschrei geweckten Leute aber, alte Männer und Frauen liefen ihnen samt den Kindern hinterher. Jetzt hörten alle das Grollen, ihre Herzen blieben vor Angst stehen, die Füße zertrampelten das Getreide, wer weiß schon, ob sie es überhaupt noch brauchen würden.
Es schrie nur die Mutter, ihr hatte jemand das Kind weggenommen, die anderen schwiegen beim Rennen, bewahrten den letzten Schrei für den Abschied auf, wenn ein Langobardenspeer sich in ihren Rücken bohren würde oder auch ein Schwert in ihr Herz.
5. Met
Kirnis rannte voran, Gondas, den er unter den Arm geklemmt hatte, schlief, seine Mutter kreischte, wenn jemand euer Kind davontrüge, würdet ihr auch schreien, dieser Verrückte, Gondas’ Mutter bedauerte, dass sie kein Messer dabei hatte, sie würde es ihm in den Rücken rammen, das Grollen kam immer näher, während die Glöckchen seiner Stiefel immer weiter bimmelten, das hatte gerade noch gefehlt.
Die Mutter hörte die Pferde nicht, nur den Atem des schlafenden Kindes, es war noch so klein, erwachte nicht einmal, wenn es herumgetragen wurde, und das wurde es, weil man es schon verstecken musste. Die Mutter weinte, ohne Tränen, der Abend nahte, Wind kam auf, die Bäume rauschten gleichgültig.
Kirnis legte Waffen und Kind auf den Boden, grub mit den Händen ein Loch in den Mist, die Mutter hob Gondas auf und wandte sich um, sah die anderen angelaufen kommen, erst jetzt wurde ihr klar, was eigentlich los war. Das Grollen war nun ganz nah, es dämmerte, man konnte kaum etwas sehen; Kirnis schob die Leute in die Erdhöhle, so viele Platz fanden, zuerst die Mutter und Gondas, die anderen gruben sich in andere Erdhöhlen durch, krochen hinein, die Männer schlossen die Höhlen von außen wieder mit Mist. Auch die stärkeren Frauen blieben draußen, erhielten jede ein Messer und einen Speer mit schmaler und kurzer Eisenspitze, scharf genug, dass sie bei Bedarf sowohl aus einiger Entfernung als auch aus der Nähe kämpfen konnten.
Alle rannten zurück ins Dorf, so wären sie nicht in der Nähe der Erdhöhlen, wenn ein Kind weinte oder einer der Alten es nicht mehr aushielt und stöhnte. Die schützende Palisade stand schon in Flammen: ›Gleich brennen auch alle Häuser‹, dachte Kirnis bei sich, es herrschte Trockenheit, es dämmerte, das Löschen war ein Ding der Unmöglichkeit. Das Wiehern der Pferde und die ihre Schwerter schwingenden Langobarden mit ihren vor Gier geweiteten Nüstern. Kirnis hatte weder Frau noch Kinder, in den Diensten von Gondas’ Vater hatte er nie die Zeit gefunden, um darüber nachzudenken – und das war gut so, denn er musste dessen Kind beschützen.
Die Häuser in der Nähe der Palisade brannten schon lichterloh, sie waren aus Holz, schön mit Lehm verputzt. Rauch, Schreie, Metall auf Metall, der stumme Abschiedsgruß der Sterbenden an die Göttermutter.
Kirnis drückte die Wildschweinfigur, die an seinem Hals hing: »Beschütze mich, beschütze Gondas«, und stach zu. Immer wieder, wo immer er ein Loch in der Rüstung ausmachte; den Speer hielt er in die Höhe, die Vandalen stürzten von ihren Pferden, Kirnis, blutüberströmt, wer weiß, ob es ihr Blut war oder seines, er würde später nachsehen, jetzt stach er einfach immer wieder zu. Er, der alte Krieger, hatte viele Schlachten geschlagen, aber nie zuvor hatte er eine solche Wut im Bauch gespürt, er wusste, wenn nicht er, dann niemand, ein paar Männer und Frauen, es wurden immer weniger, Kirnis sah, wie die Vandalen in ihren Häusern herumtrampelten und das Beste mitnahmen. Kirnis hörte nicht auf zuzustechen, der Geruch von Blut und Hass war stärker als der schwärzeste Rauch.
Er würde nicht fliehen, aber auch nicht sterben, das durfte er jetzt nicht, er musste dort sein, wo Gondas war, und ihn beschützen. Stille trat ein, keiner lebte mehr, nur Kirnis und die Vandalen, sie lachten laut, zeigten einander, was sie gefunden hatten, und klimperten nicht mehr mit Schwertern, sondern mit dem Silber. Kirnis drückte sich an die Außenwand des Eckhauses, den Speer fest umklammernd für den Fall, dass eines dieser Scheusale ihm zu nahe kam. Ein Schuh war weg, offenbar hatte sich der Riemen gelöst, alles stand in Flammen, Kirnis’ Haare waren versengt, das Feuer kam immer näher, er legte sich ins Gras und kroch leise zum Wald hin los. Die Vandalen setzten sich schon auf ihre Pferde und verschwanden johlend in der Dunkelheit.
Es war Kirnis’ kühnste Schlacht, aber auch seine letzte. Kirnis’ Haus brannte im Gegensatz zu den meisten nicht nieder, daher brachte er Gondas zu sich, und dessen Mutter folgte ihm. Alle im Dorf hatten Angst und schwiegen, starrten mit leeren Augen in die nächtliche Finsternis – aber was hätten sie dort sehen sollen? Am Morgen machten sich die Überlebenden sofort an die Arbeit und räumten in den Brandruinen auf, sammelten herumliegende Sachen ein, fingen ein paar entlaufene Pferde der Langobarden ein, während Gondas seine ersten festen Schritte ging und Kirnis Schild und Speer an die Wand im großen Raum seiner Hütte stellte, wo sie bis zu seinem Tod auf ihn warten würden. Nach jener Schlacht verstummte Kirnis, beantwortete nicht einmal mehr Fragen, sogar als Gondas’ Vater zurückkehrte, sagte er nichts, erklärte nichts, sondern übergab Gondas nur schweigend seinem Vater, sah sich in der ausgebrannten Siedlung um, das linke Bein hatte er schon mit Pelzen umschnürt, und nur die Glöckchen des rechten Schuhs bimmelten wie gewöhnlich – klingeling, klingeling.
Die Häuser wurden wieder aufgebaut, Silber häufte sich an, und alles ging wieder seinen gewohnten Gang, nur Kirnis verlegte sich auf das Herumtragen von Brennholz und ließ sich nicht beirren. In der warmen Jahreszeit saß er in seiner Hütte oder ging in den Wald, und sobald der Frost kam, tat er alles, was nötig war, um Gondas vor der Kälte zu schützen. Manchmal öffnete er auch einfach die Tür, sah nach Gondas und ging wieder nach Hause, ohne zu jemandem ein Wort zu sagen, er atmete die Luft ruhig ein, schnupperte, ob alles in Ordnung war, drehte den Kopf zur Seite und horchte, ob da keine Pferde waren, fremde, die eigenen kannte er, er zog nie mehr mit Gondas’ Vater aus, selbst wenn er ihn dazu einlud, aber weder eine Frau noch Kinder hatte er je, niemand begriff, was er ferner zu tun oder wohin er zu gehen gedachte, niemand sah ihn je mehr glücklich oder traurig, also vergaß man ihn und ließ ihn in Ruhe auf den allein der Göttermutter bekannten Wegen wandeln.
Wenn Kinder oder Frauen an guten Tagen gerade nichts zu tun hatten und jemanden necken wollten, dann sagten sie:
»Kirnis, du lieber Kirnis, du uralter Greis, wo ist denn dein Schuh, wo ist dein Verstand?«
»Verbrannt«, erwiderte Kirnis, er sagte immer dasselbe.
Es braucht so wenig, dass der Verstand verbrennt.
Einmal reisten Soldaten des Kaisers Nero auf den Handelswegen an der Ostseeküste und brachten von dort so viel Bernstein nach Rom mit, dass man damit das Podium der Gladiatorenkämpfe und die Knoten des Netzes zum Schutz vor den wilden Tieren verzieren konnte, während der Sand der Arena, die Leichentragen und die Utensilien, die für Abwechslung bei den täglichen Prozessionen sorgten, aus Bernstein bestanden. Sie brachten winzige Stücke mit und auch sehr große, die mehr als ein neugeborenes Kind wogen.
Die Häuptlinge der Ästier bereiteten ihnen einen freundlichen Empfang, töteten keinen von ihnen und tauschten den Bernstein gegen eine Fülle von Silber, Münzen und anderen Schätzen ein, an denen Männer und Frauen gleichermaßen Gefallen fanden. Sie bereiteten ihnen einen freundlichen Empfang, töteten niemanden, denn wer bekommen hat, was er wollte, kommt wieder.
6. Tränen
Wie jeden Frühling würde auch dieses Jahr der Tag kommen, an dem sich alle freuten, tanzten und sangen, der richtige Tag, um den Willen der Göttermutter zu erfahren, um sie um Gefallen zu bitten. Das war Frauenarbeit, die Männer mischten sich nicht ein, sie hatten ihre eigenen Pflichten, als Soldaten und Händler, die Frauen hätten sie auch gar nicht teilnehmen lassen, es überstieg die Kräfte der Männer, sich um Geburt, Fruchtbarkeit, Ernte und ähnliche Angelegenheiten zu kümmern, mit der Natur zu beraten.
Wenn der Schnee langsam schmolz und die Tage länger wurden, sahen sich die Frauen allmählich rastlos um, schienen stets auf etwas zu warten, aber keine ahnte, worauf – nur die Alte mit den Wolfsbissen am Bein wusste es, sie rief plötzlich alle zusammen, sagte, es sei Zeit; und alle Frauen, ob jung oder alt, ob voller Kraft oder kränkelnd, wenn die Beine sie nur trugen, die Wohlhabenden und sogar die Sklavinnen, flochten, bevor die Dämmerung hereinbrach, ihre Zöpfe, wuschen das Haar mit Kräutersuden, damit es im Abendrot so richtig glänzte, hüllten sich in ihre schönsten Schleier, ließen Kinder und Männer zurück und eilten auf den Lindenhügel, fröhlich und außer Atem; alle liefen sie hin, die jungen und die alten, als wären sie jung, sie spürten keinen Schmerz, sie spürten weder das Knirschen der Gelenke noch die Alltagsmüdigkeit noch irgendeine Art von Furcht: Du bist am Leben, solange du auf den Frauenberg steigen kannst, und wenn du das nicht mehr kannst, wozu dann leben?
Sie mussten auf den richtigen Augenblick warten, wenn Tag und Nacht gleichlang waren; nur die alte Frau wusste Bescheid, sie bereitete sich vor, kochte Trünke für alle und Tollkirschensalbe für die Greisinnen: Die Zutaten waren jetzt vorhanden, die dünnen Frühlingskräuter hatte sie schon in den Kessel geworfen, das Quellwasser und der Zauber der Alten entzogen ihnen ihre Essenz; nur in den Händen der Alten wurden sie so, sonst grünten sie nutzlos, auch die anderen alten Frauen wussten viel über Kräuter, die Hexen, sie wussten zu heilen und zu verzaubern, doch nur die Alte mit den Wolfsbissen am Bein wusste, wie sie sich mit der Göttermutter unterhalten musste, sie um Gnade und Erlaubnis bittend, ihr die auf der Zunge liegenden Fragen stellend; nur sie kannte die Sterne und sah, wann der Tag lang genug war zum Feiern und Bitten.
Ihre Geheimnisse hütete die Alte wie ihren Augapfel. Aber sie war schon alt – was wäre nach ihrem Tod? »Seid beruhigt, habt keine Angst, die alte Frau mit den Wolfsbissen am Bein lässt euch nicht allein, sie weiß viel besser als ihr, wann der Tod kommt, und wird ganz sicher nicht von euch gehen, ohne eine von euch in ihre Geheimnisse eingeweiht zu haben.« Keine der Frauen wusste, wen von ihnen sie im Sinn hatte, alle wollten diejenige sein und warteten voller Ungeduld, aber es war nicht an ihnen zu wählen, die Alte würde die Geeignetste nennen, die Göttermutter würde sie auswählen, und ihr könnt nicht anders, als ihrem Willen zu folgen.
So tanzten jetzt alle ihre Reigen, flochten die ersten Kränze, ganz kleine noch aus kurzen Gräslein, gerade erst hervorgesprossenen, setzten sie sich oder eine der anderen auf, spritzten mit frischem Wasser um sich, nicht eine von ihnen sah nach, ob die andere ihr eine Freundin oder verhasst war, sie gaben sich so, wie sie es nur ohne Männer taten, sangen Lieder, traurige und auch fröhliche, wie sie gerade an die Reihe kamen, wie die Alte sie anstimmte, die anderen begleiteten sie nur, machten Feuer, erbaten bald die eine bald die andere, was ihr Herz begehrte oder woran es in ihrem Heim mangelte, baten um eine gute Ernte, um Weizen, Gerste und Hafer, dazu ein wenig Roggen und Hirse, dass die Kinder nicht hungrig wären, baten darum, dass weder wilde Tiere noch Krankheiten sie heimsuchten, baten um Kampferfolg für ihre Männer, baten um Silber und andere wunderschöne Dinge, baten um Kinder, wenn sie keine hatten, baten um Ruhe, wenn sie schon von allem reichlich hatten. Sie hörten nicht auf zu bitten, so wollte es der Tag, so wollte es das Fest, die Göttermutter erhörte eine jede, sah jede Träne, man durfte sie selbst wegen des kleinsten Begehrens stören. So sagte es die Alte mit den Wolfsbissen am Bein, wer sollte es auch besser wissen als sie?
Sie tranken, was die Alten für sie zubereitet hatte, für jede einen eigenen Trunk, die Alte achtete genau darauf, dass sie nicht verwechselt würden. Auch Selija schlürfte den ihren, die Alte reichte ihr eine rote Flüssigkeit zur Reinigung, so eine würde nicht einmal die Göttermutter erhören, aber was soll’s, Selija wusste, was sie wollte und bekam es auch. Und auch Glesum trank, die anderen hatten sie gegen ihren Willen hergebracht, völlig verängstigt hierher gezerrt; sie stand starr vor Angst da, glaubte vermutlich, man würde sie opfern, aber nein, du Dummerchen, dieses Fest ist nicht von dieser Art, keine Opfer, der Weihrauch, den die Alte aus Bernsteinstaub gemischt und ein wenig weiter weg von den Tänzerinnen unter der Linde mit den meisten Ästen entzündet hat, um die Göttermutter zu betören und ihr Herz zu erweichen, damit keine der einfachen Frauen verletzt würde, ist genug. Die Alte reichte Glesum ihren Trank, damit sie sich beruhigte, sie würde noch lange hier weilen, wie sollte sie alles aushalten, die Ärmste – sie musste zu Kräften kommen, um für all das bereit zu sein, was sie erwartete. Die Alte mit den Wolfsbissen am Bein streichelte Glesums Haar: »Mein Kind, womit hast du das alles verdient, der Sturm wird sich legen, alles wird gut, du wirst leben.« Und wirklich, Glesum kam zur Ruhe, eine starke Friedlichkeit löste den Blick des verängstigten Wolfswelpen ab.
Auch die anderen tranken, bis die alte Frau zum Abschiedstanz lud, zum allerschönsten; eine nahm die andere an der Hand, und so bildeten sie einen riesigen Kreis, beugten sich vor und wieder zurück wie im Fieberwahn, wussten nicht mehr, wer sie waren, in ihrer Weiblichkeit erstarkt, zu einer Einheit, zur unteilbaren FRAU geworden, deren Stärke für Nöte erforderlich war. Als der Gesang verstummt war, eilten alle nach Hause, noch benommen, überglücklich, zurück blieben nur einige der Ältesten und die Alte mit den Wolfsbissen am Bein.
Wer bleiben durfte, wusste es selbst, sie setzten sich unter die alte Linde, der Bernsteinstaub war schon aufgebraucht, und strichen sich Achselhöhlen und Knöchel mit Tollkirschensalbe ein, murmelten halblaut wer weiß was, die Alte mit den Wolfsbissen am Bein führte sie – sie verwandelten sich in Kolkraben oder schwarze Wolken, erhoben sich in die Lüfte und flogen davon, um sich mit den Alten der anderen Stämme zu treffen, landeten auf den Ästen der Linden, schnatterten und erfuhren so den wahren Willen der Göttermutter, die dieses Jahr dies und das versprach, sowohl Besseres als auch Schlechteres. »Das Leben wird nicht so, wie ihr es gerne hättet, aber es wird zum Aushalten sein, wie immer.«
7. Milch
Gondas hatte die Wagen schon wieder mit allerlei wertvollen Gütern vollgeladen: an vorderster Stelle Bernstein, große Brocken und kleinere, unbearbeitet, dazu, soviel davon Platz fanden, von den nach dem Winter wieder guten Pelzen – er schickte sich an, nach Carnuntum zu reisen, vielleicht sogar bis nach Aquileia, das würde er später entscheiden.
Gondas rief erneut die stärksten Männer der benachbarten Stämme desselben Namens, desselben Blutes im Heiligen Hain zusammen, vollgesogen mit den Prophezeiungen der Ahnen und alter Furcht. Ein abgelegener Ort, niemand störte sie hier, und die Götter waren hier besonders nahe. Natürlich würde es mehr Gewinn abwerfen, die Waren nach Aquileia zu bringen, dort kann man den Bernstein direkt an die Handwerker verkaufen, die ihn später bearbeiten. In Carnuntum bekamen sie erheblich weniger dafür, die römischen Zwischenhändler wollten ja auch etwas verdienen. Sie hatten schon einmal Bernstein nach Aquileia gebracht und waren dafür so reich belohnt worden, dass die Achsen ihrer Wagen auf der Rückreise fast gebrochen wären, sie hatten nicht nur Geld und Glasgeschirr mitgebracht, sondern auch Kupfer, Zinn und Zink, das reichte den örtlichen Meistern für Jahre, so viele Messingarmreife, Broschen, Anhänger und anderen Schmuck konnten sie daraus fertigen, mehr als es Leute gab, die Frauen und Männer schmückten sich jeden Tag mit etwas anderem.
Für Selija hatten die Meister damals ein wunderschönes Brustband gefertigt, wie sie es nur in anderen Ländern hatten kennenlernen können, aber auch von sich noch vieles hinzugefügt, sie verstanden nicht weniger von ihrem Handwerk: An den Seiten je zwei Nadeln mit einem runden, perforierten Kopf, eine für die linke, die andere für die rechte Brustseite. An den Köpfen je ein Anhänger befestigt, halbkreisförmig, ebenfalls mit einem hübschen Lochmuster. Auf der flachen Seite je fünf Kügelchen, von denen lange Ketten aus kleineren Kügelchen ausgingen, fünf an der Zahl, von unterschiedlicher Länge, die die ganze Brust bedeckten. Selija trug das Brustband, wenn sie guter Stimmung war oder auch, um zu zeigen, wer im Stamm das Sagen hatte.
Selija stand hinter einem Baum und horchte. Sie wusste, dass sie das nicht durfte, na und? Eine andere Frau mitbringen, das durfte man ja auch nicht, aber wer hörte schon auf sie? Wie sehr sie sich auch immer zu beruhigen versuchte, sie bekam eine Gänsehaut. Die Bäume rauschten irgendwie zornig, und dann war da noch diese Eule, ›U-huuu‹, wie verhext. Warum konnte sie nicht einfach still sein? Sie machte ihr Angst und störte sie beim Zuhören. Und auch die Männer wurden leiser, sie redeten weiter, aber halblaut, sodass Selija kaum noch etwas verstehen konnte.
Es werde immer schlimmer, sagte Gondas, die Germanen witterten die Händler: die Lugier, die Burgunden, die Markomannen, die Quaden – alle warteten nur darauf, die Wagen zu überfallen und die Männer zu erdolchen oder gefangen zu nehmen und den Bernstein für sich zu behalten, als hätten sie ihn selbst eingesammelt. Die Markomannen und die Quaden drangen ins Römische Reich ein, zogen mit ihren Kriegern bis nach Aquileia. Auf dem Weg dorthin traf man jetzt schon nicht mehr nur auf germanische Räuberbanden, sondern auch auf ganze, gut bewaffnete Armeen, den Bernstein und den Proviant, den sie immer mit sich führten, wollten alle. Von so einer Reise konnte man nicht nur ohne Reichtümer, sondern auch gar nicht mehr zurückkehren. Sie sollten sich besser nach Osten wenden, meinte Gondas, über die Berge ziehen, das dauere länger, mindestens fünfzig Tage in eine Richtung, aber so sei nun einmal das Leben, es lasse uns eben oft keine Wahl.
Verhandelt, abgemacht, die Trinkhörner standen bereit, mit Met gefüllt, um die Vereinbarungen zu bekräftigen.
Selija weinte, das hatte ihr gerade noch gefehlt, den Mann zu verlieren, Bentis war noch zu klein, Getier schlich um ihre Beine, im Wald funkelten die Augen der wilden Tiere, Selija rannte, so schnell die Beine sie trugen, nach Hause, völlig außer Atem.
Am Morgen kehrte Gondas müde, aber ruhig zurück – nach der Entscheidung war ihm leichter ums Herz –, er sagte Selija nur, in ein paar Tagen werde er sich mit den besten Männern auf den Weg machen. Selija weinte, bat ihn, nirgendwohin mehr zu gehen, sie hätten auch so schon genug, sogar mehr als genug.
»Was wäre ich für ein Anführer, wenn mich nicht nach mehr dürstete?«, fragte Gondas, und damit war alles entschieden.
Damit auch Selija zu wollen lernte, ließ sie Gondas zu den Wagen gehen, die die Soldaten selbst für alle Fälle abwechselnd bewachten, und sich nach Belieben zu bedienen. Gondas hatte Recht, er war nicht umsonst der Anführer, ohne Grips wird man nicht zum Besten. Zuerst nahm Selija ein paar von den allergrößten Stücken zur Hand: »Aber die kannst du dir nicht um den Hals hängen, und zum Zerteilen sind sie zu schade«, meinte Gondas. Worum es Gondas schade war, darum war auch ihr schade. So gebot es die Pflicht der Ehefrau.
›Vielleicht sollte ich ja, wenn Gondas weg ist, wieder bei der Alten mit den Wolfsbissen an einem Bein vorbeischauen, vielleicht würde sie ja etwas für Glesum zusammenbrauen, damit alles ruhig und schmerzlos vorbei wäre?‹ Später, jetzt war der Bernstein an der Reihe.
Und dann sah Selija das, was sie brauchte. Ein kleines Stück Bernstein, weiß wie Milch, auf dem Wagenboden, gut, dass sie tiefer gegraben hatte. Selija drückte ihn fest in ihrer Hand, den Tropfen, so voller Leben, die allerliebste Milch, am Rand entlang ein feiner Streifen, rot wie geronnenes Blut. Selija würde zu Handwerksmeistern gehen, sich nicht bei ihnen anstellen, das musste sie nicht, die anderen mussten warten, sie würde zu ihnen gehen und sie bitten, einen Anhänger für sie zu fertigen, mit feinen Ketten, damit sie ihn immer um den Hals tragen konnte als Zeichen – sollen die Menschen und Götter nur sehen, wer hier das Sagen hat.
II.
BETA URSAE MINORIS
oder
KOCHAB
IM KLEINEN BÄREN
Kochab (arabisch: al kaukab »Stern«) ist ein orangeroter Riese von etwas geringerer Helligkeit als der Polarstern. Der zweithellste Stern im Kleinen Bären belegt den 49. Platz auf der Helligkeitsskala der Sterne und war im ersten Jahrhundert dem nördlichen Himmelspol am nächsten. Bis heute bleibt unklar, welchen Stern im Kleinen Bären die alten Balten als Polarstern ansahen: Alpha (den heutigen Polarstern) oder Beta (Kochab). Für andere Völker wie die alten Araber war Kochab der Polarstern. Er leuchtet 450-mal heller als die Sonne und ist 42-mal größer als sie. Seine Entfernung zur Erde beträgt etwa 130 Lichtjahre. Sein Alter wird auf etwa 2,95 Milliarden Jahre geschätzt.
8. Nebel
Einige Wochen nach dem Fest der Frauen kam für die Männer die Zeit, in der Krieger und Händler nicht auf Reisen waren, sie blieben zu Hause, weil Jünglinge ihres Stammes das Alter erreicht hatten, in dem sie zu Kriegerfürsten werden sollten, und das Fest ihrer Initiation anstand. In diesem Jahr war die Reihe an Bentis, dem Sohn des obersten Stammesführers, deshalb bereiteten sich alle auf eine besonders feierliche Zeremonie vor, säuberten den Heiligen Hain, schnitten das Gras und lichteten den Jungwald, luden die Stammesführer ein, um zu schauen, was für eine Feier das würde, mit was für Reichtümern und Macht.