Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie – Studienausgabe
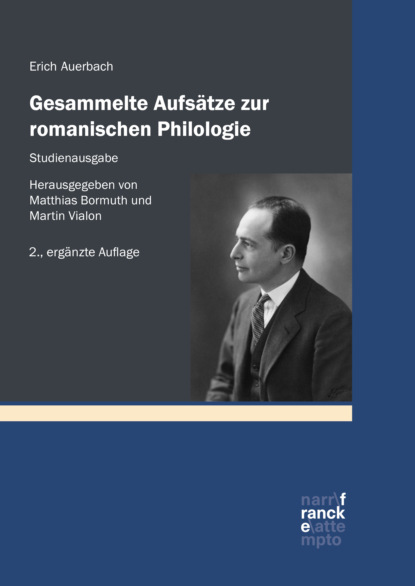
- -
- 100%
- +
Wir versuchen, die Linien von Auerbachs Geschichtskonstruktion zu umschreiben, das gestaltende Prinzip zu kennzeichnen, das sich in jedem seiner Aufsätze, in jedem Kapitel der Mimesis auswirkt. Denn die Idee des Ganzen wird gerade durch die Verkettung der einander bedingenden Phänomene sichtbar. Die Schlüsselbegriffe, deren Auerbach sich immer wieder bedient, sind die der StiltrennungStiltrennung und StilmischungStilmischung. Vergleicht man nämlich die verschiedenen Interpretationen, die die Wirklichkeit in der Geschichte gefunden hat, so treten immer schärfere Grundformen heraus, an welche die Literatur in allem Wechsel und in aller Vielgestaltigkeit unlöslich gebunden zu sein scheint. Die antike Theorie von den Höhenlagen des Stils, denen bestimmte Gattungen entsprechen müssen, eine Theorie, für die jeder Klassizismus, im besonderen der französische des 17. JahrhundertsKlassik (französische), eine neue Resonanz schafft, steht in scharfem Gegensatz zu dem mittelalterlichen «RealismusRealismus»,Realismusim MA und diese Antithetik dient dazu, die Eigentümlichkeit beider Wirklichkeitsdarstellungen durch den Kontrast um so deutlicher zu bezeichnen. Im mittelalterlichen Realismus, in den typologischen Anspielungen der Divina Commedia, von denen mehrere Artikel dieses Bandes handeln, werden zeitlich und kausal weit voneinander entfernte Ereignisse miteinander verknüpft. Die typologische Interpretation löst jedes von ihnen aus dem Zusammenhang, in dem es geschah, heraus, und verknüpft sie durch einen beiden gemeinsamen Sinn.
Alle irdischen Formen der menschlichen Gestalten sind Spiegelungen des Heilsplanes: Cato von UticaCato v. Utica zum Beispiel, der Selbstmörder, der sein Leben für die politische Freiheit gegeben hat und zum Wächter am Fuße des Purgatoriums bestellt ist, präfiguriert die christliche Freiheit. Der irdische Cato, der nicht zur Allegorie wird, sondern wie jede andere Gestalt der Divina Commedia – auch VergilVergil – in seiner geschichtlichen Konkretion erhalten bleibt, war eine figurafigura, eine umbraumbra futurorum, und der im Purgatorio erscheinende ist die Erfüllung jenes figürlichen Vorgangs.
Sofern aber die figurale Darstellung in der Leidensgeschichte Christi ihre Grundlage hat, wird der höchste Gegenstand in der Sprache der humilitas, im sermo piscatoriussermo piscatorius behandelt und damit die Voraussetzung geschaffen für jene mittelalterliche Stilmischung, in der das Erhabene und das Niedrige ineinanderfließen. Die Divina Commedia ist dafür das große Beispiel. In ihr werden dem Sinnlichen keine Fesseln mehr auferlegt, und überall, wo man im MittelalterMittelalter im Kreis derselben Denk- und Anschauungsweise steht, wird das Alltägliche nicht verschmäht, und vom niederen Stil kann nur cum grano salis gesprochen werden – ist es doch ein Stil, der sich ständig ins Tiefste und Höchste fortsetzen und hinüberwirken kann in den erhabenen und religiösen Gedankenkreis. Allerdings ist das Band einer die alltägliche, ökonomische und gesellschaftlich-politische Wirklichkeit unter dem Gesichtspunkt ernster Nachahmung umspannenden Zielsetzung erst den modernen Literaturen des 19. und 20. Jahrhunderts eigen. Schien früher die antike stiltrennende Literatur nur wie eine Station auf dem Weg zu einer figuralen, stilverschmelzenden, so führt jetzt die Darstellung aus dem Mittelalter zur Moderne wie zu einem Gipfel, so daß frühere Kunstformen fast wie Schatten wirken, die von der Modernität überglänzt werden.
Der Inhalt der Mimesis wie aller Schriften Auerbachs besteht zu einem Teil in einer bestimmten Blickrichtung, durch die alle Literatur in eine neue Behandlung gerückt wird und damit auch eine neue Gestalt gewinnt. Denn wenn es ihm auch fern lag, eine vollständige Geschichte des abendländischen RealismusRealismus zu schreiben, so kann seine Darstellung doch eine historische mit systematischer Absicht genannt werden. Seine Beispiele mögen beliebige sein – «weit eher nach zufälliger Begegnung als nach genauer Absicht ausgewählt» –, universal ist gleichwohl der Anspruch, daß die Grundmotive seiner Geschichte der Wirklichkeitsdarstellung «sich an jedem beliebigen realistischen Text aufweisen lassen müßten», und es ist – auch wenn der Begriff Wirklichkeit viele Empfindungen in Bewegung versetzt und mangels endgültiger Präzisierung aus dem Kontext verstanden werden muß – doch ein wesentlicher Fortschritt, daß die Mannigfaltigkeit verschiedener Wirklichkeitsdarstellungen durch neue geistige Medien erblickt wird.
Die Art, wie dies geschieht, ist jedoch keineswegs die deduktive. Es wird keinerlei Theorie oder Prinzip an die Spitze der Untersuchung gestellt. Kein Leser kommt wohl auf den Gedanken, daß die Untersuchung «Mimesis» überschrieben sein könnte,8 und man wird auch erst zum Schluß auf den Titel verwiesen. Für die Darstellung im ganzen ist charakteristisch, daß alle ihre Gedanken an eine Anschauung anknüpfen, die aus dem Eindruck einer Quelle, eines literarischen Textes hervorgeht. Denn jedes Kapitel nimmt seinen Ausgangspunkt von einem Text, der dem Leser im Original – und sofern es sich um antike oder mittelalterliche Texte handelt, im Interesse des erhofften gebildeten Publikums auch in Übersetzung – mitgeteilt wird. Diese Texte erfüllen dieselbe Funktion wie Illustrationen in einem kunsthistorischen Werk und wirken wie von der Darstellung abstreifbare, auch in sich ruhende Bilder oder Zeichnungen. Kennt man das ganze Buch, so wird man verschiedene Kapitel miteinander vergleichen, aufeinander beziehen, miteinander einen wollen, aber man kann auch jedes für sich lesen wie ein Gebilde sui generis, das lediglich aus seinem eigenen Gestaltungsprinzip heraus verstanden werden kann. Und in den Interpretationen treten die Kraft der ästhetischen Phantasie, die freie Beweglichkeit des Autors, der keinen Terminus zur Schablone erstarren läßt, sich jeder neuen Aufgabe differenzierend anpaßt und jeden Text bis in seine feinsten inhaltlichen wie stilistischen Nuancen und Abschattungen zugliedert, auf das glücklichste hervor: vergessene oder selten gelesene Texte wie Ammianus MarcellinusAmmianus Marcellinus, Gregor von ToursGregor v. Tours werden dank der stets unpolemischen, lautlosen und diskreten Meisterschaft des Autors lebendig, andere, wie PetroniusPetronius, werden nicht nur vorzüglich interpretiert, sondern mit einer Eleganz und Delikatesse in die Berliner Mundart übertragen, deren HeinseHeinse, N., hierin schwerfällig, nicht fähig gewesen wäre.
Die Gegenüberstellung des homerischenHomer und des alttestamentlichen Stils dient als Einleitung und Ausgangspunkt. Verkörpern sie doch Grundtypen, deren sachliches Widerspiel oder Korrelat man in der späteren Literatur antreffen wird. So entfernt HomerHomer auch vom Prinzip der StiltrennungStiltrennung ist – sein «idyllisch-friedlicher» RealismusRealismus bleibt doch scharf geschieden von dem tragischen des Alten TestamentsAltes Testament, in dem die «beiden Bezirke des Erhabenen und des Alltäglichen nicht nur tatsächlich ungetrennt, sondern grundsätzlich untrennbar sind». Die stiltrennende antike Literatur wird aber nicht in die Untersuchung einbezogen.9 Auerbach beginnt unmittelbar mit PetroniusPetronius, TacitusTacitus, ApuleiusApuleius und Ammianus MarcellinusAmmianus Marcellinus. Denn so verschieden auch diese Autoren sind, sie scheinen ihm doch geeint zu sein durch die Art, wie sie die niedere Welt von der höheren scheiden. Erst am Ende der antiken Kultur, in der konkreten und rohen Wiedergabe des Sinnlichen bei Gregor von Tours, wird die Umbildung vorbereitet, kraft der das genus humilegenus humile später, in der stilmischenden christlichen Literatur, nicht mehr als nachträglich und abgeleitet, sondern als objektive selbständige Kraft angesehen wird. Selbst im späten MittelalterMittelalter, besonders in Frankreich, kann die christliche Stilmischung in der Form eines Realismus wirksam sein, den Auerbach «kreatürlich» nennt. Er meint damit, exemplifizierend an Antoine de la SaleSale, A. de la, VillonVillon, F., ja sogar noch an Montaigne, einen RealismusRealismus, der, ohne seine Herkunft aus dem christlichen verleugnen zu können, sich doch vom christlichen Ordnungsgedanken emanzipiert hat: «Das irdische Leben wird weit wirksamer gegen den irdischen Verfall und gegen den irdischen Tod abgesetzt als gegen das ewige Heil.»
Demgegenüber steht die ritterliche, die höfische DichtungRoman (höfischer) unter einem andern Gesetz. Die feudale Standesethik der Chansons de gesteChanson de geste, die Sublimierung der Liebe in den Romanen Chrétiens de TroyesChrétien de Troyes bilden keine gemeinsame Beziehungsebene für Gegensätze, die im Denkraum des christlichen RealismusRealismus leicht beisammen wohnen konnten. Sie wirken wie ein Präludium jener Stiltrennung des französischen 17. Jahrhunderts, die viele Züge trägt, die der antiken und auch der höfischen Literatur eignen. Komödie und Tragödie sind hier keineswegs eine unmittelbare Ausstrahlung der Wirklichkeit. Die Personen stehen ihr vielmehr wie isoliert, kontrastierend gegenüber, losgelöst von den Gegebenheiten des täglichen und menschlich-kreatürlichen Lebens. Es ist als ob sie innerhalb der Voraussetzungen der antiken, der höfischen Literatur das Recht eines neuen Faktors erweisen wollten. Insofern eine systematische Reaktion auf RabelaisRabelais, F., MontaigneMontaigne, M. de, ShakespeareShakespeare, W., die für die zuströmende Fülle des Stoffes auch eine selbständige bewegliche Form gefunden haben, die Proportionen, Bezirke, Stile in einem perspektivischen Bewußtsein durcheinanderwirbelt, dessen freier Weiterbildung erst der HistorismusHistorismus im 19. Jahrhundert zugänglich ist. Denn nur wenige wachsen wie der in seiner Zeit isolierte Saint-SimonSaint-Simon, duc de über die Grenzen des 17. Jahrhunderts hinaus, und nur die Fragestellung eines einzigen Schriftstellers, nämlich RousseausRousseau, J. J., barg in sich den Konflikt, der im Fortgang der Entwicklung immer deutlicher die konkrete Gesellschaft zum Problem macht. Diese nicht auf Grund eines idealen Musters, sondern aus ihren eigenen historisch-ökonomischen Voraussetzungen zu begreifen, wird Aufgabe des Historismus und des modernen «realistischen» Romans von StendhalStendhal, H. und BalzacBalzac, H. de bis zu FlaubertFlaubert, G. und ZolaZola, E..
Auf einem so langen Weg hat der Autor uns in die eigene Zeit geführt, deren Wirklichkeitsdarstellung er an Stellen aus Virgina WoolfsWoolf, V. Roman To the Lighthouse und aus Marcel ProustProust, M. untersucht. Daß alles, was hier gesagt wird, durch das Medium eines spiegelnden Bewußtseins wieder erscheint, eines vielfältigen Bewußtseins, das sich frei in die Tiefe der Zeit bewegt, dies erscheint ihm als das Charakteristikum der Moderne, in der ein neues Ganzes sich bilden könnte und hinter deren Theorie und Kraft der Gestaltung ein differenziertes Gefühl für die Wirklichkeit steht, etwas Neues und Elementares, das sie über die Grenzen der frühen Literatur hinausführt: «… die Wirklichkeitsfülle und Lebenstiefe jedes Augenblicks, dem man sich absichtslos hingibt.»
Wie die einzelnen Kapitel der Mimesis und der Literatursprache, so haben auch die miteinander verbundenen Aufsätze ihren Einheitspunkt in der Entwicklung jenes perspektivischen Historismus, dessen Einwirkung Auerbach erfahren und den er – MeineckesMeinecke, F. Historismusbuch ergänzend – in der Interpretation der abendländischen Literatur neu zu begründen versucht hat. Verschiedene neue Prinzipien sind in dieser Interpretation erfaßt: die Verbindung der antiken und der modernen Literatur durch einen einmütigen Zusammenhang, Kombination der stilkritischen Analyse mit der soziologischen, Erschließung der Einheit der Wirklichkeitsauffassung in der Breite einer Periode und im Sinn des Verlaufs der geschichtlichen Entwicklung, so daß jede einzelne Erscheinung zugleich in ihrer Zeit und in ihrer Bedeutung als einem Moment im Ganzen des universalhistorischen Zusammenhangs verstanden werden konnte. Und nicht zuletzt die stets fühlbare Wechselwirkung des Interpreten zum geistigen und politischen Leben der eigenen Zeit, in der alle Grundsätze, ja die Zukunft Europas selber ins Wanken geraten sind. Daß der Einheit eines geschlossenen Systems manche Opfer gebracht werden mußten, daß manche Epochen und Literaturen – wie die deutsche des 17. Jahrhunderts, die englische, die spanische, die russische – übergangen oder nur streifend berührt werden konnten, kann bei einem Werk, das so weite Räume und Zeiten umspannt und so viele bewunderungswürdige Blicke enthält, nicht überraschen. Denn stand die Methode mit vielen verwandten Prinzipien der Soziologie10 in Verbindung, so hat der Wirklichkeitsbegriff nicht die Geschlossenheit, die ihm mit allen Tatsachen die Geschichte in überzeugenden Einklang setzen könnte. – Und nach Auerbachs Begriff der Geschichte fällt schließlich der Schwerpunkt derselben in jene Darstellung, die das Leben unmittelbar auf die gesellschaftlich-ökonomische politische Wirklichkeit bezieht, die im 19. Jahrhundert zur Geltung kam. Die Macht ihrer Energie, ihre Beherrschung des zeitgenössischen Daseins bewegt ihn so sehr, daß das Verhältnis des Lesers zur Moderne in solchem Grade angeregt wird, daß andere Epochen in eine historische Ferne treten, als ob auch ihre Zeit und Umgebung dem Maßstab der Gegenwart unterworfen seien. Aber die gestaltende Macht des Don Quijote, der jede Bedingtheit der Person durch Zeit oder Milieu ironisiert,11 die ekstatische Form spanischer MystikMystik, der glänzende Ausbau des goldenen Zeitalters in Spanien ist durch andere, entgegengesetzte Auffassungen von Wirklichkeit bedingt. Jedoch ihre Bedeutung, ihr mächtiges Wachstum gehörten nicht neben die Konfiguration der Entwicklung von Mimesis, die in der Beschreibung der Verzweigung und Wechselwirkung vieler geistiger Bewegungen anmuten kann wie die reiche Bewegung des handelnden Lebens selbst.
Fritz Schalk
Sacrae scripturae sermo humilis (1941)sermo humilis
En commentant le vers Inf. 2, 56 e comminciommi a dir soave e piana qui se rapporte au langage de Béatrice, Benvenuto Rambaldi da Imola Rambaldi da Imola. B., qui écrit dans la seconde moitié du XIVe siècle, s’explique ainsi : et bene dicit, quia sermo divinus est suavis et plan us, non altus et superbus sicut Virgilii et poetarum. Cette distinction faite entre le style de la sagesse divine et celui des grands poètes de l’antiquité nous rappelle toute une tradition chrétienne. Tandis que le mot suavissuavis est d’un emploi assez vague et général, au moins sous l’angle de la distinction des genera dicendi,1 le mot planusplanus a toujours exprimé le langage simple, populaire, compréhensible à tous, donc le plus bas des trois styles dans l’échelle de la théorie classique. C’est, dans la tradition de l’éloquence, le contraire à la fois du style docte, du style figuré et du style sublime et pathétique. Saint AmbroiseAmbrosius, hl., dans un passage de Isaac vel Anima 7, 57, cité par ForcelliniForcellini, A., s.v. planusplanus, dit que le sage qui veut expliquer quelque chose d’obscur, tout en possédant pleinement les forces de l’éloquence et de la science, condescendit tamen ad eorum inscitiam qui non intelligunt, et simplici atque planiore atque usitato sermone utitur, ut possit intelligi ; et un peu plus tard il combine, dans le même sens, planior avec humilior.2 Ce serait donc, selon Benvenuto, un style simple, populaire, humble, indocte dont se sert Béatrice en énonçant les vérités éternelles de la foi et de la sagesse divine. Mais cela est-il possible ? La théologie, qui contient les mystères les plus sublimes et les plus cachés à l’entendement commun, comme celui de la Trinité ou celui de la rédemption, peut-elle se servir d’un genre de langage qui, dans l’usage ancien, n’était admis que pour des sujets bassement réalistes tels que la comédie, ou pour le discours judiciaire, mais seulement quand il s’agissait d’affaires privées et d’intérêts d’argent ?
DanteDante lui-même, quand il parle de sa Comédie dont le sujet est des plus sublimes – le sort des âmes après la mort, la justice de Dieu révélée – s’exprime parfois d’une manière qui rappelle l’idée de son commentateur Benvenuto ; pour désigner son poème, il se sert du mot commedia, tandis qu’en parlant de l’Énéide il dit à Virgile : l’alta tua tragedia. Dans un passage souvent cité de la lettre à Cangrande, il explique ce choix du titre par deux considérations : c’est une comédie d’abord parce que la fin en est heureuse, et ensuite parce que son style est bas et humble: remissus est modus et humilishumilis, quia locutio vulgaris in qua et mulierculae comunicant. De prime abord il peut sembler que la seconde considération ne se rapporte qu’à l’emploi de la langue italienne ; mais ce n’est pas ainsi qu’il faut comprendre, car DanteDante lui-même a créé le style sublime en langue italienne, autant dans la théorie du De Vulgari Eloquentia que dans la pratique des grandes Canzoni ; c’est lui précisément qui a créé l’idée du Vulgare illustrevulgare illustre et qui est le fondateur de ce qu’on appelle l’humanisme en langue vulgaire. Donc il est loin de regarder chaque œuvre comme étant de style bas du seul fait qu’elle est écrite en langue maternelle et non en latin. Les paroles sur le style bas et humble de la Divine Comédie ne se rapportent pas à l’emploi de la langue italienne, mais bien au choix des mots bas et au réalisme fort poussé dans beaucoup de parties du poème3 – deux choses qui lui semblaient incompatibles avec le genre sublime et tragique tel qu’il l’avait conçu en étudiant la théorie des anciens. Toutefois il se rend compte que son poème dépasse les bornes du style bas. Dans ce même passage de la lettre à Cangrande dont nous parlons, il cite les vers de l’Art poétique d’HoraceHoraz qui permettent au poète comique d’employer parfois le style tragique et vice versa – sans doute pour nous dire qu’il a fait usage de cette faculté. Mais il y a bien plus : DanteDante sait que son style comme son sujet sont des plus sublimes. Inutile d’énumérer ici tous les passages qui en témoignent. Notons seulement qu’il appelle deux fois sa Comédie «poème sacré», qu’il aspire au laurier des plus grands poètes, que Virgile est son modèle, qu’il traite de la matière la plus haute qui existe, à laquelle les forces humaines suffisent à peine et que personne avant lui n’a essayée, qu’il implore l’inspiration des Muses, d’Apollon et enfin de Dieu lui-même. Le poème sacré, al qual ha posto mono e cielo e terra, n’est pas une œuvre du style bas, et son auteur le sait, malgré le titre et les explications qu’il en donne. Ce n’est pas non plus un poème du style sublime dans l’acception antique ; il y a trop de réalisme, trop de vie concrète, trop de biotikon, comme disaient les théoriciens grecs : autant dans les paroles que dans les faits, et non seulement chez les habitants de l’Enfer, mais aussi au Purgatoire, souvent même dans le Paradis. Donc si c’est du sublime, c’est un sublime d’un autre genre que celui de l’antiquité, un sublime qui contient et comprend le bas et le biotikon ; DanteDante l’a bien vu, quoiqu’il ait éprouvé des difficultés à s’exprimer nettement sur ce problème. Benvenuto da Imola l’a compris quand il dit, à la fin de son introduction : unde si quis velit subtiliter investigare, hic est tragoedia, satyra et comoedia. Et les Romantiques du XIXe siècle s’en sont inspirés, toutefois d’une manière un peu superficielle ; car c’est bien plus que de mêler le «grotesque» au sublime.
C’est une tâche assez délicate que de chercher les origines de la conception nouvelle de la haute poésie. La théorie du moyen âge avant DanteDante n’en dit rien, à ce qu’il semble ; mais la pratique se trouve très nettement établie dans l’art populaire chrétien depuis la fin du XIe siècle, autant dans le théâtre liturgique que dans la statuaire des cathédrales. L’histoire du Christ en offre tous les éléments ; plus elle devient populaire et familière à tous, plus son réalisme originaire, intimement lié à son sublime, se développe et refleurit. Il est indéniable qu’il s’agit d’un sublime de création essentiellement chrétienne, provoqué et inspiré par l’histoire du Christ et le «style» de l’Écriture sainte en général. On en trouve la théorie chez les Pères de l’ÉgliseKirchenväter ; il est vrai qu’après eux, du VIe au XIe siècle, on n’en trouve que des traces assez faibles et vagues – surtout dans les actes des martyrs.
Chez les Pères de l’ÉgliseKirchenväter, la conception du style simultanément humble et sublime réalisé dans l’Écriture sainte ne se forme pas d’une manière purement théorique, mais elle leur est pour ainsi dire imposée par les circonstances, par la situation dans laquelle ils se trouvaient. Elle s’est formée spontanément à la suite de la polémique provenant de la part des païens cultivés, qui se moquaient du mauvais grec et du réalisme bas des livres chrétiens ; en partie aussi à cause d’un certain malaise que des chrétiens qui avaient reçu une éducation soignée dans les écoles de rhétorique avaient éprouvé tout d’abord, eux aussi, à leur lecture. Par sa formation classique et par la force de son cour qui lui fait vivre toutes ses idées et leur donne une vigueur d’expression incomparable, saint AugustinAugustinus occupe, pour notre problème, la place la plus importante.
Il raconte dans ses Confessions (III, 5) comment tout d’abord il a commencé à lire les Saintes Écritures sans être capable de les comprendre : il n’était pas encore fait pour entrer dans leur sens ni pour suivre leur pas, car elles lui semblaient trop au-dessous de la dignité cicéronienne. Il n’avait pas encore compris, dit-il, que leur apparence extérieure était humble, mais leur contenu sublime et voilé de mystère (rem … incessu humilem, successu excelsam et velatam mysteriis) ; qu’il fallait les lire comme un petit enfant, et qu’elles «grandissaient avec les enfants». Plus tard il comprend : eoque mihi illa venerabilior et sacrosancta fide dignior apparebat auctoritas, quo et omnibus ad legendum esset in promptu, et secreti sui dignitatem in intellectu profundiore servaret : verbis apertissimis et humillimo genere loquendi se cunctis praebens, et exercens intentionem eorum qui non sunt leves corde ; ut exciperet omnes populari sinu, et per angusta foramina paucos ad se traiceret ; multo tamen plures quam si non tanto apice auctoritatis emineret, nec turbas gremio sanctae humilitatis hauriret (ibid., VI, 5). Dans ces passages, il s’agit surtout du contraste entre le style humble qui se prête aux plus simples et les mystères sublimes qui y sont cachés ; des mystères qui ne se révèlent qu’à peu de gens ; non pas aux érudits et aux orgueilleux, mais à ceux qui nont sunt leves corde, tout simples qu’ils sont. On trouve cette idée un peu partout dans l’ouvre de saint AugustinAugustinus, par exemple dans le premier chapitre De Trinitate : Sacra scriptura parvulis congruens nullius generis rerum verba vitavit, ex quibus quasi gradatim ad divina atque sublimia noster intellectus velut nutritus assurgeret ; au second livre De Doctrina christiana, où il parle de la Scripturarum mirabili altitudine et mirabili humilitate ; plusieurs fois quand il parle du langage de la Genèse ; et assez longuement dans une lettre à Volusien (CXXXVII, 18). Dans ce dernier passage, il dit notamment que même les mystères les plus profonds ne sont pas exprimés, dans l’Écriture sainte, par un langage «superbe» : ea vero quae in mysteriis occultat, nec ipsa eloquio superbo erigit, quo non audeat accedere mens tardiuscula et inerudita quasi pauper ad divitem ; sed invitat omnes humili sermone, quos non solum manifesta pascat, sed etiam secreta exerceat veritate, hoc in promptis quod in reconditis habens. Donc, dans tous ces passages, il s’agit d’une synthèse entre l’humble et le sublime, réalisée par l’Écriture sainte ; toutefois, le humile y signifie plutôt la simplicité de l’élocution que le réalisme, et le sublime ou altum plutôt la profondeur des mystères que le sublime poétique. Mais un mot tel que humilishumilis (parfois il emploie abiectus) qui exprime en même temps l’humilité du cœur chrétien, la bassesse de la position sociale et la simplicité populaire du style4 amenait facilement la notion du réalisme, d’autant plus qu’il s’employait couramment pour désigner le bas peuple par opposition aux classes élevées, les pauvres par opposition aux riches. La vie du Christ, du Verbe incarné, modèle de vie et de mort saintes et sublimes, s’était passée elle aussi, comme une vie ordinaire ou les scènes d’une comédie, parmi les humiles personae qui avaient été ses premiers disciples. Saint AugustinAugustinus parle souvent de ces imperitissimi et abiectissimi, de ces piscatores et publicani que le Seigneur a élus avant tous les autres, et il explique pourquoi il a agi ainsi.5 Il y insiste d’autant plus qu’il sait que les païens érudits se moquent du sermo piscatoriussermo piscatorius des Évangiles. Mais ce n’est pas seulement l’entourage du Christ, c’est lui-même, son sort sur la terre qui exprime l’antithèse entre l’humble et le sublime dans sa forme la plus aiguë et la plus passionnante – et alors, il ne s’agit plus de l’élocution, mais des faits. Parmi les nombreux passages où saint Augustin fait ressortir le paradoxe du sacrifice de Jésus-Christ, je n’en citerai qu’un seul qui se trouve dans les Enarrationes in Psalmos, XCVI, 4 : Ille qui stetit ante iudicem, ille qui alapas accepit, ille qui flagellatus est, ille qui consputus est, ille qui spinis coronatus est, ille qui colaphis caesus est, ille qui in ligna suspensus est, ille cui pendenti in ligna insultatum est, ille qui in cruce mortuus est, ille qui lancea percussus est, ille qui sepultus est, ipse resurrexit : Dominus regnavit. Saeviant quantum possunt regna ; quid sunt factura Regi regnorum, Domino omnium regnorum, Creatori omnium saeculorum ? On dira peut-être qu’un tel passage ne fait que résumer le récit de la Passion, et qu’il ne contient que des choses connues par les Évangiles et par les lettres de saint Paul qui a exprimé la même idée plusieurs fois, par exemple Phil. II, 7–11. Mais ni les Évangiles ni saint Paul n’ont aussi puissamment relevé l’antithèse entre le bas réalisme de l’humiliation et la grandeur surhumaine qui s’unissent ici ; pour la sentir dans toute sa force il fallait un homme formé aux idées classiques de la séparation des styles qui n’admettaient pas de réalisme dans le sublime ni d’humiliation corporelle chez le héros de la tragédie. Il est vrai que l’idée du sublime tragique avait subi chez quelques groupes de poètes et de théoriciens des restrictions et des modifications ; mais elles ne sont nullement comparables à la violence de l’humiliation réaliste qu’offrent la vie et la passion du Christ. Saint AugustinAugustinus a senti que l’humilitas de l’Évangile est en même temps une forme toute nouvelle du sublime : une forme qui lui semblait, s’il la comparait aux conceptions de ses contemporains païens, plus profonde, plus vraie, plus substantielle ; elle aussi, tout comme l’Évangile dans lequel elle est contenue, excipit omnes populari sinu, et non seulement tous les hommes sans égard à leur position sociale, mais toute leur vie basse et quotidienne. La conception de l’homme, de ce qui en lui peut être admirable et digne d’imitation, se modifiait profondément ; Jésus-Christ devient le modèle à suivre, et c’est en imitant son humilité qu’on peut approcher de sa majesté ; c’est par l’humilité qu’il a atteint lui-même le comble de la majesté, en s’incarnant non pas dans un roi de la terre, mais dans un personnage vil et méprisé.

