Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie – Studienausgabe
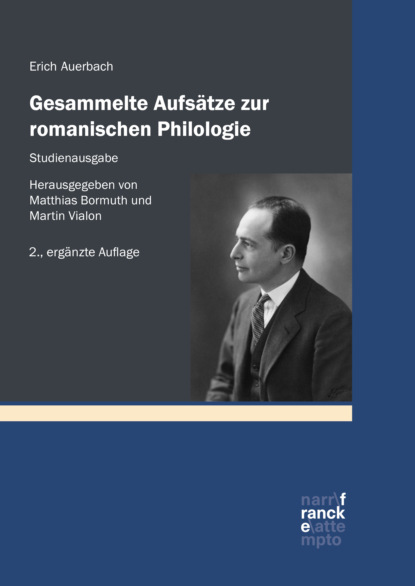
- -
- 100%
- +
Ohne Zweifel ist paupertas eine AllegorieAllegorie. Und doch hätten alle konkreten Einzelheiten des armen Lebens – wie sie etwa das Sacrum Commercium aufzählt – nicht den gleichen energischen Schauder hervorgerufen wie die hier mit wenigen Worten, aber eindringlich herausgearbeitete Vermählung mit einem alten, häßlichen und verachteten Weibe. Die Bitterkeit, das Widrige, körperlich und moralisch Abstoßende einer solchen Vereinigung zeigt die Größe des heiligen Entschlusses in voller sinnlicher Kraft; sie zeigt auch die dialektische Wahrheit, daß nur Liebe fähig ist, diesen Entschluß zu verwirklichen. Im Sacrum Commercium wird ein Festmahl gefeiert, bei dem sich nacheinander herausstellt, daß die Brüder nur ein halbes irdenes Gefäß haben, um sich die Hände zu waschen, kein Tuch, um sie zu trocknen, nur Wasser, um das Brot hineinzutauchen, nur wilde Kräuter, um sie zum Brote zu essen, kein Salz, um die bitteren Kräuter zu salzen, kein Messer, um sie zu reinigen und das Brot zu schneiden. Bei dieser Aufzählung und Ausmalung wird man einen gewissen Überdruß nicht ganz unterdrücken können; es wirkt pedantisch, kleinlich und gesucht. Schon anders ist es, wenn von einem einzelnen dramatischen Akt des Armutswillens berichtet wird, wie sie sich vielfach in der Legende des Heiligen finden; etwa von der Szene, wie er die Brüder in Greccio durchs Fenster an einem allzu schön geschmückten Tisch essen sieht: er leiht sich Hut und Stab eines Armen, geht laut bettelnd an die Tür und bittet als armer Pilger um Einlaß und Speise; als die erstaunten Brüder, die ihn natürlich erkennen, ihm den verlangten Teller geben, setzt er sich damit in die Asche und sagt: modo sedeo ut frater minor. Das ist eine Szene, die das eigentümlich Ergreifende seines Auftretens schön ausdrückt, aber doch nicht die ganze Bedeutung seines Lebens. Dazu wären viele Anekdoten ähnlicher Art nötig gewesen, deren jede einen Stein zu dem Ganzen beigetragen hätte; das hat die biographische und legendäre Überlieferung geleistet, in der Komödie war dafür kein Raum. Und es war auch nicht ihre Aufgabe. Die Anekdoten der Legende waren jedermann bekannt; mehr als das, Franz von AssisiFranz v. Assisi im Ganzen war längst ein festes, abgeschlossenes Bild im Bewußtsein aller Zeitgenossen. Anders als bei manchen anderen, weniger bekannten oder stärker umstrittenen Personen, die in der Komödie erscheinen, hatte DanteDante hier eine fest umrissene Gestalt als Gegenstand, und seine Aufgabe war, sie so darzustellen, daß sie, ohne an Konkretheit zu verlieren, in dem größeren Zusammenhang ihrer Bedeutung sichtbar wurde. Es mußte wohl das Konkrete der Person des Heiligen erhalten bleiben, aber nicht als eigentliche Absicht der Darstellung, sondern sich einfügend in die Ordnung, in die jene Person von der Vorsehung hineingestellt war; es mußte das Persönlich-Konkrete des Heiligen seinem Amt untergeordnet werden und nur aus dem Amt hervorleuchten. Darum schrieb DanteDante nicht eine Begegnung mit dem Heiligen, in der sich etwa dieser in einer ihm eigentümlichen Weise gezeigt oder geäußert hätte, sondern eine Vita, ein Heiligenleben; die große Bedeutung, die DanteDante der Wirksamkeit beider Gründer der BettelordenBettelorden zuschreibt, konnte er kaum durch ihren eigenen Mund schildern lassen; er läßt sie durch die beiden großen Kirchenlehrer, die aus den Orden hervorgegangen sind, durch Thomas und BonaventuraBonaventura darstellen. In beiden Viten ist die Person dem Amt oder vielmehr der Sendung, zu der sie berufen waren, untergeordnet. Bei dem cherubisch weisen DominicusDominicus, Hl., dessen Amt Predigt und Lehre war und dessen Person sich an volkstümlicher Wirkung nicht mit der des seraphisch glühenden Franciscus vergleichen konnte, tritt das eigentlich Biographische noch weit mehr zurück, und an seine Stelle tritt eine Fülle von Bildern: Bräutigam des Glaubens, Gärtner Christi, Winzer am Weinberg, Kämpfer für den Samen der heiligen Schrift, Sturzbach über die Äcker der Ketzer, Rad am Streitwagen der Kirche. Das alles sind Sinnbilder für das Amt. Die vita Francisci ist weit lebensnäher, aber auch sie steht unter der Führung des Amtes: hier ist es nur ein einziges durchgeführtes Bild, das der Hochzeit mit der Armut, das zugleich dem Leben seine ständige Form gibt und es unter das Zeichen des Amtes stellt. Das Amt ist also auch in der Biographie Franzens entscheidend, das Konkrete des Lebens hat sich unterzuordnen, und eben dazu dient die Allegorie der Armut: sie bringt in einem die Mission des Heiligen und das eigentümlich Atmosphärische seiner Person, dies letztere mit äußerster Intensität, doch immer im Zeichen des Amtes; so wie es durch Franz selbst gegeben war, dessen starke und hinreißende persönliche Konkretheit niemals frei umherschweifte (vaneggiava), sondern sich ganz in sein Amt ergoß. «Franzisce», so spricht Gott in einem deutschen Passional4 zu dem Heiligen, «nimm die bitteren Ding für die süßen und verschmäh dich selber, daß du mich bekennen magst.» Nimm die bitteren Ding für die süßen … Gibt es wohl ein bittereres Ding als die Vereinigung mit jenem Weibe? Aber er nahm es, wie DanteDante zeigt, für ein süßes. Alle bitteren Dinge sind in dieser Vereinigung zusammengefaßt, alles, was an Bitterkeit und Selbstverachtung auszudenken wäre, liegt darin beschlossen, samt der Liebe, die stärker ist als alles Bittere, über alle Süße süß und Bekenntnis Christi.
Gewiß ist paupertas eine AllegorieAllegorie; aber sie wird nicht als solche eingeführt, geschweige denn beschrieben; wir erfahren nichts über ihr Aussehen, nichts über ihr Kleid, wie das sonst bei Allegorien üblich ist; selbst ihren Namen erfahren wir nicht sogleich. Zunächst hören wir nur, daß Franciscus ein Weib gegen die Meinung aller Welt liebt und sich mit ihr vereinigt; ihr Aussehen wird uns nur indirekt, aber um so eindringlicher, dadurch deutlich, daß alle Welt sie flieht wie den Tod und daß sie seit sehr langer Zeit verlassen und verachtet auf einen Liebhaber wartet. Sie spricht auch nicht, wie im Sacrum Commercium, oder wie die Allegorien Mangel, Schuld, Sorge und Not im letzten Akt des zweiten Teils von Goethes Faust; sie ist nur die stumme Geliebte des Heiligen, mit ihm auf noch viel engere und eigentlichere Art verbunden als die Sorge mit Faust. So kommt das Lehrhafte, welches in einer Allegorie liegt, gar nicht als lehrhafte Mitteilung zum Bewußtsein, sondern als wirklicher Vorgang. Als Weib des Franciscus steht die Armut in der konkreten Wirklichkeit; da aber Christus ihr erster Gatte war, so ist die konkrete Wirklichkeit, um die es sich handelt, zugleich Teil eines großen weltgeschichtlichen und dogmatischen Zusammenhangs. Paupertas verbindet Franciscus mit Christus, sie begründet die Stellung des Heiligen als imitator Christi. Unter den drei Motiven, die in unserem Text auf die Nachfolge hinweisen – Sol oriens, mystische Hochzeit, Stigmatisation – ist das zweite, die mystische Hochzeit, insofern das wichtigste, als aus ihm die Begründung für die beiden anderen und für die Stellung Franzens überhaupt herzuleiten ist. Als zweiter Gatte der Armut ist er Nachfolger oder Nachahmer Christi.
Christi Nachfolge oder Nachahmung ist ein durch viele Stellen des Neuen TestamentsNeues Testament begründetes, allen Christen gesetztes Ziel. In den ersten Jahrhunderten der kämpfenden Kirche, durch die Blutzeugenschaft der Märtyrer, ergab es sich, daß die Nachfolge nicht nur moralisch in der Befolgung der Gebote und Nachahmung der Tugenden, sondern auch existentiell, durch Erleiden des gleichen oder eines ähnlichen Martyriums geleistet wurde. Derart existentielle Formen der Nachfolge Christi, der Nachahmung seines Schicksals, sind auch nach dieser Epoche immer wieder erstrebt worden; sogar der Heldentod im Kampf gegen die Ungläubigen wurde als eine Form der Nachfolge empfunden. In der MystikMystik des 12. Jahrhunderts, vor allem wohl durch Bernhard von ClairvauxBernhard v. Clairvaux und seine cisterziensischenCisterzienser Schüler, bildete sich eine ekstatische Gesinnung, die durch Versenkung in das Leiden Christi, im wesentlichen also kontemplativ, eine existentielle Nachfolge des Heilands zu erreichen versuchte, und in der die innere Erfahrung der Passion, unio mystica passionalis, als höchste Stufe der kontemplativen Versenkung angesehen wurde. Franz von AssisiFranz v. Assisi ist insofern ein Fortsetzer der cisterziensischen Passionsmystik, als auch in seiner Gestalt, ja in ihr am stärksten, die Erfahrung der Passion als ultimo sigillo erscheint; aber der Weg dahin ist weit mehr als bei den CisterziensernCisterzienser aktiv und lebensmäßig – nicht in erster Linie auf Kontemplation, sondern auf Armut und Demut, auf der Nachahmung des armen und demütigen Lebens Christi ist die Nachfolge gegründet. Franz gab der mystischen Vergeistigung der Nachfolge eine unmittelbar auf der Schrift beruhende, unmittelbar jedem zugängliche und unmittelbar lebensmäßige Grundlage: eben die Nachfolge der praktischen Armut und Demut Christi. In dieser konkreten Erneuerung der existentiellen Nachfolge liegt auch die Begründung dafür, daß er von den Zeitgenossen als würdig des Stigmatisationswunders angesehen wurde; kein anderer hat den Gedanken der existentiellen Nachfolge so von Grund aus neubelebt wie er.
Es wird nun deutlich, daß DanteDante auf keine andere Art das Wesentliche der Gestalt des Heiligen so einfach und unmittelbar darstellen konnte wie durch die mystische Hochzeit mit der Armut, die seine imitatio Christi begründet. Sie erst stellt Franz in den weltgeschichtlichen Zusammenhang, in den er nach DantesDante Anschauung gehört; ein Zusammenhang, der in seiner Zeit noch überaus lebendig war. Für die mittelalterliche Epoche, bis tief in die Neuzeit hinein, war ein bedeutendes Ereignis oder eine bedeutende Gestalt im eigentlichen Sinne «bedeutend»; es bedeutete Erfüllung eines Planes, Erfüllung von etwas Vorausverkündetem, bestätigende Wiederholung von etwas schon Dagewesenem und Ankündigung von etwas einst Kommendem. In der Abhandlung über figurafigura versuche ich darzulegen, wie die sogenannte typologische Deutung des Alten TestamentsAltes Testament, die die Ereignisse desselben als reale Vorankündigungen der Erfüllung im Neuen TestamentNeues Testament, insbesondere also des Erscheinens und des Opfertodes Christi auffaßt, ein neues System der Geschichts- und überhaupt Wirklichkeitsinterpretation geschaffen hat, die das christliche MittelalterMittelalter beherrscht und DanteDante entscheidend beeinflußt hat; die Figuralinterpretation schafft einen Zusammenhang zwischen zwei Geschehnissen, die beide innergeschichtlich sind, in welchem eines von beiden nicht nur sich selbst, sondern auch das andere bedeutet, dies andere dagegen das erste einschließt und erfüllt. In den klassischen Beispielen ist der zweite erfüllende Teil stets Christi Erscheinen und die damit zusammenhängenden Ereignisse, die zur Erlösung und Neugeburt des Menschen führen; und das Ganze ist eine Gesamtdeutung der vorchristlichen Weltgeschichte auf das Erscheinen Christi hin. Die existentielle Nachfolge nun, mit der wir es hier, bei der mystischen Hochzeit des Franciscus mit der Armut zu tun haben, ist gleichsam eine umgekehrte Figur; sie wiederholt gewisse charakteristische Züge des Lebens Christi, erneuert und verleiblicht es vor aller Augen, und erneuert damit zugleich das Amt Christi als eines guten Hirten, dem die Herde folgen müsse. Io fui degli agni della santa greggia che Domenico mena per cammino, sagt Thomas, und Franciscus wird archimandrita genannt. Figur und Nachfolge bilden zusammen eine Versinnbildlichung der geschlossenen teleologischen Geschichtsauffassung, deren Mitte das Erscheinen Christi ist; dieses bildet die Grenze zwischen dem alten und dem neuen Bunde; man erinnere sich, daß die Zahl der Seligen aus beiden Bünden, wie sie in DantesDante weißer Rose des Empireo dargestellt werden, am Ende aller Tage genau gleich sein wird und daß auf der Seite des neuen Bundes nur noch wenige Sitze frei sind – das Weltende steht also nahe bevor. Unter den Heiligen des neuen Bundes aber nimmt Franciscus einen besonderen Platz in der weißen Rose ein, den großen Patriarchen des alten gegenüber, und so wie diese Vordeuter waren, so ist er, der stigmatisierte Gatte der Armut, der hervorragendste unter den späten Nachahmern Christi, dazu bestimmt, die Herde auf den rechten Weg zu lenken, die Braut Christi zu unterstützen, daß sie sicher und treu zu ihrem Geliebten eilen möge.
All diese Zusammenhänge waren dem mittelalterlichenMittelalter Leser spontan erkennbar, denn er lebte in ihnen; die Vorstellungen von vordeutender und nachahmender Wiederholung waren ihm so geläufig wie etwa einem heutigen Leser der Begriff der geschichtlichen Entwicklung; stellte man sich doch sogar das Erscheinen des Antichrist als eine genaue, aber trügerische Wiederholung des Erscheinens Christi vor. Uns ist das spontane Verständnis dieser Geschichtsauffassung verlorengegangen, wir sind genötigt, sie durch Forschung zu rekonstruieren. Aber an ihr entzündete sich DantesDante Inspiration, deren Glut wir noch zu fühlen vermögen; trotz unserer Abneigung gegen Allegorien ergreift uns im elften Gesang des Paradiso die Wirklichkeit des Lebendigen; eines Lebendigen, das nur hier, in den Versen des Dichters, noch lebt.
Figurafigura (1938)
I. Von TerenzTerenz bis QuintilianQuintilian
Figura, vom gleichen Stamme wie fingerefingere, figulusfigulus, fictorfictor und effigies, heißt nach seiner Herkunft «plastisches Gebilde» und findet sich zuerst bei TerenzTerenz, der Eun. 317 von einem Mädchen sagt: nova figura oris. Etwa aus gleicher Zeit dürfte das PacuviusPacuviusfragment 270/1 (RibbeckRibbeck. O., Scaen. Roman. Poesis Fragm. I, S. 110) stammen:
Barbaricam pestem subinis nostris optulit
Nova figura factam ….1
Es ist wahrscheinlich, daß PlautusPlautus das Wort nicht gekannt hat; er verwendet zweimal ficturafictura (Trin. 365, Mil. 1189), freilich beide Male in einem Sinne, der eher die Tätigkeit des BildensSensuslehre als ihr Ergebnis ausdrückt; fictura wird später sehr selten.2 Mit der Erwähnung des Wortes fictura werden wir sogleich auf eine Eigentümlichkeit von figurafigura hingewiesen: es ist (Ernout-MeilletMeillet, A.Ernout, A., Dict. étym. de la langue latine, p. 346) unmittelbar vom Stamm abgeleitet, nicht, wie naturanatura und andere gleicher Endung, vom Supinum. Man hat dies aus einer Angleichung an effigieseffigies (StolzStolz, F.-SchmalzSchmalz, J. H., Lat. Gramm., 5. Aufl. S. 219) erklären wollen: jedenfalls drückt sich in dieser besonderen Bildung des Wortes etwas Lebend-Bewegtes, Unvollendetes und Spielendes aus, und jedenfalls liegt in ihr eine hohe Eleganz der lautlichen Erscheinung, die viele Dichter bezaubert hat. Daß die beiden ältesten Belege uns nova figura bieten, kann ein Zufall sein; bedeutsam, auch wenn es ein Zufall ist, da das neu Erscheinende, sich Wandelnde am Beständigen der ganzen Geschichte des Wortes das Gepräge gibt.
Diese Geschichte beginnt für uns mit der Graezisierung der römischen Bildung im letzten vorchristlichen Jahrhundert, und an ihren Anfängen haben drei Schriftsteller entscheidenden Anteil: VarroVarro, LucrezLukrez und CiceroCicero. Freilich können wir nicht mehr genau bestimmen, was sie aus dem verlorenen früheren Bestande übernommen haben; allein der Beitrag von LucrezLukrez und von CiceroCicero ist so eigentümlich und jeweils so selbständig, daß man ihnen ein hohes Maß von eigener Bedeutungsschöpfung zutrauen muß.
VarroVarro besitzt solche Selbständigkeit am wenigsten. Daß bei ihm figurafigura zuweilen «äußere Erscheinung», ja «Umriß» heißt,3 also sich von seinem Ursprung, dem engeren Begriff des plastischen Gebildes, loszulösen beginnt, scheint ein allgemeiner Vorgang gewesen zu sein, auf dessen Ursachen wir noch zurückkommen. Bei Varro ist diese Entwicklung nicht einmal sehr ausgeprägt. Er ist Etymologe, der Ursprung des Wortes ist ihm bewußt (fictor cum dicit fingo figuram imponit, de ling. lat. 6, 78), und so enthält das Wort, wo er es von Lebewesen und Gegenständen gebraucht, zumeist eine plastische Vorstellung. Wie weit sie noch wirksam war, ist zuweilen schwer zu entscheiden; so etwa, wenn er sagt, daß man beim Kauf von Sklaven nicht nur die figura berücksichtige, sondern auch die Eigenschaften, wie bei Pferden das Alter, bei Hähnen den Zuchtwert, bei Äpfeln das Aroma (ib. 9,93); oder wenn er von einem Stern sagt, er habe colorem, magnitudinem, figuram, cursum verändert (Zitat bei AugustinAugustinus, de civ. Dei 21, 8); oder wenn er de ling. lat. 5, 17 gegabelte Palisadenpfähle mit der figura des Buchstabens V vergleicht. Ganz unplastisch wird es, sobald von Wortformen die Rede ist. Wir haben, so etwa sagt er de ling. lat. 9, 21, von den Griechen neue Formen der Gefäße übernommen; warum wehre man sich gegen neue Wortformen, formae vocabulorum, als seien sie giftig? Et tantum inter duos sensus interesse volunt, ut oculis semper aliquas figuras supellectilis novas conquirant, contra auris expertes velint esse? Hier liegt der Gedanke, daß es auch für den GehörssinnSensuslehre Figuren gebe, schon sehr nahe; zudem muß man wissen, daß Varro, wie übrigens alle lateinischen Autoren, die nicht als philosophische Spezialisten eine genaue Terminologie besitzen, figurafigura und formaforma im allgemeinen Gestaltsinn unbedenklich durcheinander verwenden. Eigentlich heißt forma «Gußform», französisch moule, und steht also zu figura in dem Verhältnis der Hohlform zu dem aus ihm hervorgehenden plastischen Gebilde; doch ist bei Varro nur selten etwas davon zu spüren, allenfalls vielleicht in dem Fragment bei GelliusGellius 111, 10, 7: semen genitale fit ad capiendam figuram idoneum.
Die eigentliche Neuerung und Verwischung des ursprünglichen SinnesSensuslehre, die man zuerst bei VarroVarro trifft, liegt auf dem grammatischen Gebiet; wir deuteten es schon oben an. Bei Varro zuerst finden wir figurafigura als grammatische Bildung, Ableitung, Flexionsform. Figura multitudinis heißt bei ihm die Form des Plurals, alia nomina quinque habent figuras (9, 52) bedeutet: andere Substantiva haben 5 Deklinationsformen. Dieser Gebrauch hat eine bedeutende Wirksamkeit gehabt (vgl. ThLL, figura III A 2 a col. 730 und 2 e col. 734); formaforma ist ebenfalls im gleichen SinneSensuslehre viel verwendet worden, schon seit Varro, es scheint aber figura bei den lateinischen Grammatikern häufiger und beliebter gewesen zu sein. Wie war es möglich, daß beide Worte, zumal figura, das in seiner Wortform noch deutlich an seinen Ursprung erinnerte, so schnell zu rein abstrakter Bedeutung gelangen konnten? Dies geschah durch die Graezisierung der römischen Bildung. Das Griechische, dessen wissenschaftlich-rhetorischer Sprachschatz unvergleichlich reicher war, besaß eine große Anzahl Worte für den Gestaltbegriff: μορφήμορφή, εἶδοςεἶδος, σχῆμασχῆμα, τύποςτύπος, πλάσιςπλάσις, um nur die wichtigsten zu nennen; die philosophische und rhetorische Ausbildung des platonischPlaton-aristotelischen Sprachgebrauchs hatte jedem dieser Worte seinen Bezirk angewiesen und inbesondere zwischen μορφή und εἶδος einerseits, σχῆμα andererseits die Grenze klar bestimmt: μορφή und εἶδος ist die Form oder Idee, die die Materie informiert, σχῆμα die rein sinnliche Gestalt dieser Form; die klassische Belegstelle hierfür ist AristotelesAristoteles’ Metaphysik ζ, 3 p. 1029, wo im Rahmen der Darstellung der οὐσíα die μορφήμορφή als σχῆμα τῆς ἰδέας bezeichnet wird; und so findet sich bei ihm auch σχῆμα rein sinnlich als eine der Qualitätskategorien und die Zusammenstellung von σχῆμα mit μέγεϑοςμέγεϑος, ϰίνησιςϰίνησις und χρῶμαχρῶμα, die wir schon bei VarroVarro antrafen. Es ergab sich von selbst, daß im Lateinischen für μορφή und εἶδοςεἶδος formaforma eintrat, das ja von Haus aus die Modellvorstellung enthielt; gelegentlich findet sich auch exemplarexemplar; für σχῆμασχῆμα hingegen setzte man zumeist figurafigura. Da nun σχῆμασχῆμα als «äußere Gestalt» sich in der griechischen wissenschaftlichen Terminologie weit ausgedehnt hatte – grammatisch, rhetorisch, logisch, mathematisch, astronomisch –, so trat hier im Lateinischen überall figura ein; und so erschien neben und vor der ursprünglichen Bedeutung des Plastischen ein weit allgemeinerer Begriff der sinnlichen Erscheinung und der grammatischen, rhetorischen, logischen, mathematischen Form, ja später auch der musikalischen und choreographischen. Freilich ist die ursprüngliche Bedeutung des Plastischen nicht ganz verlorengegangen, denn auch τύπος «Gepräge» und πλάσιςπλάσις, πλάσμα «plastisches Gebilde» wurden, wie es sich aus dem Stamm fig ergab, oft durch figura wiedergegeben. Aus der Bedeutung τύποςτύπος entwickelte sich figura als «Abdruck des Siegels», was als Metapher eine ehrwürdige Geschichte hat, von AristotelesAristoteles de mem. et rem. p.450 a 31 ἡ κίνησις ἐνσημαίνεται οἷον τύπον τινὰ τοῦ αἱσϑήματος über AugustinAugustinus epist. 162, 4 und IsidorusIsidor v. Sevilla diff: 1, 528 bis zu DanteDante come figura in cera si suggella, Purg. 10, 45 oder Par. 27, 62.4 Über das Plastische hinaus ist τύπος wegen seiner Neigung zum Allgemeinen, Gesetzlichen und Exemplarischen (vgl. die Zusammenstellung mit νομικῶς, Arist. Pol. β 7 p. 1341 b 31) für figurafigura bedeutend geworden, und dies hat wiederum dazu beigetragen, die ohnehin subtile Grenze gegen formaforma zu verwischen. Die Verbindung mit Worten wie πλάσιςπλάσις verstärkte die wahrscheinlich schon von Anfang an bestehende, aber nur langsam sich vorarbeitende Expansionsneigung von figurafigura in der Richtung «Statue», «Bild», «Porträt»; es greift über in das Gebiet von statuastatua, ja von imagoimago, effigieseffigies, speciesspecies, simulacrumsimulacrum. Wenn man also im großen sagen kann, daß figura im lateinischen Sprachgebrauch für σχῆμασχῆμα eintritt, so ist doch damit die Kraft des Wortes, potestas verbi, nicht erschöpft: figura ist weiter, nicht nur zuweilen plastischer, sondern auch beweglicher, stärker ausstrahlend als σχῆμα. Freilich ist auch dieses noch dynamischer als unser Fremdwort «Schema»; heißen doch bei Aristoteles die mimischen Gesten der Menschen, insbesondere der Schauspieler σχῆματα; die Bedeutung der bewegten Form ist σχῆμα keineswegs fremd; aber figura hat dieses Element der Bewegung und Verwandlung sehr viel weiter entwickelt.5
LucrezLukrez verwendet figurafigura im griechisch-philosophischen Sinne auf eine höchst eigentümliche, freie und bedeutende Art. Der Ausgangspunkt ist der allgemeine Begriff «Gestalt», und zwar findet er sich in allen Abstufungen vom energisch Plastischen (manibus tractata figura, 4, 230) bis zum rein geometrischen Umriß (2, 778; 4, 503); er überträgt den Begriff auch vom Plastischen und Optischen auf das Akustische, wenn er 4, 556 von der figura verborumfigurafigurae verborum, figurae senentiarum spricht.6 Der wichtige Übergang von der Gestalt zu ihrer Nachahmung, vom Urbild zum Abbild, läßt sich am besten an der Stelle fassen, die von der Ähnlichkeit der Kinder mit ihren Eltern, von der Mischung der Samen und von der Vererbung handelt; von den Kindern, die utriusque figurae, des Vaters und der Mutter sind, die oft proavorum figuras wiedergeben, und so fort: inde Venus varias producit sorte figuras (4, 1223). Hier zeigt sich, wie das Spiel zwischen Urbild und Abbild gerade nur mit figura gut durchzuführen war; formaforma und imagoimago liegen jeweils allzu fest im einen oder im anderen Sinne; figurafigura ist sinnlicher und beweglicher als forma und bewahrt das Selbst des Ursprünglichen reiner als imago. Freilich ist hier, wie auch späterhin, wenn von Dichtern die Rede ist, überall zu berücksichtigen, welch vorzüglichen dreisilbigen Hexameterschluß figura in allen Flexionsformen bietet.7 Eine besondere Abwandlung der Bedeutung «Abbild» findet sich in LucrezLukrez’ Lehre von den Gebilden, die sich wie Häutchen (membranae) von den Dingen abschälen und in der Luft umherstreifen, jener demokritischenDemokrit Lehre von den «Bildfilmen» (DielsDiels, H.), den materialistisch verstandenen Eidola, die er simulacrasimulacrum, imagines, effigiaseffigies und bisweilen auch figuras nennt; und so findet sich auch bei ihm zuerst figurafigura in der Bedeutung von «Traumbild», «Phantasiegestalt», «Schatten des Toten».

