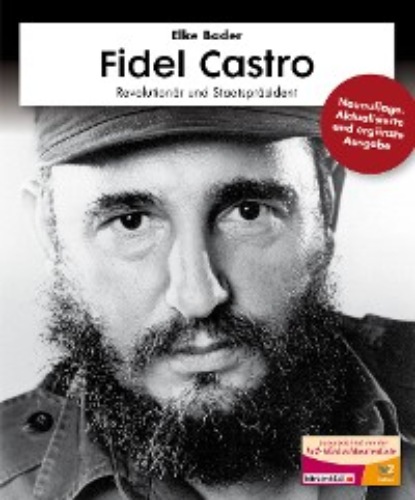- -
- 100%
- +

Lina Ruz González als junge Frau, Birán. Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader
Das Mädchen, Lina Ruz González, wurde als Köchin im Haushalt von Ángel Castro angestellt. Die Liebe muss durch den Magen gegangen sein, denn bald wurde die Neunzehnjährige Lina schwanger von ihrem achtundzwanzig Jahre älteren Patron. Ángela Maria war das erste Kind, das sie ihm unehelich gebar. Es folgten sechs weitere: Ramón, Fidel, Raúl, Juanita, Enma und schließlich, 1938, Augustina.
Zwar trennte sich Ángels erste Ehefrau María Luisa von ihm, doch verweigerte sie viele Jahre lang die Scheidung. Ángel Castro und Lina Ruz González konnten darum erst 1943 heiraten, als María Luisa50 endlich doch noch in die Scheidung einwilligte. Seine Kinder aus der Beziehung mit Lina erkannte er als legitim an.
Fidel Castros Mutter Lina wird als einfache Bäuerin ohne Schulbildung beschrieben, die sich aber sehr fürsorglich und beflissen um ihre Kinder sorgte, sich mit eisernem Willen für deren Bildung einsetzte und den Haushalt zusammen hielt. Wie der Vater, brachte auch sie selbst sich Lesen und Schreiben bei. Fidel Castro erinnert sich an seine Mutter: „Sie war eine außergewöhnliche Arbeiterin, und kein Detail entging ihrer Beobachtung. Sie war Köchin, Ärztin, Beschützerin von uns allen und kümmerte sich um jede Sache, die wir brauchten. Es gab kein Problem, das sie nicht zu meistern wusste. Sie hat uns nicht verzogen; sie hat Ordnung, Sparsamkeit und Hygiene von uns gefordert, und sie hatte sowohl innerhalb als auch außerhalb unseres Hauses alles im Griff. Sie war die Wirtschaftsexpertin der Familie. Niemand weiß, woher sie die Zeit und Kraft nahm für all diese Aktivitäten; man sah sie nie sitzen oder sich ausruhen, den ganzen Tag war sie in Bewegung.“51

Kinderbett und Geburtsstätte Fidel Castros in Birán. Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader
Mutter Lina war der religiöse Mittelpunkt der Familie, eine gottesfürchtige Katholikin, deren fromme Vorstellungswelt durchwandert war vom Glauben an Magie, an böse Geister, Hexen oder an eine unheimliche Gottheit, die sich an Straßenecken verstecken und Züge entgleisen, Autos ineinander rasen lassen oder Menschen verwirren konnte. Ebenso gab es in ihrem Götterhimmel auch wundertätige Heilige, die zwar unsichtbar, doch unter den Menschen lebten. Sie konnten sich durch einen Stein, den Wind, in Bäumen, in einer Meereswelle offenbaren. Und wehe, man riss diesen Göttern ihre Tarnkappen vom Kopf, dann ritten sie auf einem oder schlüpften in den Körper und sprachen wirr durch den geliehenen Mund. In einem solchen Moment wurde der Besessene selbst zum Ort von Orícha, zum Gott. Auf Kuba ist heute noch der afrokubanische Volksglauben, die Santería allgegenwärtig. Es sind religiöse Bräuche und Riten einst versklavter Afro-Kubaner, die sich vor allem auf dem Land mit der katholischen Heiligenverehrung vermengt haben.
Santería Gottheiten und Geistwesen (Oríchas)52:
Olofi – ist der oberste und einzige Gott in der Santería, Schöpfer des Lebens und aller Energie. Für Menschen ist er unerreichbar, auch wird er nicht direkt angebetet. Es sind Geistwesen, Oríchas, die zwischen den Menschen und ihm vermitteln.
Elegguá - ist der Erste Krieger, Herr aller Wege und Kreuzungen. Elegguá vermittelt zwischen den Menschen und den Oríchas. Er kann Glück oder Unglück bringen, Krieg oder Frieden. Bei allen Santería-Ritualen muss er als Erster begrüßt werden und die Opfergaben erhalten. Da er kein Kostverächter ist, gelingt es einem bisweilen, ihn mit Wein milde zu stimmen. Zumeist wird er durch einen Stein oder Holz präsentiert, die Augen bilden zwei Muscheln.
Kettenfarbe: rot-schwarz

Hausaltar für Elegguá mit Opfergaben. Trinidad. Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader
Ogún (Oggún) - ist der Zweite Krieger, Herr des Eisens, der Mineralien, Schlüssel, Werkzeuge und Gefängnisse. Er ist einerseits Beschützer der Handwerker, doch repräsentiert er auch den Krieg. Sinnbild urtümlicher Kraft.
Kettenfarbe: grün-schwarz
Yemayá - ist die Patronin der Seeleute, der Bucht von Havanna (ihre Bedeutung verschmilzt mit der Virgen de Regla in Havanna) und Schutzherrin des Meeres. Sie kann lieblich sein, sich jedoch auch in eine rasende Furie verwandeln.
Kettenfarbe: blau- weiß, oder kristallfarben
Ochún - ist die Göttin der Liebe und der Schönheit und die Schutzpatronin Kubas. Sie synkretisiert mit der Virgen de la Caridad del Cobre, der barmherzigen Jungfrau von Cobre, der Nationalheiigen Kubas in der Wallfahrtskirche El Cobre bei Santiago de Cuba.
Kettenfarbe: gelb, goldgelb

Die Jungfrau von Cobre rettet Seeleute aus der Not. Gemälde, Wallfahrtskirche El Cobre. Santiago de Cuba. Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader
Changó (Shangó) - ist der virilste unter den Gottheiten, der zugleich Stärke aber auch männliche Schönheit repräsentiert. Er ist ein Krieger, der Gott des Donners und des Blitzes, doch liebt er auch Musik und Tanz. Er zeichnet sich durch Fleiß, Mut und Ehrgeiz aus, hat aber auch seine Schwächen: Er ist eitel und gilt als Frauenheld und Herzensbrecher. Rotwein konsumiert er in beachtlichen Mengen. Sein Gedenktag fällt auf den der Heiligen Barbara.
Kettenfarbe: rot-weiß
Als Fidel Castros Mutter mit ihm schwanger ging, bat sie einen Santero, einen Priester der Santería, um ein Ritual. Der erkannte, dass das noch ungeborene Kind ein Schützling Aggayús war, des uralten Gottes der Wüste, der Vulkane und des Firmaments. Das Kind nun ausgerechnet diesem Gott zu weihen, erwies sich als unmöglich, denn alle alten Priester, die um das geheimnisvolle Ritual wussten, waren längst verstorben. Darum wählte man für die Weihe den nächstgelegenen Heiligen, nämlich den Sohn Aggayús, den Kriegsgott Changó, auch Hüter des Feuers und des Donners. Lina muss beseelt nach Hause gewankt sein, als ihr der Priester zum Klang der entfesselten Batá-Trommeln offenbarte, nun sei das Kind in ihrem Bauch der Auserwählte dieses Kriegers.
„Changó galt als unermüdlicher Don Juan, streitsüchtig, mutig, waghalsig, besessen von seiner männlichen Kraft und Schönheit“,53 beschreibt der Kuba-Kenner Ulli Langenbrinck den Gott. Und erkennt man in dieser Beschreibung nicht auch Eigenschaften Fidel Castros wieder?

Fidel Castro im Alter von drei Jahren. Birán. Bildquelle: Christa Schmalzried und Elke Bader
Doch damit nicht genug, sein Götterhimmel erstreckt sich sogar bis Baden-Württemberg, an den südlichen Rand der schwäbischen Alb, denn man nannte ihn Fidel, nach dem Heiligen Fidel von Sigmaringen54, wie er amüsiert zum Besten gab. Fidel Castros Zahlenmystik um seinen Geburtstag wurde damit noch durch seine Heiligengeburt gekrönt – eine Legende, die so manchem sein wundersames Überleben von sage und schreibe 638 Mordanschlägen erklären mag. Die Tatsache, dass er weltweit der Einzige war, der so viele Attentatsversuche überlebte, bescherte ihm im Übrigen auch einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde55.
Kapitel 6
Schulzeit und Rebellentum
Ihr EPUB-Reader unterstützt keine HTML5 Audio-Tags.
Fidel Castro wurde auf eine von seinem Vater gegründete Grundschule geschickt.

Die Grundschule in Birán. Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader
Als Analphabet hatte der Vater sich lange Jahre mühsam durchschlagen müssen. Darum stand Bildung für ihn hoch im Kurs. Er war es auch, der eine Lehrerin dazu brachte, in dieser Pampa Kinder zu unterrichten.
„Ich hatte zwei ältere Geschwister, Angelita und Ramón, die auf diese Schule gingen, und sie nahmen mich mit, obwohl ich eigentlich noch zu jung war, und setzten mich mitten auf eine Schulbank in der ersten Reihe. .... Vier Jahre alt war ich. Ich lernte, zu schreiben und zu krakeln, indem ich den anderen Kindern zusah und der Lehrerin, was sie mit der Kreide an die Tafel schrieb“56, erinnert sich Castro an sein erstes Schuljahr.

Das Klassenzimmer der Grundschule in Birán. In der ersten Reihe in der Mitte saß Fidel Castro.
Anders als die Kinder der amerikanischen Angestellten der United Fruit Company wurden die Castro-Kinder zusammen mit den Kindern der Landarbeiter und Bauern unterrichtet. Diese kamen barfuß. Sie besaßen oft nicht einmal ein paar Schuhe, ihre Kleidung war ärmlich. Es waren Kinder von Haitianern, die in einfachen Hütten aus Palmfasern und Guano, mit gestampftem Lehmboden lebten. Als Kind sollte er erleben, wie diese Familien eines Tages, auf Grund der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Batistas, aus ihren Hütten vertrieben und auf Schiffe verladen wurden. Dort, wohin man sie brachte, sollte sie ein noch elenderes Dasein erwarten. Mit Entsetzen sah Fidel Castro damals Szenen der Verzweiflung, die sich am Hafen von Santiago de Cuba abspielten.
In der Grundschule lernten die Kinder lesen, schreiben, ein paar Grundrechenarten und das Singen der Nationalhymne. Mehr nicht. Die Lehrerin erkannte Fidels Begabung und nahm ihn und seine ältere Schwester, später auch noch Ramón, mit nach Santiago de Cuba. Doch statt sie zu unterrichten, wie sie versprochen hatte, benutzte sie die Kinder des zahlungskräftigen Patrons nur, um mit dem Geld ihre eigene verarmte Familie über Wasser zu halten. In dem dunklen, feuchten Haus litt Fidel nicht nur unter der Enge sondern musste sich auch in ein Leben des Nichtstuns fügen. Es war verlorene Zeit. Und es war das erste Mal, dass er Hunger am eigenen Leib verspüren sollte: „Bei dieser Familie ging es mit jedem Centavo um Leben oder Tod“57, erinnert er sich an die damaligen Zustände.

Das Haus der Lehrerin in Santiago de Cuba, in dem Fidel Castro als Kind wohnte. Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader
Als Mutter Lina ihre abgemagerten Sprösslinge in den Ferien zu Gesicht bekam, schritt sie energisch ein. Ramón, Fidel und Raúl kamen auf eine ordentliche Schule, das Colegio de la Salle in Santiago de Cuba. Es wurde von französischen Ordensbrüdern geführt. Allerdings setzten deren Strenge, Strafen und Restriktionen den drei Castro-Brüdern ziemlich zu. Die Brüder waren isoliert. Weil sie unehelich und nicht getauft waren, verspotteten ihre Mitschüler sie als „Juden“. Fidel wurde übrigens erst mit acht Jahren getauft. Die Hänseleien ihrer Mitschüler reizten die Brüder mitunter bis zur Weißglut. Doch die Castros, allen voran Fidel, wehrten sich „mit überzeugenden Faustschlägen“58 Besonders aber stieß dem Jungen auf, dass die Schüler immer wieder von den Priestern mit harter Hand gezüchtigt wurden. Vor allem der ihnen zugeteilte Betreuer legte ausgesprochen brutale Erziehungsmethoden an den Tag. Mehrfach traktierte er auch den kleinen Fidel mit Faustschlägen auf den Kopf. So lange, bis dieser sich die Behandlung eines Tages nicht mehr gefallen ließ und mit aller Kraft, die das Kind aufzubringen vermochte, zurückschlug.59

Auch Mutter Lina zeigte sich gerne kämpferisch. Hier 1958 mit Gewehr und Pistole. Birán. Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader
Für die drei Castro-Jungens bedeutete dies jedoch zurück nach Birán. Die Aussicht, von nun an sein Dasein auf den Zuckerrohrfeldern der väterlichen Farm fristen zu müssen, gefiel dem damals elfjährigen Fidel überhaupt nicht. Voller Wut über diese Ungerechtigkeit drohte er seinen Eltern: „Ich sagte ihnen, wenn ich nicht mehr in die Schule gehen dürfte, dann würde ich das Haus abfackeln.“60

Die Eltern Lina Ruz Gonzales und Ángel Castro. Birán. Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader
Ramón blieb auf der Farm und war glücklich darüber. Fidel und Raúl kamen als Internatsschüler auf das Jesuitenkolleg Dolores in Santiago de Cuba. Es galt damals als eines der angesehensten im ganzen Umkreis. Das Kolleg war nur den Söhnen wohlhabender, weißer Familien vorbehalten. Weder Schwarze noch Mestizen waren zugelassen, es herrschte strenge Rassentrennung. Während Raúl die Schule mit dem endlosen „Beten und der Furcht vor Gott“ 61 verabscheute, schien Fidel fasziniert von der Disziplin, dem Charakter und der Unerbittlichkeit des Glaubens der Jesuiten. Dass die spanischen Ordensbrüder allesamt Franco-Anhänger waren, nationalistisch, rechts, rassistisch und reaktionär, bekümmerte zwar den jungen Fidel damals, doch andererseits war er froh, endlich Lehrer gefunden zu haben, die ihn mit Respekt behandelten und die ihn zu fördern wussten: „Der spanische Jesuit kann einem einen großen Sinn für persönliche Würde einschärfen, ein Ehrgefühl. Er weiß Dinge wie Charakter, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Mut einer Person zu würdigen und anzuerkennen. Oder die Fähigkeit, ein Opfer zu bringen. Das sind Werte, die sie begeistern.“62

Raúl Castro als kleiner Junge in Uniform. Birán. Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader
Noch einmal wechselte er und kam schließlich an die renommierteste Schule auf ganz Kuba, das Jesuitenkolleg Belén in Havanna. Bereits bei seiner Aufnahmeprüfung im Oktober 1941 hinterließ der junge Fidel Castro einen bleibenden Eindruck bei seinen Lehrern, während seine distinguierten Mitschüler aus der Oberklasse den Bauernsohn aus dem als rückständig belächelten Osten eher mit Herablassung behandelten. Doch Castro bewies sich. Im Sport als der beste Baseballspieler des Schulteams, im Unterricht wegen seines enormen fotografischen Gedächtnisses. Er verblüffte alle, da er ganze Buchseiten, die er kurz zuvor gelesen hatte, auswendig wiedergeben konnte.
Castro lernte an dieser Schule auch die Schriften José Martís kennen, mit deren Gedankengut er sich bald schon identifizierte. 1945 schaffte er seinen Abschluss als einer der besten Schüler des Internats. Stolz schenkte ihm sein Vater zum bestandenen Abitur ein nagelneues Ford Cabrio. Das Fahren brachte er sich selbst bei.

Bachelor-Diplom Fidel Castros, Havanna, vom 29. September 1945, Birán. Interessant ist hier der zweite Name Fidel Castros, nämlich Casiano. Dies spricht für die These, dass er sich später den Namen „Alejandro“ in Anlehnung an Alexander den Großen selbst gegeben hat (s. Norberto Fuentes, die Autobiographie des Fidel Castro). Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader
Kurz darauf schrieb er sich für das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Havanna ein. Und damit begann eine knallharte Lehrzeit, die so gar nichts mit den gängigen Vorstellungen eines Jurastudiums gemein hat. Denn an der Universität glänzten viele Professoren mehr durch Abwesenheit, während Studenten sich gewalttätige Machtkämpfe um die Kontrolle der studentischen Gremien lieferten. Die Universität galt als Sprungbrett in die politische Führung des Landes.
Kapitel 7
Der Don Quijote des Campus
Ihr EPUB-Reader unterstützt keine HTML5 Audio-Tags.
Als Fidel Castro sich an der Universität einschrieb, war der zweite Weltkrieg gerade zu Ende gegangen, im zerstörten Berlin wehte die rote Flagge der Sowjetunion über den Ruinen des Reichstags. Im August 1945 hatten US-amerikanische Atombomben die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki in Schutt und Asche gelegt, Japan kapitulierte. Der „heiße“ Krieg war zu Ende. Dafür standen sich bereits zwei Jahre später die beiden Supermächte USA und Sowjetunion fortan als unerbittliche Feinde gegenüber. Kapitalismus gegen Kommunismus. Ein Wettrüsten im Schatten der Atombombe begann. Propagandaschlachten tobten zwischen den beiden Blöcken. Und der heiße Krieg hatte sich auf die Gebiete der Dritten Welt verlagert.
In jener Zeit drehte sich das Präsidenten-Karussell auf Kuba laufend mit Hilfe US-amerikanischer Interventionen. Wer es zu Reichtum bringen wollte, machte sich zum Dienstleister der amerikanischen wie kubanischen Oligarchen, um mit ihrer Unterstützung den begehrten Posten ergattern zu können.
1944 hatte der bereits 1933 schon einmal kurzzeitig als Präsident amtierende Ramón Grau San Martín, von Beruf Physiologie-Professor, die Wahlen gewonnen – gegen den Batista-Kandidaten. Der vom Volk geschätzte Grau war mit der „Partido Revolucionario Cubano“, der „Revolutionären Partei Kubas“ angetreten. Die Partei und ihre Anhänger nannten sich auch „Auténticos“, die Authentischen, in Anlehnung an den Freiheitskämpfer José Martí. Ganz in dessen Geiste, war Grau vor vier Jahren noch die treibende Kraft hinter der gemeinsam mit Batista erarbeiteten fortschrittlichen Verfassung von 1940 gewesen. Doch nun nahm er auf dem Präsidentensessel Platz, auf dem vorher Batista gesessen hatte und dies bedeutete, mit einer von seinem Vorgänger leergeräumten Staatskasse regieren zu müssen. Unter dem Deckmantel der Ideale Martís, agierte auch die Regierung Grau bald korrupt und erging sich in fragwürdigen Spekulationen. Und nicht nur dies. Sie machte sich auch früh schon zum Handlanger jenes Ungeistes der US-amerikanischen „McCarthy-Ära“63, als deren hysterischer Kommunistenhass nach Kuba herüberschwappte. Gewaltsame Übergriffe der Polizei waren an der Tagesordnung.
„Hier in Kuba wurden unter der Regierung des Professors für Physiologie rechtschaffende kommunistische Arbeiterführer brutal ermordet...“64 erinnert sich Castro rückblickend im Gespräch mit dem Journalisten Ignacio Ramonet.
Vergleichbar mit den Jahren der 68er-Bewegung in Westeuropa und in den USA, war die Universität damals die Arena, in der die ideologischen Grabenkämpfe zwischen radikal progressiven Bestrebungen und traditionell konservativen Überzeugungen ausgetragen wurden. Absolutheitsansprüche auf der einen, erstarrte autoritäre Strukturen auf der anderen Seite verhärteten die Fronten. Es herrschten Chaos und anarchistische Zustände. Nur mit dem Unterschied, dass an der Universität von Havanna mit Waffen, Drohungen, Intrigen, Verrat und Morden gekämpft wurde. Gangsterbanden terrorisierten den Campus. Am Ende ging es um Kontrolle und Macht, weniger um den Wissenschaftsbetrieb. Den jeweils aussichtsreichsten Studentenführern wurden seitens der Regierung Posten angeboten, sie erhielten Privilegien oder Stipendien. Sie sich gewogen zu machen, hieß sich die Macht durch den rebellischen Nachwuchs zu sichern.
Die Universität wurde zu Castros politischer Lehranstalt. Er begab sich mitten hinein in das Auge des Taifuns. Und kaum auf dem Campus, strebte er auch schon danach, der Führer des Studentenverbandes zu werden. Der redegewandte, stets elegant gekleidete Bauernsohn fiel auf. Sein damaliger Kommilitone Alfredo Guevara erinnerte sich an ihre erste Begegnung: „Da kam dieser Castro daher, umwerfend herausgeputzt in seinem schwarzen Abendanzug, gut aussehend, selbstsicher, aggressiv und offensichtlich eine Führerpersönlichkeit. […] ich sah ihn als politische Bedrohung.“65
Bald bemühten sich zwei der einflussreichsten politischen Lager um ihn, der MSR66 – „die sozialistische revolutionäre Bewegung“ – und der UIR67, die „aufständische revolutionäre Union“. Doch was hier nach weltverbessernden Vordenkern in organisierten Studentengremien klingt, war nichts anderes als zwei rivalisierende Gangsterbanden. Pistoleros, die schneller mit der Waffe waren als mit dem Mundwerk. Der redegewandte Castro lavierte zwischen den beiden Banden hin und her, nicht bereit, sich einem der Lager zu verschreiben. Als er bei den Wahlen für die Präsidentschaft des Studentenverbandes gegen den Regierungskandidaten antrat, zog dies den Zorn der Gangster auf sich. Unmissverständlich machten sie ihm klar, dass er, da er ja partout den Mund nicht halten wolle, von der Universität verschwinden müsse. Andernfalls mache er schmerzhafte Bekanntschaft mit ihren Schlägern.
„Die Mafia dominierte die Universität. Ich hatte es mit allen Mächten zu tun […] Sie waren bewaffnet und bereit mich zu töten. Sie besaßen die Unterstützung der Polizei und der korrupten Regierung Grau. Sie setzten es durch, dass ich die Universität nicht mehr betreten durfte. Der Augenblick der Entscheidung war gekommen. Der Konflikt traf mich mit der Wucht eines Orkans. Allein am Strand, vor mir nur das Meer, dachte ich über meine Lage nach. Ich weinte bitterlich. Ich lief Gefahr […] getötet zu werden. Es war Tollkühnheit […] an die Universität zurückzukehren. Aber wenn ich nicht ginge, dann würde das bedeuten, mich den Drohungen zu beugen, vor den brutalen Kerlen zu kapitulieren und meine eigenen Ziele und Ideale aufzugeben. Ich entschloss mich zurückzukehren, und ich kehrte zurück ... mit der Waffe in der Hand“68, erinnert sich Fidel Castro. Die Pistole, eine Browning, besorgte ihm ein Freund. Er ließ sich nicht vom Campus vertreiben, doch betrat er ihn nur noch in Begleitung seiner Freunde, die auch zugleich seine Leibwächter waren. Rückblickend empfand Castro die Jahre an der Universität übrigens noch viel gefährlicher als jene des Kampfes gegen die Batista-Diktatur in der Sierra Maestra Ende der Fünfzigerjahre. „Ich war der Don Quijote der Universität, immer Pistolen und Kugeln um mich herum. Was ich an der Universität aushalten musste, wiegt schwerer als die Zeit in der Sierra Maestra.“69
In einem solchen von Gewalt und Terror beherrschten Umfeld war für Demokratie kein Platz. Es war die archaische Macht des Stärkeren, mit der man sich entweder zu behaupten wusste - oder unterging. Auch Fidel Castro sah sich gerne als Mann der Tat. Statt sich seinem Studium zu widmen, ließ er sich 1947 von der karibischen Legion als Söldner anheuern, in deren Stab angeblich auch der auf Kuba lebende Schriftsteller Ernest Hemingway gewesen sein soll. Ihr ambitioniertes Ziel: gleich zwei Diktatoren zu stürzen. Und zwar den Nicaraguas, General Somoza70, und jenen der Dominikanischen Republik, General Trujillo71, gleich mit. Über Somoza hatte sich auch der ehemalige amerikanische Botschafter auf Kuba, Sumner Welles, bei Präsident Franklin D. Roosevelt entsetzt ausgelassen:
„Somoza ist doch ein Hurensohn!“
Roosevelt antwortete kurz:
„Aber er ist unser Hurensohn!“72
Eine wahrhaft treffende Aussage über den Opportunismus der amerikanischen Außenpolitik, die aus lauter Angst vor Radikalisierung lieber Tyrannen unterstützte.

Der 32. US-amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt (1882-1945) Quelle: U.S. National Archives and Records Administration
Nach zwei Monaten Guerillatraining starteten die Abenteurer der karibischen Legion auf einem Boot Richtung Dominikanische Republik. Doch die Aktion scheiterte, das Boot wurde vor der Nordostküste Kubas von der kubanischen Marine geentert. Castro gelang in letzter Minute der rettende Sprung von Bord – mit einem gestohlenen Rettungsboot schaffte er es bis kurz vor die Küste. Doch dann musste er die restlichen 300 Meter vollends durch die Bucht von Nipe schwimmen, in der es vor gefährlichen Bullenhaien und angriffslustigen Barrakudas nur so wimmelte.