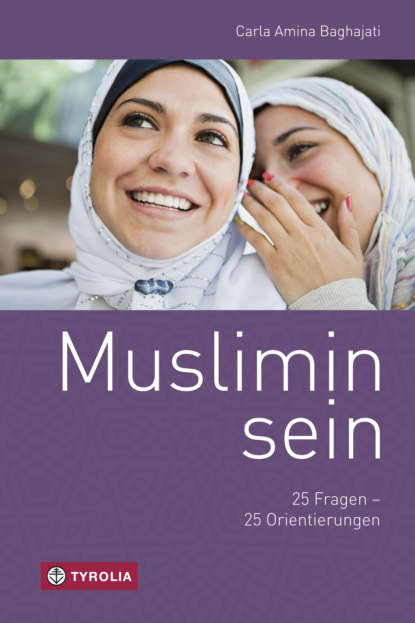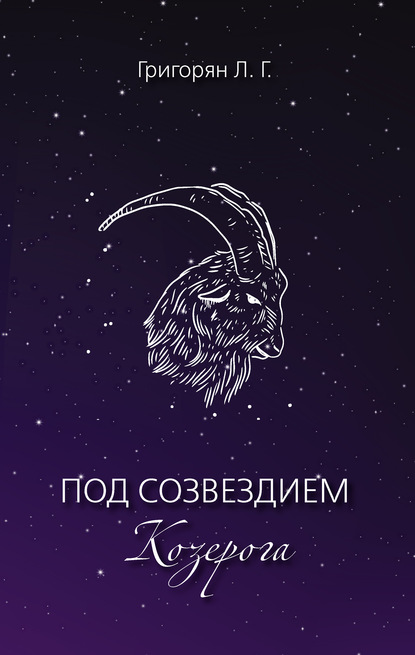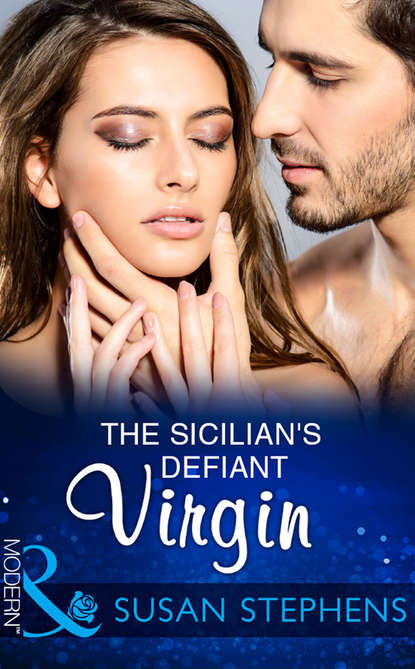- -
- 100%
- +
Der „Rippenhadith“ liegt in sechs ähnlich lautenden Versionen vor, wobei hier jene nach Bukhari zitiert sei: „Die Frauen wurden aus einer Rippe geschaffen, und das am stärksten gebogene Teil einer Rippe ist das obere. Wenn du versuchst, sie gerade zu biegen, wirst du sie zerbrechen. Überlässt du sie aber sich selbst, dann bleibt sie gekrümmt“.18 Nicht nur steht der erste Teil in einem klaren Widerspruch zur koranischen Aussage, dass Mann und Frau aus der gleichen Ursubstanz geschaffen seien. Der zweite Teil liest sich ausgesprochen misogyn. Die Wertung einer Frau als „krummes Wesen“, das jeder Erziehung widerstehe und zum Krummsein verurteilt sei, steht vielleicht in noch eklatanterem Widerspruch zu Aussagen im Koran und einem darin verankerten egalitären Geschlechterbild. Auch das Verhalten des Propheten Muhammad passt nicht zu einer derartig frauenfeindlichen Aussage. Er steht für einen respektvollen Umgang mit Frauen; keinesfalls bezeichnete er sie intellektuell als minderbemittelt. Im Übrigen lassen sich auch im Hadith selbst Aussagen finden, die mit dem Bild der „verbogenen Rippe“ nicht zusammenpassen. So heißt es in einer Überlieferung nach Aisha etwa, Mann und Frauen seien Zwillingswesen.19 Diese Kritik setzt am matn, am Inhalt des Hadith, an, der kontradiktorisch zum Koran ist – eine Methode, die, wie bereits aufgezeigt wurde, nicht von allen Muslimen gleichermaßen unbefangen angewendet würde.
So soll auch der Ansatz vom isnad, der Überlieferungskette, her versucht werden. Alle Versionen des „Rippenhadith“ gehen auf den Gleichen Tradenten Abu Hurairah zurück. Andere Personen, die das gleiche berichten, gibt es nicht. Abu Hurairah wurde bereits zu Lebzeiten trotz seiner großen Hingebung zum Propheten auch kritisch gesehen. An seinem Lebenswandel gefiel zum Beispiel nicht, dass er es ausschlug, eine Arbeit anzunehmen. Aisha, eine Gattin des Propheten, auf die viele Hadithe zurückgehen, reagierte sehr ungehalten, wenn er den Propheten in einer Weise zitierte, die offensichtlich nicht stimmen konnte. Oft ging es dabei um Themen, die Frauen betrafen, wobei Abu Hurairah angeblich an mangelndem männlichen Selbstwertgefühl litt und entsprechend zu einer gewissen Frauenfeindlichkeit neigte.20 Der große Gelehrte und Begründer der hanefitischen Auslegungstradition, Abu Hanifah, war darum vorsichtig bei der Heranziehung von Hadithen dieses Tradenten. Es soll auch nicht verschwiegen werden, dass bis in die Moderne ganze Bücher zur Verteidigung beziehungsweise Diskreditierung von Abu Hurairah geschrieben wurden, auch weil sich daran zusätzlich Trennlinien (schiitische contra, sunnitische eher pro) auftun. In diesem Fall wird es nicht leichter, zumindest was die „Fans“ von Abu Hurairah betrifft, den isnad, die Herkunft der Überlieferung, in Zweifel zu ziehen.
So bleibt für die nicht kleine Gruppe jener Muslime, die bei diesem Hadith den isnad nicht in Frage stellen und am matn nicht rühren wollen, nur die Möglichkeit, eine verträgliche Interpretation zu finden, die ihm seinen frauenfeindlichen Stachel zieht. An solchen Bemühungen haben vor allem jene Muslime großes Interesse, für die die klassischen Hadithsammlungen, etwa von Bukhari oder Muslim, einen Textkanon bilden, den sie prinzipiell nicht in Frage stellen würden. Dazu gibt es viele, sehr kreative Versuche. Er wird etwa als Beweis betrachtet, dass der Mann zur Rücksichtnahme gegenüber einer Frau verpflichtet sei und ihre spezielle Natur achten müsse. Ähnlich wie christliche Auslegungen weisen sie auch auf die damit gegebene Verbundenheit von Mann und Frau hin. Manche führen den Gedanken weiter und sagen, dass diese Rippe über dem Herzen liege und so auf die besondere emotionale Natur der Frau hinweise. Oft erfolgt aber gleichzeitig eine Essentialisierung weiblicher Eigenschaften in Richtung „gefühlsbetonte Frau“ gegenüber „verstandesorientierter Mann“. Es ist fragwürdig, wenn Frauen ein unveränderliches Wesen auf diese Weise zugeschrieben wird.
Wer sich an das Prinzip hält, dass koranische Aussagen die oberste Quelle in der Auslegung bilden, wird durch zahlreiche weitere Aussagen im Koran darin bestärkt, dass Frauenfeindlichkeit, ja nur ein patriarchalischer, bevormundender Ton, keinen Platz im Islam haben darf. „Siehe, ich lasse nicht verloren gehen das Werk des Wirkenden unter euch, sei es Mann oder Frau, die Einen von euch sind von den Anderen“21 dokumentiert einmal mehr, wie Mann und Frau nicht ohne einander bestehen können. Ihr Handeln zum Guten wird gleichermaßen gewürdigt und dafür eine Belohnung im Jenseits versprochen. Diese Verheißung kommt im Koran mehrfach vor, so auch hier: „Wer aber Rechtes tut, sei es Mann oder Frau, und er ist gläubig – jene sollen eingehen ins Paradies und sollen nicht um ein Keimgrübchen im Dattelkern Unrecht erleiden.“22 Bemerkenswert ist hier, dass beide Geschlechter dezidiert angesprochen werden, anstatt dass einfach ein Plural verwendet wird, bei dem die Frauen mitgedacht sind. Rechtes zu tun schließt die Bereitschaft und das Vermögen ein, Verantwortung zu übernehmen, und vor allem die Fähigkeit, sich mündig ein eigenes Urteil zu bilden. Männer können also nicht für sich in Anspruch nehmen, Frauen die eigene Entscheidung über ihr Handeln einfach abzunehmen. Dieser Punkt ist darum so wichtig, weil sich in vielen Traditionen Vorstellungen gehalten haben, Männer müssten das letzte Wort haben. Der Koran weist dies zurück: „O ihr Menschen, Wir haben euch von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen, und Wir haben euch zu Verbänden und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Der Edelste (Angesehenste) von euch bei Gott, das ist der Gottesfürchtigste (Gerechteste) von euch. Gott weiß Bescheid und hat Kenntnis von allem.“23 Kriterium für das Ansehen bei Gott ist also, wie sich der und die Einzelne im Leben bewährt. Die Vielfalt der Geschlechter wie der Ethnien und religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen ist gottgewollt und soll den Austausch untereinander befruchten. Mann und Frau sollen als Partnerwesen agieren.
Vor Gott sind Mann und Frau absolut gleichwertig. Auf diesem Fundament lässt sich ein Geschlechterverhältnis aufbauen, das von einem Umgang miteinander als ebenbürtige Partner getragen ist. Dieser Anspruch muss immer dann in Erinnerung gerufen werden, wenn das soziale Gefüge ein Ungleichgewicht zu Ungunsten der Frauen aufweist. Vor allem erscheinen Mann und Frau als Partner in ihrem Menschsein. Die Kategorie „Mensch“ verbindet Mann und Frau und legt ihnen gleichzeitig die gleiche Verantwortlichkeit nahe.
2. Gibt es Unterschiede in der religiösen Praxis zwischen Männern und Frauen?
Vor Gott sind Mann und Frau völlig gleichwertig. Demnach tragen sie auch die gleiche religiöse Verantwortung. Besonders deutlich tritt dies in folgendem Vers zutage: „Wahrlich, alle Männer und Frauen, die sich Gott ergeben haben, und alle gläubigen Männer und gläubigen Frauen und alle wahrhaft demütig ergebenen Männer und wahrhaft demütig ergebenen Frauen und alle Männer und Frauen, die ihrem Wort treu sind, und alle Männer und Frauen, die geduldig in Widrigkeit sind, und alle Männer und Frauen, die sich (vor Gott) demütigen, und alle Männer und Frauen, die aus Mildtätigkeit geben, und alle selbstverleugnenden Männer und selbstverleugnenden Frauen, und alle Männer und Frauen, die auf ihre Keuschheit achten, und alle Männer und Frauen, die unaufhörlich Gottes gedenken: Für (alle von) ihnen hat Gott Vergebung der Sünden und eine mächtige Belohnung bereitet.“24
Auffällig ist hier die durchgehende sprachliche Einbeziehung der Frauen, die geradezu an moderne, geschlechtergerecht formulierte Texte erinnert: „inna l-muslimīna wa-l-muslimāti“. Der Beginn wäre auch ohne Übertragung verständlich, werden hier doch die Muslime und Musliminnen direkt angesprochen. Er fungiert wie eine Art Überschrift, danach werden wesentliche Bereiche, die eine muslimische Identität ausmachen, konkret ausgeführt. Muhammad Asad überträgt statt „Muslime und Musliminnen“ mit „alle Männer und Frauen, die sich Gott ergeben haben“ und verwendet somit eine verbreitete Definition der Anhänger des Islams. Damit spielt er auch darauf an, was das Konzept des Muslimisch-Seins ausmacht: die starke Verschränkung von Glauben mit Handeln. Wer den Islam angenommen hat, also ein gottergebenes Leben führen möchte, der wird durch die von Gott im Koran und durch das Vorbild des Propheten Muhammad veranschaulichten gottesdienstlichen Übungen merken, dass das Ziel des Friedens in Gott eng verknüpft ist mit der Anstrengung, in Einklang mit den Mitmenschen und der Umwelt zu leben.
Gottesdienst ist nach muslimischer Vorstellung immer auch Menschendienst. Dieser Aspekt der Orthopraxie zeigt sich in der Verschränkung gottesdienstlicher mit sozialen Aufgaben. Mann und Frau tragen hier die gleiche Verantwortlichkeit in der Gesellschaft. Beiden wird schließlich die gleiche Erfüllung verheißen: Vergebung der Sünden und „eine mächtige Belohnung“, was auf die Vorstellung des Paradieses verweist.
Eine Art Tugendkatalog wird präsentiert, der gleichermaßen Männer und Frauen betrifft. An den Einen, Einzigen und Einzigartigen Gott zu glauben ist untrennbar verknüpft mit sozialen Aspekten. Aus „Mildtätigkeit geben“ wird in anderen Koranübertragungen auch mit „Almosen spendend“25 wiedergegeben. An Bedürftige vom eigenen Vermögen freigiebig abzugeben ist ein zentraler Bestandteil der muslimischen Glaubenspraxis. Unterschieden werden dabei sadaqa, das Almosen, und zakat, die sozial-religiöse Pflichtabgabe. Diese Pflicht bildet die dritte der so genannten fünf Säulen: Einmal im Jahr müssen 2,5 % des stehenden Vermögens an Bedürftige verteilt werden. Im Begriff zakat steckt das Wort „Reinigung“. So soll das persönliche Vermögen von jenem Teil gereinigt werden, der dem Gläubigen islamisch betrachtet gar nicht gehört, weil im Sinne der Umverteilung Bedürftige darauf Anspruch haben. Soziale Gerechtigkeit soll erreicht werden. Diese Pflicht wird so ernst genommen, dass theologisch betrachtet das Einbehalten dieser 2,5 % Diebstahl bedeutet.
Eine weitere Säule der Religion wird mit der oben angesprochenen Selbstverleugnung thematisiert. Auch hier übertragen andere oft konkreter mit „die fastenden Männer und die fastenden Frauen“ und stellen damit direkt den Zusammenhang mit dem Fastenmonat Ramadan her. Auch in diesem Gottesdienst liegt eine starke soziale Komponente, denn wer am eigenen Leibe verspürt, dass Essen und Trinken keine Selbstverständlichkeit darstellen, kann eher Empathie mit jenen entwickeln, für die sauberes Trinkwasser und sich satt zu essen puren Luxus darstellen. Tätige Solidarität zu erreichen ist so ein wichtiger Gesichtspunkt für die Fastenden.
Muhammad Asads Übertragung hat aber den Vorzug, hinter den religiösen Pflichten, wie zakat und Fasten im Ramadan, liegende erwünschte Charaktereigenschaften gläubiger Muslime stärker herauszuarbeiten. Muslimen leuchtet der Zusammenhang ohnehin sofort ein. Übergeordnete Begriffe wie eben „Mildtätigkeit“ und „Selbstverleugnung“ weisen auf eine allgemeine Haltung oder Gesinnung hin, die dem Erfüllen religiöser Pflichten zugrunde liegen sollen. Dies wiederum ist aufschlussreich für die Geschlechterfrage. Nicht nur tragen Mann und Frau die gleichen religiösen Pflichten. Hier sind auch die anderen Säulen der Religion zu ergänzen, nämlich das fünfmalige rituelle Gebet und die Pilgerfahrt nach Mekka, die jeder und jede Gläubige einmal im Leben bei ausreichenden finanziellen Möglichkeiten und Gesundheit vollziehen sollte. Mehr noch sollen sie sich bemühen, die gleichen positiven Charaktereigenschaften bei sich zu entwickeln.
Wer auch immer spezifisch männliche oder spezifisch weibliche Tugenden konstruieren wollte, wird diese Koranstelle dazu nicht zitieren können. Dezidiert werden beide Geschlechter angesprochen, sowohl, was die Erfüllung religiöser Pflichten betrifft, als auch, welche Tugenden dahinter stehen sollen. Essentialistischen Geschlechterzuschreibungen, wie sie in vielen Kulturen – auch den muslimischen – verbreitet sind, läuft dieser Koranvers zuwider. Da gibt es nicht die per se „soziale Frau“ und den per se „mutigen Mann“ – sowohl die Verantwortung für das Allgemeinwohl als auch das Einstehen für die eigene Haltung („die ihrem Wort treu sind“) werden beiden Geschlechtern gleichermaßen zugesprochen.
Schülerinnen reagieren im Religionsunterricht besonders stark darauf, wie das Attribut der Keuschheit sowohl bei Männern als auch bei Frauen betont wird – wenn sie erst einmal bedacht haben, was dieses scheinbar altmodische und daher bei den Jungen unverständliche Wort meint. Denn aus dem Alltag kennen sie oft den gesellschaftlichen Umgang bei vorehelichen Erfahrungen mit dem jeweils anderen Geschlecht, der starke Unterschiede zwischen dem macht, was ein junger Mann sich erlauben kann und was bei einem Mädchen zulässig erscheint. Solche Brüche offen anzusprechen und zu diskutieren, gelingt auf Basis des zitierten Verses sehr gut.
Fatima Mernissi bezeichnet die Koranstelle 33:35 als „revolutionär“26. Sie ist eine der Autorinnen, die den Trend mitgeprägt haben, eine weibliche Sicht auf die islamischen Quellentexte einzufordern. Gerade angesichts immer noch bestehender, Frauen häufig einengender Rollenbilder ist diese revolutionäre Kraft nicht nur in der Zeit der Offenbarung zu suchen, sondern gilt auch für heute. Eine Brücke in die Vergangenheit zu schlagen lohnt sich dabei dennoch, denn die Geschichte der Niedersendung dieses Verses ist für die Interpretation bedeutend. Der tafsir, die Exegese des Korans, greift gerne auf die Umstände der Offenbarung zurück. Als asbab an-nuzul liegt hier eine wichtige Methode der islamischen Gelehrten vor.
Bei Tabari findet sich die aufschlussreiche Erzählung, wie Umm Salamah, eine Gattin des Propheten, diesen fragte: „Weshalb werden die Männer im Koran angesprochen und warum wir nicht?“ Auf eine Antwort musste sie ein wenig warten, doch dann kam sie in der stärksten vorstellbaren Form, nämlich als göttliche Offenbarung. Umm Salamah hörte begeistert zu, als der Prophet den Vers von der Kanzel der Moschee verkündete. Damit war klargestellt, dass Männer und Frauen als Menschen und Geschöpfe Gottes die gleichen religiösen Aufgaben teilen und sich dabei der gleichen charakterlichen Stärken bedienen sollen. Beiden wird dabei der gleiche Lohn, das gleiche Heil, verheißen.
Dieser prinzipielle Zugang soll nicht überdeckt werden, indem bei der Fragestellung nach der religiösen Praxis Erleichterungen für die Frau, die ihr wegen gewisser körperlicher Besonderheiten (Menstruation, Schwangerschaft, Geburt) zustehen, als große Unterschiede präsentiert werden. Zahlreiche „Handbücher der muslimischen Frau“ mögen zwar nützliche Informationen zu frauenspezifischen Themen und speziell zur religiösen Praxis (Fasten, Gebet) während der genannten Phasen bieten. Sie suggerieren aber auch, dass Frauen prinzipiell anders in ihrem Muslimisch-Sein als Männer seien. Damit propagieren sie indirekt auch ein Konzept der Geschlechtertrennung, wie es muslimische Kulturen mehr oder weniger stark entwickelt haben. Diese Art Bücher hat eine lange Tradition in der muslimischen Welt und geht zurück bis auf Ibn Al Djauzis „Buch der Weisungen für Frauen“ aus dem 12. Jahrhundert, das durch seine Rezeptionsgeschichte bis heute einen starken Einfluss hat und von salafitischen Kreisen gerne weiterverbreitet wird. Die Auswahl der als für Frauen besonders relevant angesehenen Informationen ist kritisch zu hinterfragen, wird doch damit auch eine Rollenzuschreibung verbunden. In der Selektion von Quellentexten aus Koran und Sunna verbirgt sich so durchaus auch die Sicht eines in einer patriarchalen Gesellschaft lebenden Mannes, der ein Interesse daran haben wird, die Rolle der Frau als fromme und ihrem Mann treu ergebene Hausfrau und Mutter seiner Kinder zu zeichnen.
Unterschiede, die als Erleichterung für Frauen zu sehen sind, bergen in sich die Gefahr, aus männlicher Sicht so umgedeutet zu werden, dass sie für Frauen in Restriktionen enden. Ein besonders anschauliches Beispiel dafür ist die Präsenz von Frauen in der Moschee. Anders als in den Anfangszeiten, als Frauen im gleichen Raum wie die Männer ohne jegliche Barriere zwischen den beiden Geschlechtern beteten und Anteil am Gemeindeleben hatten, ging ihre Präsenz später verloren. Anders als Männer sind Frauen nicht verpflichtet am Freitagsgebet teilzunehmen. Dies gilt als Erleichterung, die ihnen entgegenkommen soll, wenn sie etwa kleine Kinder haben. Diese Erleichterung wurde aber offensichtlich schnell dahingehend verdreht, dass eine Frau gar nicht in die Moschee kommen solle. Wenn man das zuvor erwähnte Buch von Ibn Al Djauzi in seiner Zusammenstellung von Aussagen betrachtet, die davon sprechen, der beste Ort für eine Frau sei ihr Haus, so wird klar, wie es zu dieser Entwicklung kommen konnte. Immer mehr wurden Frauen als potentielle „Unruhestifterinnen“ wegen der von ihnen möglicherweise ausgehenden Anziehung gesehen, die daher besser zu Hause bleiben sollten. Schon im vorausgehenden Kapitel wurde behandelt, wie wichtig es ist, die Idee von der „verführerischen Versucherin“ (Rippenhadith) zurückzuweisen. Schon darin liegt eine Wurzel für Konzepte strikter Geschlechtertrennung, die bei einer anderen Interpretation nie ihre angebliche religiöse Grundlage gefunden hätte. Bei Ibn Al Djauzi werden eine Vielzahl von Hadithen zitiert, die in diese Richtung gehen, etwa: „Die beste Moschee für Frauen ist der Boden ihrer Häuser.“27 Dagegen ist ein Hadith, der ausdrücklich den Moscheebesuch nahelegt, gar nicht enthalten: „Hindert die Dienerin Allahs nicht am Gang zur Moschee Allahs.“28 Von Umar, einem der engsten Prophetengefährten und späteren zweiten Kalif, ist überliefert, dass er in Streit mit seinem Sohn geriet, weil dieser den Frauen seines Hauses den Moscheebesuch untersagte. Er war darüber so ungehalten, dass er den Sohn gar nicht mehr treffen wollte.
Heute haben sich die Frauen die Moschee als Raum wieder ein Stück zurückgewonnen. In Österreich werden die Räumlichkeiten gerne auch außerhalb der Gebetszeiten von Frauen genutzt, die sich etwa für Deutschkurse treffen. Auch Koranlesegruppen von Frauen sind beliebt. Je nach Örtlichkeit sind Frauen auch beim Freitagsgebet mehr oder weniger vertreten. In den engen Hinterhofmoscheen ist oft so wenig Platz, dass es für die Frauen unter diesen Umständen schnell heißt, dass sie ja nicht verpflichtet seien und daher den Männern den Vortritt lassen sollten. Größere Moscheen berücksichtigen beim Bau beziehungsweise der Adaptierung von vornherein, dass es ansprechende Frauenbereiche gibt, oft als Empore. International hat sich in den letzten Jahren ein Trend entwickelt, dass Frauen auch für die speziellen Gebete im Ramadan nach dem Nachtgebet die Moschee aufsuchen.
Vor diesem Hintergrund ist die Frage nach Unterschieden in der religiösen Praxis zwischen Mann und Frau auch für die innermuslimische Debatte um Geschlechtergerechtigkeit von Bedeutung. So wie sich in der Frage der Präsenz in der Moschee vieles zum Besseren wendet, so gilt es auch in anderen Bereichen dafür aufmerksam zu sein, dass Erleichterungen selbstverständlich bestehen, aber nicht in bevormundende Beschränkungen umgemünzt werden dürfen. Diese müssen erkannt und abgebaut werden.
3. Wie kann ich mich Gott weiter nahe fühlen, auch wenn ich während der Periode nicht bete und faste?
Vor allem Frauen, die zum Islam konvertiert sind, tun sich oft schwer damit, dass sie während der Zeit ihrer Monatsblutung von einigen religiösen Übungen befreit sind: Das rituelle Gebet, fünfmal über den Tag verteilt, und das Fasten im Ramadan sind hier vor allem zu nennen. So ganz fremd ist ihnen die Anschauung ja nicht, dass Frauen in dieser Zeit irgendwie „anders“ seien. Noch die Großmutter vermied, in diesen Tagen Marmelade einzukochen. Auch in Europa herrschte lange Zeit die Vorstellung, Frauen seien während der Menstruation „unrein“ und man halte sich besser von ihnen fern. Feministinnen wie Germaine Greer begannen bewusst, zu Beginn der 1970er-Jahre Tabus um die Menstruation der Frau aktionistisch aufzubrechen. Bis heute scheint diese Auseinandersetzung noch nicht abgeschlossen. Publikationen wie Chella Quints „Adventures in Menstruating“ oder Chris Bobels „New Blood – Third-Wave Feminism and the Politics of Menstruation“ liefern weiterhin Diskussionsstoff. Wegzukommen von strikten Zuschreibungen, was „Frau“ sei, und gleichzeitig die eigene Körperlichkeit in all ihren Aspekten aus weiblicher Sicht offen zu besprechen und zu ihr zu stehen, bleibt ein Anliegen.
Sichtweisen auf die Regelblutung sind auch bei Muslimen nicht frei von Zuschreibungen, die darin gerne die These von der angeblich gefühlsbewegten und sprunghaften weiblichen Veranlagung begründet sehen wollen. Dies kann negative Folgen für Frauen haben, wenn mit dieser Begründung ihre gesellschaftliche Teilhabe eingeschränkt werden soll, wie dies im Kapitel über die Zeugenschaft noch erörtert werden soll.
Die Menstruation wird im Koran nur einmal erwähnt. Da heißt es: „Und sie werden dich fragen nach den monatlichen Perioden (der Frauen). Sag: ‚Es ist ein verletzlicher Zustand.‘“29 Dies ist eine der Stellen, in denen Gott sich direkt an den Propheten wendet („Sie werden dich fragen“) und ihm aufträgt, wie er mit den Fragen der muslimischen Urgemeinde nach der Regelblutung umgehen soll. Interessant ist hier schon einmal, dass damit dokumentiert ist, wie wenig sich die frühen Muslime scheuten, auch den Bereich der Sexualität offen anzusprechen. Im Verlauf des Verses geht es dann auch darum, dass Geschlechtsverkehr in der Zeit der Menstruation aus Rücksicht auf die Frau religiös verboten ist. Tabus im Gespräch über natürliche körperliche Vorgänge und Bedürfnisse bestanden nicht. Diese Einstellung, über derlei Dinge offen reden zu können, wird uns immer wieder begegnen, etwa wenn wir diesen Vers im Kapitel über Sexualität noch einmal aufgreifen – dies steht in einem bemerkenswerten Kontrast zu manchen kulturell geprägten Erscheinungen von falsch verstandener Schamhaftigkeit und daraus resultierender Sprachlosigkeit.
Muhammad Asad, dessen Koranübertragung oben zitiert wurde, hat sich offensichtlich bemüht einen möglichst neutralen Ausdruck für das arabische ’aḏan zu finden, der frei ist von einem Ton, der Frauen während ihrer Monatsblutung als irgendwie „eingeschränkt“ oder gar „geschädigt“ sieht. Ihm war wohl bewusst, dass jeder Beigeschmack einer Art Abwertung der Frau während ihrer Regelblutung genau jene Projektionsfläche bietet, die dann zu gar nicht einmal böse gemeinten Interpretationen führt, nach denen Frauen eben nicht die gleichen Aufgaben zuzutrauen seien wie Männern. Wer sich hier an die Rede von den Frauen als dem „schwachen Geschlecht“ erinnert fühlt, spürt auf, wie kulturübergreifend männliche Zuschreibungen über die Frau sein können.
Asads Koranübertragung ins Deutsche hebt sich damit wohltuend von den meisten anderen ab. Khoury, Bubenheim und Rassoul übertragen die Beschreibung der Menstruation im Koran mit „Leiden“, Azhar und Ahmedeyya mit „Schaden“, Paret mit „Plage“, Pickthall mit „Krankheit“ (illness). Zaidan spricht dagegen nur von einer „Beschwerlichkeit“, während Ali F. Yavuz gar den Ausdruck „eine verhasste Unreinheit“ (nefret edilen bir pislik) verwendet und damit eine emotionale Wertigkeit ins Spiel bringt, von der es nicht weit ist zu Minderwertigkeitsgefühlen einer Frau während ihrer Periode als einer zumindest temporär „Unreinen“.
Die Liste dieser Übertragungsvarianten ist einer Internetseite entnommen, die der Bewegung der Koranisten (quraniyun) zuzurechnen ist.30 Diese aus der Türkei stammende Bewegung beruft sich ausschließlich auf den Koran und wirft die Prophetenüberlieferung komplett über Bord. Daher vertritt sie hier auch den Standpunkt, Frauen könnten während ihrer Regel fasten und beten wie sonst auch – schließlich stehe im Koran nichts Gegenteiliges. Ganz so einfach kann man sich die Sache dann doch nicht machen. Denn über die Sunna, also das in vielen Hadithen beschriebene Vorbild des Propheten Muhammad, können Gläubige nicht hinweggehen – schließlich spricht der Koran selbst mehrfach davon, dass das Beispiel des Propheten zu berücksichtigen sei.31 Er gilt als „der lebende Koran“32, weil er diesen durch sein Vorbild in die Glaubenspraxis übersetzte. Die Koranisten übertreiben ihre Kritik am Hadith bis zur totalen Zurückweisung. Auch wenn hier durchaus kritische Betrachtungen angebracht sind – etwa zur Authentizität oder zum historischen Hintergrund, wann sich jemand an diese oder jene Aussage erinnerte – könnten ohne die Sunna viele praktische Fragen gar nicht beantwortet werden. Auch in Frauenfragen ist die Sunna eine wichtige Quelle.