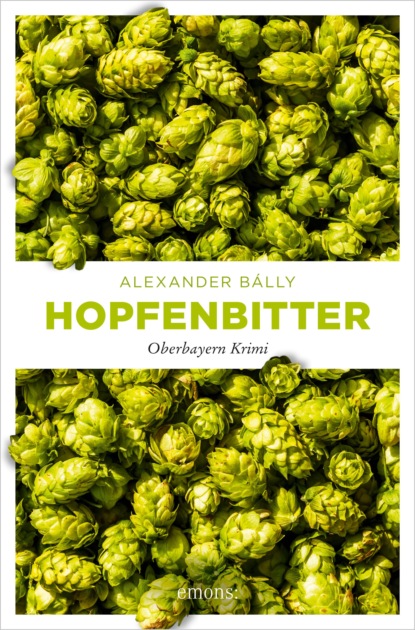- -
- 100%
- +
Jahrzehntelang hatten die materiellen Reste des Detektivspielens in einer Blechdose auf dem Speicher geruht. Erst als vor ein paar Jahren unversehens ein Toter am Maibaum gebaumelt und dieser Mord die Marktgemeinde erschüttert hatte, hatte Wimmer wieder Lust auf das Detektivspielen bekommen. Eigentlich hatte er sich nur ein wenig umhören und der Polizei helfen wollen. Dieses Umhören hatte jedoch bald eine gewisse Eigendynamik entwickelt, und ehe er sich versehen hatte, hatte er zusammen mit Anna »Scherlock Pinkerton & Co – Wolnzach« wieder zum Leben erweckt. Am Ende hatten sie sogar noch vor der Polizei den Mörder ermittelt.
Anna hatte sich für ihn bei inzwischen vier Mordermittlungen als sehr nützliche Assistentin erwiesen. Wimmer war bauernschlau, geduldig und einfallsreich, doch auf einem Gebiet war der alte Metzger beinahe unbeleckt – Computer. Anna dagegen war ein Kind des digitalen Zeitalters. Inzwischen betreute die Fünfzehnjährige für ihre Mutter die Website der Metzgerei und hatte ihr vor ein paar Wochen den kleinen feinen Webshop »Oma Wimmers Wurstspezialitäten im Glas« eingerichtet.
Für ihren Opa recherchierte sie als Assistenzdetektivin im Netz und fand dort Informationen, von denen Wimmer nie geahnt hatte, dass man sie überhaupt suchen konnte. Doch auch Anna konnte erfolgreich den lokalen Klatsch ablauschen, besonders natürlich bei Schülern und jungen Leuten. Da sie ähnlich scharfsinnig war wie ihr Opa, bildeten sie ein glänzendes Team.
Doch das wusste so gut wie niemand. Sie erwähnten nie ihr Detektiv-Dasein nach außen. Anna und ihr Opa waren einfach nur Leute wie andere auch: ortsbekannt, vertrauenswürdig und a bisserl neugierig. Dass sie dabei sehr zielgerichtet neugierig waren und im kriminalistischen Sinne auch höchst erfolgreich, behielten sie für sich.
Doch nun hatte ein Herr Dirk Biss angerufen und nach dem Privatdetektiv Wimmer gefragt. Der alte Metzger fand das sehr merkwürdig. Diese nebulöse Bitte um kollegiale Hilfe hielt ihn lange wach.
Auch Karola trieb der Anruf lange um. Sie fand ihn sehr beunruhigend. Wenn es nur um Wimmer gegangen wäre, hätte sie es noch hingenommen. Er war erwachsen und für sich selbst verantwortlich. Doch dass er Anna mit der Detektivspielerei angesteckt hatte, das machte ihr große Sorgen. Einmal war sie schon mit einer Pistole bedroht worden, und auch beim letzten Mal wäre sie beinahe in Lebensgefahr geraten. Natürlich hatte Wimmer alles getan, dies zu vermeiden. Es war nicht so, dass er unsinnige Risiken eingegangen wäre, doch das Jagen von Mördern war nun mal etwas, was schnell aus dem Ruder laufen konnte.
Und dann noch diese alte rote Motorradkombi. Da hatte sie sich sauber ausmanövrieren lassen. Die rote Kombi! Sie lächelte, als sie an die Touren dachte, die sie darin gemacht hatte. Und an die paar handverlesenen Burschen, die sie damals aus dem Leder pellen durften. Die Kombi war ihr Tor zur Freiheit gewesen. Aber Anna? Das waren doch seinerzeit ganz andere Zeiten gewesen. Das konnte man doch nicht vergleichen. Detektive und Motorräder! Ach, wieso konnte ihre kleine Familie nicht sein wie andere auch und normalen Hobbys nachgehen?
Anna schlief zwar, aber auch sie wälzte sich von einer Seite auf die andere. Im Traum hatte sich die rote Lederkombi verdreifacht. Als drei rote Lederschwestern standen sie da: Karola, Katharina und sie in der Mitte. Sie ließen sich von jungen Männern auf bulligen Motorrädern bewundern. Und dann kam einer, reichte ihr die Hand und bot ihr den Platz auf dem Soziussitz an. Er war unglaublich männlich, stark und kühn und trug die Züge von Sammi aus der zwölften Klasse. Seltsamerweise roch er aber wie das Rasierwasser von Opa.
2
19. September – Donnerstag
»Jetzt, Herr Biss, müssen S’ mir bitte erst mal erzählen, wie Sie auf mich gekommen sind. Dass i ab und zu als Detektiv arbeit – oder sagen wir lieber: a bisserl an Kriminalfällen herumstöber, des weiß eigentlich keiner. Es war immer inoffiziell. Es ist ja ned so, dass i Visitenkarterl verteilen daat.«
Wimmer saß auf seinem blauen Kanapee in seinem Zimmer unter dem Dach der Metzgerei. Seinen Gast hatte er in einen der beiden bequemen Lehnstühle gesetzt und musterte ihn nun. Sein Gegenüber war Ende vierzig, hatte einen deutlichen Bauchansatz, eine Halbglatze und dicke Tränensäcke. Er war unauffällig gekleidet – beige Bundfaltenhose, ein einst weißes, nun aber sehr, sehr hellgraues Polohemd und ein beiges Sakko. Alles in allem hätte er ein Beamter sein können oder ein Lehrer. Wenn man genauer hinsah, wirkte er ein wenig angeschmuddelt. Das an den Ellbogen ausgebeulte Jackett mit der vom Sitzen zerknautschten Rückseite hatte schon bessere Zeiten gesehen, die Schuhe waren abgeschabt, und auch das Polohemd hatte fadenscheinige Stellen am Kragen.
»Herr Wimmer, Sie unterschätzen wohl Ihre Mitbürger und deren Neugier. Ihre Heldentaten schweigen sich sozusagen herum. Man weiß, dass Sie an Verbrechen nicht nur interessiert sind, sondern schon mehrfach an der Lösung derselben beteiligt waren. Da gab es doch den toten Apotheker, den Sie entdeckt haben. Haben Sie da nicht auch den Täter identifiziert? Und die beiden Leichen in Eichstätt, auch das hat man nicht übersehen und ebenso wenig, wie Sie da der Polizei geholfen haben.«
»Und wer hat Ihnen den Tipp gegeben?«, wollte Wimmer wissen. »Wer genau?«
»Sagen wir so … Ich hab einen Freund aus früheren Tagen in der Polizeiinspektion Geisenfeld.«
Die Polizei … ja, die wusste natürlich von Wimmers privaten Ermittlungen oder von seinem »penetranten Herumgeschnüffel«, wie man es auch schon genannt hatte.
»Und Sie san also a Detektiv. A echter Privatdetektiv?« Wimmer lenkte das Gespräch zurück auf den Anlass.
»Genau! Eingetragenes Mitglied im Berufsverband der bayerischen Detektive.«
»Aha.« Wimmer zeigte sich weniger beeindruckt, als er es war. »Und Sie wünschen sich jetzt von mir ›kollegialen Beistand‹? Um was geht es denn überhaupt, und wie stellen Sie sich das vor?«
»Sie werden verstehen, dass ich nicht zu sehr ins Detail gehen kann. Diskretion gegenüber meinem Mandanten, ja? Aber so viel kann ich Ihnen sagen: Ich soll ein Haus finden. Er hat aber nur eine Fotografie und die Information ›Wolnzach‹.«
»A Haus sollen S’ finden? Warum? Ich mein, wieso will er denn dieses Haus finden? Wenn ich da am End an Einbruch vorzubereiten helf, dann …«
»Nein, es ist sicherlich nichts Illegales. Warum genau mein Mandant dieses Haus finden will, weiß ich nicht, aber es scheint ihm sehr wichtig zu sein. Aber schauen Sie, das Bild ist schon älter. Soweit ich weiß, ist es über fünfzig Jahre alt. Wolnzach hat sich verändert. Ich vermute, dass dieses Gebäude heute anders aussieht. Ich habe es nicht finden können. Aber mit Ihrer Hilfe … Ich meine, Sie kennen Wolnzach auch, wie es früher war und wie es sich entwickelt hat. Oder Sie kennen die richtigen Leut, die man fragen muss. Mit Ihnen habe ich eine echte Chance, das Haus zu finden. Ich biete Ihnen dreihundert Euro pro Tag.«
Wimmer zögerte.
»Das Geld gibt es erfolgsunabhängig! Ich bezahl Sie in jedem Fall, ob wir das Haus finden oder nicht.«
Wimmer seufzte und wollte gerade antworten.
»Und fünfhundert Euro extra, wenn wir es finden.«
»Herr Biss. Ich muss mir das erst noch überlegen. Ob ich Ihnen zusag oder nicht, hat dann aa nix mit der Bezahlung zu tun. Die ist schon in Ordnung. Kann ich Sie heut am Abend anrufen?«
Der Detektiv gab Wimmer seine Visitenkarte. Wimmer legte sie auf seinen Schreibtisch, dann brachte er den Besucher zur Tür.
»Bitte lassen Sie mich nicht im Stich. Ich zähle auf Ihre Hilfe«, meinte Biss beim Abschied, dann schloss Wimmer hinter ihm die Haustür. Nachdenklich kehrte er in sein Zimmer unter dem Dach zurück.
Gegen drei Uhr hörte Wimmer, wie Anna heimkam, die Haustür ins Schloss warf, einen Gruß in die Metzgerei rief und nach oben stürmte. Bevor sie in ihr Zimmer verschwinden konnte, das Wimmers schräg gegenüber lag, rief er zu ihr hinüber: »Hast du an Moment Zeit?«
»Naa. Und du aa ned.«
»Oha? Wieso? Brennt’s denn?«
»Ja, weißt es denn nimmer? Hast du ned gestern versprochen, mir machen heut an Ausflug mit der Maschin?«
Wimmer lächelte. Ganz so war es nicht gewesen. Doch immerhin hatte Anna ihm ein »Ja, des können wir schon machen« abgeschmeichelt, als sie es hartnäckig zum dritten Mal vorschlug. Er hatte noch die Worte »bei nächster Gelegenheit« im Ohr.
»Aber Anna, du hast ja noch gar keinen Helm ned!«, versuchte Wimmer, das Unvermeidliche noch einmal abzuwenden.
Woher Anna in weniger als einem Tag einen Helm gezaubert hatte, blieb ihr Geheimnis. Wimmer hatte den Kopf geschüttelt und sich umgezogen. Er hätte es wissen sollen, dass Anna den Begriff der »Gelegenheit« wie ein Winkeladvokat in ihrem Sinne auslegen würde. Andererseits … Besseres hatte er im Moment tatsächlich nicht vor, die Sonne tauchte alles in ein goldenes Licht, und die Luft war angenehm warm. Wimmer gab nach.
So verpackten sich Enkelin und Opa jeweils in ihren Zimmern in robustes Leder und stiegen eine Viertelstunde später auf die alte BMW R 50 S.
Auf Annas Wunsch rollten sie einmal der Länge nach und einmal quer durch den ganzen Ort, damit alle Anna bewundern konnten, dann aber fuhr Wimmer hinaus. Er steuerte das Motorrad vorsichtig und gemütlich auf Nebenstraßen und hielt nach zwanzig Minuten hinter Geisenhausen bei einem Bankerl, das im Schatten einer Eiche und einer Buche neben einem Feldkreuz stand.
»Lass uns amal a bisserl hersetzen«, lud Wimmer sie ein.
Der Platz für die Bank war gut gewählt. Sie stand, nach Osten blickend, hoch über einem kleinen Tal mit den inzwischen leeren Drahtgespinsten, an denen bis vor ein paar Wochen noch Hopfen gewachsen war. Auf der anderen Seite, schräg gegenüber, schwang sich auf einer langen, harmonischen Reihe von Rundbögen das Viadukt der Autobahn über das Tal, ein riesiger Tatzelwurm aus Stein.
»Motorradfahren ist ja Hammer!«, sprudelte es aus Anna heraus. Ein paar Minuten ließ Wimmer ihrer Begeisterung Zeit. Dann aber berichtete er ihr von der Begegnung mit Dirk Biss. Anna lauschte. Sie kannte ihren Opa gut genug, um auch das Ungesagte zu hören.
»Du magst den Mann nicht, richtig?«
»Ich kenn ihn doch kaum.«
»Ob man wen mag oder nicht, das weiß man doch schon nach weniger als einer Minute.«
»Also gut, Freunde werden wir sicher ned. Aber i hab aa nix gegen den Mann. Und er ist wohl a echter Profi. Des wär a Gelegenheit, noch was zu lernen.«
»Genau. Du könntest amal schau’n, wie er die Leut so ausfragt. Oder wo er seine Informationen findet. Er kann ja nicht immer seine Spezl bei der Polizei fragen. Opa, ich tät’s machen.«
»Und deine Mama?«
»Na ja. Ich halt mich da raus. Ich muss da ned auch noch mitfahr’n. Er hat ja dich eing’laden und nicht mich. Außerdem muss ich eh Französisch büffeln, da gibt es bald a Schulaufgabe. Wenn ich mich da raushalt – offiziell zumindest –, wird die Mama sich schon ned so aufregen. Und außerdem sucht ihr ja keinen Mörder, sondern nur a Haus, das irgendwer Gott weiß wann fotografiert hat. Das ist was ganz anderes wie a Mörderjagd und sicher ned so gefährlich.«
Karola protestierte tatsächlich kaum, als sie hörte, dass Anna dieses Mal nicht involviert sei, und als ihr klar wurde, dass es nur um ein altes Foto ging, lenkte sie unerwartet rasch ein. Dass Wimmer sich insgeheim als Ermittler bei den Leuten herumgesprochen hatte, fand sie einerseits sehr unpassend für »ordentliche G’schäftsleut«, andererseits kannte man ihn als »guten Detektiv« und empfahl ihn sogar einem Profi. Diese Kompetenz erkannte sie an und war – trotz aller Ablehnung – auch ein wenig stolz auf ihren Vater. Gegen sieben Uhr abends setzte sich Wimmer an seinen Schreibtisch und sagte Biss zu.
Vierundzwanzig Stunden später saß er auf seinem Kanapee und berichtete Anna von seinem Tag.
»Wie war es? Wie arbeitet ein richtiger Privatdetektiv? Hast du dir was abschauen können?«
»Na ja … anscheinend machen wir schon eine ganze Menge richtig.«
Biss hatte Wimmer am Vormittag abgeholt.
»Wo ham S’ denn Ihren Wagen?«, fragte Wimmer und sah sich um.
»Sie stehn davor«, antwortete Biss und ließ die Schlösser per Funk aufschnappen. Es war ein japanischer Mittelklassewagen, schon älter, eierschalenfarben und so wenig markant, dass erst ein Blick auf das Markenlogo mit seinen drei Rauten ihm verriet, dass es sich um einen Mitsubishi handelte. Die Enttäuschung stand Wimmer wohl ins Gesicht geschrieben, denn Biss fragte ihn, als sie losgefahren waren: »Sind Sie enttäuscht? Haben Sie was anderes erwartet? Ich fahre die Schüssel ganz gern. Sie ist wunderbar unauffällig.«
»Na ja. Ich denk da an Verfolgungsjagden. Da hab ich mir schon a bisserl was Sportlicheres vorg’stellt.«
»Was hätte Ihnen denn da vorgeschwebt? Ein Aston Martin wie der James Bond, ein roter Jaguar wie Jerry Cotton oder Thomas Magnums Ferrari? Das wären so ziemlich die letzten Autos, die ich wählen würde. Und nicht nur wegen der teuren Reparaturkosten. Was die Verfolgungsjagden angeht, da hatte ich bisher sowieso nie eine. Eher kommt es vor, dass ich jemanden beschatte, dann aber immer mit Abstand.« Biss lächelte. »Trotzdem hat das Auto eine Sonderausstattung.«
»Ach was?« In Wimmers Kopf spukten Ölsprühdüsen, Ortungsradar und Wendekennzeichen herum. Doch das war natürlich cineastischer Unsinn, der in der Realität kaum etwas verloren hatte. Aber was konnte es dann sein?
»Der Wagen hat eine Standheizung. Sehr angenehm, wenn man im Winter observieren muss. Da beschlagen die Scheiben nicht dauernd. Kann ich nur empfehlen.«
Biss kramte in einer Aktentasche und nahm eine großformatige Fotografie aus einer Mappe heraus.
»Das ist die Vergrößerung, dies hier ist das Original. Sie sehen, die Qualität ist bescheiden. Auch digital kann man da nichts mehr rausholen. Wo nichts ist, kann das beste Programm nix machen.«
Es war eine quadratische Schwarz-Weiß-Aufnahme, in der Mitte schärfer als am Rand und insgesamt sehr hell und kontrastarm.
»Erkennen Sie das Haus? Wissen Sie, wo das ist?«
Wimmer schüttelte den Kopf. Das Bild zeigte drei Frauen, die in die Kamera lachten. Sie standen vor einem Bauernhaus, wie es in der Gegend Hunderte gab: Die Eingangstür wies zum Hof, zwei Reihen Fenster, weiter hinten Stalltüren und alles unter einem regelmäßigen Ziegeldach. Wimmer sah genauer hin. Über der Eingangstür wich die Wand ein wenig zurück und schuf Raum für einen kleinen Balkon. Zwischen den Fenstern war eine kleine Nische mit einer Heiligenfigur. Es gab noch ein paar markante hohe Laubbäume im Hintergrund. Doch die waren leider kaum mehr erkennbar. Im Vordergrund sah er große Körbe aus Bast gestapelt, sogenannte Hopfakirn, in die man beim Hopfenzupfen die Dolden sammelte.
»Das Jahr kann i Ihnen ned sagen, aber die Aufnahme ist beim Hopfenzupfen entstanden, Ende August oder Anfang bis Mitte September«, erklärte Wimmer. »Sie suchen den Hof von einem Hopfenbauern.«
Biss nickte. »Das hat mir schon mein Mandant gesagt, aber schön, dass Sie es mir bestätigen. Das Bild entstand wohl Ende der fünfziger Jahre. Vermutlich mit einer Boxkamera. Da hab ich mich erkundigt.«
»Tut mir leid, den Hof erkenn i ned.«
»Das wäre ja auch zu schön gewesen, Herr Wimmer! Dann müssen wir halt suchen.«
Den Rest des Tages fuhren sie der Reihe nach die Höfe von allen Hopfenbauern ab, die Wimmer persönlich kannte und betrachteten im Vorüberfahren einige andere. Biss nannte es zähneknirschend eine »Geduldsaufgabe«. Doch nirgends sah es aus wie auf dem Bild.
27.8.1954
Nach einem raschen Frühstück auf dem Hof – Malzkaffee und dick bestrichene Butterbrote mit Schnittlauch – hieß es: »Auf in den Hopfengarten!« Der Anhänger des Traktors wurde mit einem Haufen Ausrüstung beladen, und dann rumpelte er hinaus, gefolgt von einer schnatternden Schar Arbeiter.
»Hast du dein Pflaster dabei?«, fragte Eleonore ihre Freundin.
»Ja, freilich.« Franziska hatte in München noch eine große Rolle mit breitem Hansaplast gekauft, wie Eleonore es ihr geraten hatte. »Aber wofür brauch ich es denn?«, wollte sie wissen.
»Wou kummst denn her, Kind? Aos da Stodt g’wieß. Da houn s’ woul koan Hopfa ned«, mischte sich eine dicke Frau ein und lachte. Wenn sie sprach, klang ihr breiter Oberpfälzer Dialekt ein wenig wie das Gebell eines freundlichen Hundes. Später lernten sie die immer gut gelaunte Kameradin kennen. »Leopoldine haiß i, dearfsch oba Poldi song«, stellte sie sich vor.
»Das Pflaster schützt die Händ a bisserl«, kam Eleonore auf die Frage zurück. »Weißt, der Hopfen ist keine sehr angenehme Pflanze.«
Das war eine gelinde Untertreibung, fand Franziska bald. Ein paar Minuten später saß sie mit den anderen am Hopfengarten auf einem Schemel, vor sich zwischen den Beinen einen großen Spankorb und eine Hopfenranke auf dem Schoß. Den Daumen und Zeigefinger hatte Eleonore ihr mit einem Stück Pflaster abgeklebt, und sie war froh für diese Hilfe. Nur gestandene Bäuerinnen mit hornigen, eisenholzharten Händen fassten hier ohne die Schutzmaßnahme zu.
»Geh, Franzi!«, tröstete Leopoldine. »Des hao ma olle leana miassen! Do is nou a jede mit z’rechtkumma.«
Schon die erste Hopfenranke hatte Franziska gelehrt, wie gemein die Pflanze war. Alles an ihr – bis auf die Dolden – war hart. Was immer sie anfasste, die Stängel und sogar die gefingerten Blätter, so ziemlich alles war erstaunlich stachelig. Das Pflaster half, dass es ihr nicht die Haut aufriss, wenn sie zupackte. Wogegen es nicht half, und was Franziska bald sehr lästig fand, waren die Hafthaare an den Stängeln. Als Schlingpflanze, die etwas braucht, um nach oben zu ranken, benutzte der Hopfen diese groben Haare, die kaum weniger stachelig waren als die eigentlichen Stacheln selbst.
Nach einer Stunde besah sich Franziska ihre Hände. Sie waren wie von einer Schicht Pattex überzogen, und daran haftender Schmutz färbte die Finger schwarzbraun.
»Jessas, bekomm i den Dreck je wieder runter?«, fragte sie Leopoldine, die neben ihr arbeitete.
»Mit am Wasser und a Soafen geht’s schou ob. Ouwa tüchtig schrubben mousst halt. Blous wouzu? Morgen houst an Dreck ja glei wieder drauf. Des deppade Harz gehört halt douzua. Da Hopfen is eh a recht a garstiges G’wachs. Das oanzig weiche, wous a bisserl angenehm is, des san die kleinen Hopfadroin.«
Diese Dolden, die in dichten Trauben wie winzige grüne Tannenzapfen üppig an den Reben hingen, galt es abzuzupfen. Das war die Arbeit der Pflückerinnen. Die kleinen Zapfen waren der Schatz der Region. Ihretwegen hatte der Bauer einen Kredit für den teuren Stangengarten bei der Raiffeisenbank aufgenommen. Wegen dieser Dolden, den weiblichen Blütenständen, waren der Bauer oder seine Frau beinahe täglich herausgekommen und hatten immer wieder dafür gesorgt, dass es den Pflanzen an nichts fehlte.
Wegen dieser kleinen goldgrünen Zapfen beobachteten alle Bierbrauer die Nachrichten aus der Holledau. Wehe, es gab größere Einbußen in der Menge oder gar einen Einbruch in der Qualität! Dann stieg der Hopfenpreis, oder, weit schlimmer noch, es sank die Qualität des Bieres.
Die Bäuerin, die Leopoldine zugehört hatte, meinte: »Der Hopfen is a rechter Segen, aa wenn er sich garstig anlangt. In den Zapferl drin, da sitzt nämlich des Lupulin!«
Sie nahm eine Hopfenblüte und bog die Schuppen zurück. »Siehst die kleinen gelben Körnderl? Des san Drüsen, da sitzt das Lupulin. Das is was ganz Kostbares. Das is das Zeug, das das Bier bitter macht und dafür sorgt, dass es im Keller ned verdirbt und so gut schmeckt. Außerdem macht des Lupulin den Hopfen aa zu a wichtigen Heilpflanzen. Scho die Heilige Hildegard hat’s kennt. Beruhigen kann’s, und ma schlaft besser, wennst as bloß riechst. Viele stopfen an Hopfen in a klein’s Kissen und ham’s im Nachtkasterl. Wenn s’ ned schlafen können, dann holen s’ es raus. Und wenn’s mit der Verdauung ned klappt, oder wann einer keinen rechten Appetit ned hat, hat der Hopfen schon ganz oft die Sach g’richt.«
»Und g’scheid wous vadient ma ja aa am Hopfen!«, meinte Leopoldine und lachte.
»Da hast recht!« Auch Frau Bichler lachte. »I sag’s ja. A rechter Segen is der Hopfen!«
Diesen Segen aber musste man sich mit zerschundenen Händen erkaufen, und Franziska plagte sich sehr. Sie merkte bald, dass die anderen wesentlich schneller zupften als sie selbst. Es dauerte lange, bis sie ihre erste Hopfenkirn voll hatte. Doch niemand lachte sie aus, keiner bemitleidete sie oder war hämisch.
»Des hao ma olle leana miassen! Do is nou a jede mit z’rechtkumma«, ermunterte sie Leopoldine.
Auch wenn Franziska sich schinden und plagen musste, es war dennoch ein lustiges Arbeiten. Man saß locker zusammen, mehrere Pflücker teilten sich eine Rebe, und es wurde gescherzt, erzählt, gelacht und gesungen. Jeder reihum stimmte immer wieder Volks- und Liebeslieder an oder Moritaten, aber auch allerlei albernes Zeug wie das Lied vom Birnbaum, der drunt in der grünen Au wächst. Freche Lieder sangen sie auch, so zum Beispiel eines von einer Magd, die einen Floh am Fuß spürte und Strophe um Strophe das Tierchen immer weiter das Bein hinaufjagte.
Nach drei Stunden tat Franziska das Kreuz weh, und sie streckte sich, doch sie merkte, dass sie inzwischen viel schneller brockte und schon fast mit den anderen mithalten konnte. Natürlich nicht mit Theres aus Sendling. Sie war die Schnellste, aber sie arbeitete auch mit einem Ingrimm und einer Verbissenheit, die keiner sonst aufbrachte.
Von Zeit zu Zeit brachten die Pflückerinnen ihre vollen Kirn zum Hopfenmeister. Als sich Franziska mit ihren Körben aufmachte, war das die Bäuerin. Sie leerte sie in ein großes Blechmaß, den Metzen. Das war die Maßeinheit. Je nach Größe der Kirn brauchte es eineinhalb bis zwei Kirn für den Metzen, der sechzig Liter maß.
»Ah, die Franzi! Bist ja scho fleißig dabei! Und, g’fallt’s dir hier?«
»Ja, schon, Bäu’rin. Mit der G’sellschaft macht’s schon Spaß, und an den Hopfen g’wöhn ich mich scho noch.«
»Ist scho was anderes wie a Salat vom Markt oder was man in der Stadt sonst noch als Pflanzen kennt.«
Die Bäuerin fischte ein einzelnes Blatt mit einem Stängelrest aus den Dolden, mahnte Franziska, genauer zu arbeiten, und gab ihr dann für zwei Metzen zwei Blechmünzen.
»Die hebst auf, und wenn du gehst, am End von der Ernte, da rechnen wir ab.«
Franziska kehrte zurück zu ihrem Schemel und griff sich ein Stück von der nächsten Rebe, zog sie auf ihre blaue Schürze und begann zu zupfen, sang dabei oder erzählte Geschichten.
Zu Mittag brachte der älteste Sohn mit einem Traktor einen großen Korb mit Broten und ein paar Kisten Bier und Limo. Er war ein fescher Bursch, etwa siebzehn Jahre alt und sehr stolz, wie er da auf dem Schlepper saß. Am Nachmittag machte er den Hopfenmeister.
Bis zum Abend war Franziska eine echte Hopfenpflückerin und brauchte den Vergleich mit den anderen nicht mehr zu scheuen. Sie brauchte etwa eine Stunde und zehn Minuten für den Metzen. Das war ein ganz ordentlicher Wert. Eleonore brauchte ein paar Minuten weniger, Poldi brauchte ein paar Minuten mehr, und an die ehrgeizige Theres mit ihren etwa vierzig Minuten kam eh keiner heran.
Als es heim ging, war Franziska müde, verschwitzt und hungrig, aber bestens gelaunt.
»Tummelts euch mit dem Waschen!«, mahnte die Bäuerin. »Die Madl am Wasserhahn im Stall, die Mannsbilder am Schlauch hinter der Scheune! Schickts euch, dann seids schneller beim Abendessen!«
3
21. September – Samstag
»I hab amal nachgedacht«, meinte Wimmer. Es war ein kühler, sonniger Herbstmorgen, kurz vor halb neun und der zweite Tag, an dem die beiden Detektive den Hof suchten. Wimmer stieg wieder zu Biss in den Wagen.
»Und?«
»Na ja, wenn des wirklich alles is, was mir ham, dann is des ned grad viel.«
»Mehr habe ich leider nicht. Ich hab nur dieses eine Foto.«
»Dann muss man aus dem Wenigen halt das Beste machen«, brummte Wimmer. »So wie i das seh, ham mir drei Ansatzpunkte.«
Wimmer bemühte sich, sich sehr professionell zu geben. Er wollte bei dem Detektiv Eindruck schinden. Der Kollege wollte Geld bezahlen, und darum sollte er auch einen soliden Gegenwert erhalten.