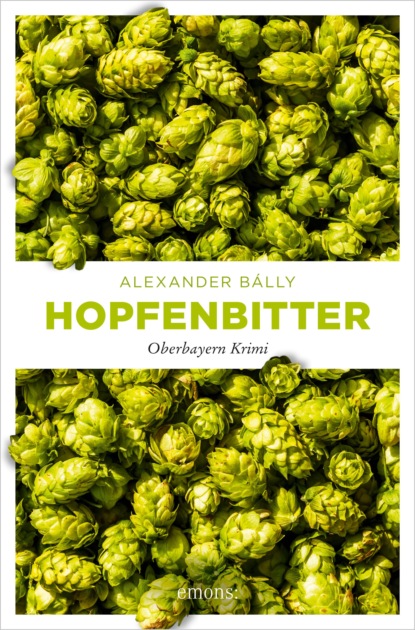- -
- 100%
- +
Eine gemütliche Stunde waren sie bei strahlend blauem Himmel durch die grüne Landschaft marschiert, hatten einen Abstecher nach Larsbach gemacht und waren schließlich an einem Bauernhof von stattlicher Größe angelangt. Links vom weiß getünchten Haupthaus standen die Wirtschaftsgebäude im Hufeisen.
Frau Bichler führte sie sofort zur Kapelle, einem kleinen, hübschen Kircherl auf der anderen Seite des Fahrwegs. Franziska staunte, denn darin verbarg sich eine üppig stuckierte Lourdes-Grotte.
»A jeder bet jetzt bitt schön a Avemaria und a Vaterunser. Und wenn wer noch was auf dem Herzen hat, hier werd g’holfen. Hier hat’s nämlich amal a echtes Wunder geben. A halbes Jahrhundert is wohl her, und wirklich wahr is! Mei Oma hat die Felsl-Kathi noch selber gekannt. Die Arme is damals so krank g’wesen, sie hat scho gar nimmer laufen können. Bei am Brand wär s’ dann fast um’kommen. Aber wie s’ da in ihrer Not zur heiligen Jungfrau ’bet hat, hat s’ plötzlich doch wieder gehn können. A bisserl später hat s’ die Kapelle hier g’stift.«
Weit interessanter als die hübsche Marienkapelle fand Franziska den Leiter dort, Herrn Professor Dr. Zattler, der die Gesellschaft begrüßte und eine kleine Führung veranstaltete.
Mit angenehmer Bassstimme gab er zunächst einen kurzen Abriss des Hopfenanbaus in der Holledau: »Es heißt, es waren kriegsgefangene Wenden, die vom bayerischen Herzog bei Geisenfeld im 8. Jahrhundert angesiedelt wurden. Sie haben wohl den ersten Hopfengarten in der Region angelegt. Natürlich hatten die Armen nicht ahnen können, wie wichtig dieses Gartl für die Region werden würde. Schlechte Landwirte können diese Wenden nicht gewesen sein, denn der Hopfen gedieh gut und man baute ihn seit dieser Zeit an – sporadisch nur, vor allem als Heilpflanze für den Eigenbedarf. Vielleicht trieb man auch ein wenig Handel damit, aber reich wurde man damit natürlich noch nicht. Doch wer wurde das damals hier schon? Unsere schöne Holledau war ja das Armenhaus Bayerns, eine elende Gegend, abseits der großen Verkehrswege und weitgehend unerschlossen.«
Irgendwo in der Ferne pfiff die Lokomotive des Holledauer Bockerls, die mit ihren Wagen Richtung Moosburg schnaufte. Großvater Bichler meinte: »Mei, zu am Wohlstand san ma ja erst ’kommen, wie der König die Eisenbahn hat bauen lassen! Ohne die hätt ma den Hopfen ja a gar ned weg’bracht. Und ihr seids ja aa alle mit am Zug kemma.«
Der Professor nickte. »Die Eisenbahn war sehr wichtig, freilich. Aber es wurde auch schon besser, als 1848 die bayerischen Bauern keine Abgaben und Frondienste mehr leisten mussten. Endlich konnten sie wie Unternehmer denken. 1849 kam dann die Eisenbahn! Die Bahnstrecke von München nach Nürnberg hat wenigstens die westliche Holledau an die Welt angeschlossen. Was aber noch viel wichtiger war: Damals wurden plötzlich untergärige Biere Mode, nach ›Bayerischer Brauart‹ trank man und ›Pilsener‹. Das Biertrinken wurde plötzlich sehr viel beliebter, die Nachfrage nach Hopfen stieg rasant. Seit dieser Zeit ist der Hopfen ein sehr begehrtes Handelsgut.«
Die ersten der Besucher zeigten Zeichen von Langeweile und Ungeduld. Sie wollten lieber Bier trinken, als davon erzählt bekommen. So brachte der Professor seinen Vortrag lieber zu einem raschen Ende.
»Wir hier sorgen dafür, dass der Hopfen ein begehrtes Handelsgut bleibt, denn wir züchten die neuen Hopfensorten, die die Braumeister brauchen. Dabei sind wir weltweit ohne Konkurrenz. Kommen Sie, ich zeig Ihnen, wie wir das machen!«
Als sie nach einem Rundgang durch die Anlage wieder vor das Haupthaus geführt worden waren, stand plötzlich der Traktor der Bichlers auf dem Hof. Robert, der Sohn der Bichlers, hatte den Anhänger herübergefahren. Darauf warteten ein paar Kästen kellerfrisches Bier und eine deftige Brotzeit auf die Ausflügler. Als sich alle gestärkt hatten, fuhren die älteren Pflücker auf dem Hänger zurück, »dass wir morgen ned so müd san bei da Arweit!«.
Franziska ging lieber zu Fuß und genoss die duftende Spätsommerluft, die reizvolle Landschaft mit den vielen Schattierungen des Grüns und die frohe Gemeinschaft der gut gelaunten Arbeiterinnen, denen sie sich angeschlossen hatte.
Die Gesellschaft auf dem Hof war mehr oder weniger dieselbe geblieben, doch es gab auch Änderungen. Ein paar bekannte Gesichter waren ausgeblieben. Eleonore zum Beispiel hatte geheiratet, und mit Jochen, ihrem Säugling, war sie natürlich zu Hause geblieben. Die ehrgeizige Theres, hatte sie gehört, war bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
Die Lücken waren indes schnell gefüllt, denn immer mehr Bauern schafften sich nun die eisernen Pflücker an, riesige Maschinen, größer als die Garagen, die in München im Hinterhof standen. Diese Giganten baute man in der Scheune auf – mancher baute auch um sie herum eine neue Scheune. Gefüttert wurden die Ungetüme mit den Hopfenreben. Mit unglaublichem Getöse wurde der grüne Hopfen komplett ins Innere eines solchen Monsters gezogen, wo eine Kombination aus Walzen mit Gummifingern, Transportbändern und Gebläsen die Dolden abzupfte und in den ersten Stock blies. Den unbrauchbaren Rest der Rebe spuckte der Apparat am anderen Ende fein gehäckselt auf einen Anhänger.
Die ersten dieser Geräte waren noch sehr unzuverlässig gewesen, mussten immer wieder angehalten werden, und sie zupften sehr schlecht. Die Bauern, die sie angeschafft hatten, wurden vielfach belächelt. Inzwischen aber waren diese mechanischen Ungeheuer recht ausgereift, auch wenn natürlich immer noch ein knappes Dutzend Frauen Nachschau halten musste und in diesem Höllenkrach des Apparates Blätter und Stängelreste am Fließband aus dem Doldenstrom fischten.
Dank der Maschinen brauchte man nun weit weniger Erntehelfer. Wer Glück hatte, kam bei Bauern unter, die noch traditionell zupften, so wie die Bichlers. Aber wie lange noch? Wenn die Bauersleut es nicht hören konnten, wurde unter den Pflückern lebhaft erörtert, wann wohl die Bichlers sich auch so ein Ungeheuer anschaffen würden. Die einen meinten, das würde sicher noch Jahre dauern, weil doch die Maschinen so teuer wären. Andere wandten ein, das hätten andere auf anderen Höfen auch angenommen. Doch wenn man der Investition gegenüberstellte, was man alles an Arbeitslöhnen sparte, und das immer wieder alle Jahre neu, war die Anschaffung wohl dennoch lohnend.
Zuletzt war man der Meinung gewesen, dass man die Hopfenbrockerei genießen wollte, solange es noch dauerte. Zukunftsängste hatte ohnehin niemand. Das Wirtschaftswunder war sogar in der Oberpfalz und der Holledau angekommen, und allenthalben war man optimistisch.
Soweit es Franziska anging, würde sie gern immer wieder in die Holledau zum Hopfenbrocken fahren. Die Luft war eine andere als in der großen Stadt. Man roch es. Hier krochen nicht Teer und Diesel in die Nase. Die Luft schmeckte nach Hopfen – natürlich – doch auch nach feuchter Erde und gemähtem Gras, das die Spätsommersonne in duftendes Heu verwandelte. Und dann gab es da noch einen anderen Geruch. Den aber hatte sie erst letzte Woche kennengelernt. Ein starker Duft, von Arbeit, Kernseife, Moschus und sauberer Wäsche.
Konstantin Bichler war in den letzten Jahren zu einem feschen jungen Mann herangewachsen. Ein breites Lächeln hatte er immer schon gehabt, doch in den letzten Jahren hatte die Arbeit ihm dazu noch breite Schultern beschert. Auch war er viel selbstsicherer geworden. Alles Linkische und Ungeschickte hatte er abgelegt, und da er sich schweigsam gab, sagte er nie das Falsche. So umgab ihn eine Aura aus Attraktivität und Geheimnis.
Wie genau es gekommen war, konnte Franziska gar nicht sagen. Natürlich hatte sie seine Entwicklung vom Jungen zum Mann beobachtet, und das durchaus mit einem gewissen Appetit, den ihre Mama belächelt und vor allem Tante und Großmutter »ab-so-lut unpassend« genannt hätten. Doch bis vor ein paar Tagen waren es nur Gedankenspielereien gewesen – falls überhaupt. Und dann … dann war sie gestolpert, und er fing sie auf … sie waren allein, und dann lag sie plötzlich in seinen Armen, und er küsste sie. »Das hat er nicht das erste Mal gemacht!«, schoss es ihr durch den Kopf. Dann küsste er sie erneut, und sie gab sich dem Strudel der Gefühle hin. Als sie eine knappe Stunde später auf wackligen Beinen hinter Konstantin aus einer Kammer schlich, konnte sie immer noch nicht glauben, was da eben passiert war.
Es war leichtsinnig, es war streng verboten, völlig unvernünftig und ohne Zukunft. Es war nur die Lust, aber immerhin – die war es: die reine, vollkommene Lust, vollständige Hingabe zu zweit. Konstantin hatte sich trotz seiner Jugend als guter Liebhaber erwiesen, fest zupackend und zugleich zärtlich und weit besser in Form als die Vorstadtcasanovas, die sie in München umschwärmt und jedes Mal enttäuscht hatten, wenn sie ihnen doch einmal nachgegeben hatte.
Die nächsten Tage ging Franziska wie auf Wolken. Sie machte sich nichts vor. Es war für sie beide nur eine Liebelei. Hatte sie Gewissensbisse oder Angst vor der Sünde? Vor möglichen Folgen und der Zukunft? Nein. Seltsamerweise nicht. Ihre Hormone schäumten über und schwemmten alle Bedenken davon. Die Eskapade widersprach zwar allem, was ihre Tante und Großmutter sie gelehrt hatten, doch deren Moral war kalt und grau. Wenn sie an die Berührungen von Konstantin dachte, musste sie unwillkürlich lächeln. Alles war angenehm gewesen, warm und erfüllte sie immer noch mit Freude. Sie spürte es tief in sich, dass dieses wunderbare Gefühl nicht falsch sein konnte. Natürlich war sie keine passende Partie für die Familie Bichler. Niemals! Zum Hopfenbrocken … ja, da war sie willkommen, denn sie ging ja wieder. Doch als Schwiegertochter? Eine aus der Stadt? A Staaderin? Sicher nicht. Und was Großmutter und Tante sagen würden, wenn sie ihnen den Konstantin als Schwiegersohnaspiranten präsentierte, konnte sie sich denken. Hier auf dem Hopfenhof war er ein Prinz. In München wäre er ein Niemand. Nur ein ungebildeter Kerl, einer vom Lande! Außerdem war er ja jünger als sie.
Sie kicherte. Ja, sie war fünf Jahre älter als Konstantin. Und es war egal. Noch dreimal tanzten sie diesen großartigen horizontalen Tanz voller Lust und Leidenschaft in aller Heimlichkeit, und sie hatten Glück. Sie blieben unentdeckt. Auch tags zuvor erst, beim großen Hopfenzupfermahl, dem Abschlussfest.
Die Bäuerin und ein paar Helferinnen hatten den ganzen Tag in der Küche gewerkelt. Als dann zur Dämmerung die Pflücker mit der letzten Rebe auf dem Anhänger unter Gesang auf den Hof rollten, wurde groß aufgetischt. Es gab Kesselfleisch, Bierbratl auf Kraut, Wurst und Käse, Brot und allerlei Schmalzgebäck, dass es eine wahre Lust war. Als alle froh schmausten, konnten sich Franziska und Konstantin davonstehlen und sich ein letztes Mal miteinander vergnügen. Als sie ihr Gewand wieder in Ordnung gebracht hatten, nahmen sie Abschied.
»Schön war’s mit dir«, meinte er schlicht, aber ehrlich.
»Mit dir schon auch. Ich dank dir schön.«
»Ah geh – ich dank dir. Kommst nächstes Jahr wieder?«
»Schau mer mal. Bis dahin kann viel passieren.«
Würde sie wiederkommen? Konnte es nächstes Jahr so weitergehen? Würde er eine andere für seine »Aufmerksamkeiten« erwählen? Vielleicht war er ja bis dahin verheiratet. Sie wusste es nicht. Sie wusste nur, dass sie es nicht bereute. Es war schön gewesen. Was immer auch kommen mochte, ihr Erlebnis konnte Franziska niemand mehr nehmen.
5
12. Oktober – Samstag
Die Polizeiinspektion Geisenfeld lag an der Nöttinger Straße, gleich neben der Feuerwehr. Sie war in einem soliden, schmucklosen Verwaltungsbau untergebracht, zweigeschossig, darüber ein Dach mit Gauben. Der Erscheinung nach könnte es ein beliebiges Amt sein – oder eine Schule. Nicht einmal Einsatzfahrzeuge vor dem Haus wiesen auf die Ordnungshüter hin. Die parkten im großzügigen Hof dahinter.
Am ersten Samstag im Oktober ging hier um elf Uhr dreiundvierzig eine Meldung über unbefugtes Betreten ein. Polizeihauptwachtmeisterin Monika Zankel hatte ein paar Schwierigkeiten, die Situation in der wirren Schilderung zu erfassen.
Dann rief sie per Funk eine Streife in der Nähe. Es meldete sich Ralf Eichler, der mit seinem Kollegen Helmuth Karg gerade in Untermettenbach Streife fuhr und als Freund und Helfer Präsenz zeigte.
Als Eichler den Hörer des Autotelefons in die Schale zurücklegte, gab er dem Fahrer ein neues Ziel an: »Jebertshausen. Ein Mann will ein Grundstück nicht verlassen. Irgendeine Familienangelegenheit soll da hineinspielen. Und ein Kalb will er angeblich schlachten.«
»Um was geht es?«
»Des war’s, was die Moni aus den Leuten ’raus’bracht hat. Die waren wohl a bisserl durcheinander.«
»Blaulicht?«
Auch ohne Blaulicht waren sie binnen zehn Minuten vor Ort. Es hatte kaum länger gedauert, als wenn sie die Signalrundumbeleuchtung samt Signalhorn benutzt hätten. So fuhren sie auf den Hof der Familie Bichler. Die Situation war dann doch recht rasch klar. Ein Mann, dem Kennzeichen des Autos nach aus der Landeshauptstadt, stand auf dem Hof und gestikulierte wild.
»Aber ich g’hör doch aa dazu.«
Er war puterrot im Gesicht und am Hals, davon abgesehen war er dürr, ältlich und offenbar sehr aufgeregt.
Auf der obersten Treppenstufe stand in der Tür offenbar der Hausherr, ein breitschultriger Mann in den Fünfzigern mit kurzgetrimmtem Vollbart. Er verwehrte den Zutritt zum Haus mit verschränkten Armen und drückte mit seiner ganzen Körpersprache Ablehnung aus. Ihm zur Seite stand ein junger Mann von vielleicht zwanzig Jahren, der grimmig schaute und rhythmisch seine Fäuste öffnete und schloss. Oben auf dem kleinen Balkon über der Tür waren drei Generationen von Bichler-Damen versammelt.
Oma Gusti Bichler war knapp achtzig und keifte laut und engagiert: »Wennst di ned schleichst, dann kannst fei was erleben! Du hast hier nix verloren, und mir wissen genau, wie mir mit Landstreichern und Schamsterern umgehn.«
Lissi, die Enkelin, ein paar Jahre älter als ihr Bruder, überragte ihre Großmutter um Haupteslänge.
»Reg di ab, Oma, die Polizei is doch scho da, siehst es? Des kommt jetzt ois in Ordnung.«
»Nichts ist in Ordnung! Ich gehöre doch auch hierher. Ich bin doch auch einer von euch!«, rief der Mann auf dem Hof.
»A so a Schmarrn!«, zeterte die Ehefrau des Hausherrn vom Balkon. »Wer hier herg’hört, des wiss ma ganz genau. Und so oana wie du, der g’hört ganz sicher ned dazu. Kann es aber vielleicht sein, dass du irgendwo anders hing’hörst und dene da aus’kommen bist?«
»Ich bin aber doch Verwandtschaft!«
»Da kannt ja a jeder kommen. So a Schmarrn. Unsere Verwandten, die kenn ma alle! Und neue brauch ma keine. Und ganz sicher keine hirndepperten Anstaltsflüchtling!«
Hier nun schritt Eichler ein und verbat sich weitere Beschimpfungen. Während Karg den Unruhestifter beiseite nahm, wurde Eichler von Roman Bichler in die Küche gebeten, wo sich alsbald auch die drei Damen versammelten. Hier bekam er die ganze Affäre erklärt.
Vor mehr als einer Stunde war dieser Mann aus München auf dem Hof vorgefahren und hatte geläutet. Als sie die Tür öffneten, stellte er sich als ein Werner Wollner vor.
»Hat Ihnen der Name was g’sagt?«
Alle verneinten, und die Oma ergänzte: »Mir ham ja den Menschen nie nicht gesehen!«
»Ist er Ihnen allen unbekannt?«
Das wurde bestätigt.
»Und dann wollt er, dass mir a Kalb schlachten!«, ergänzte die amtierende Bäuerin.
»Da muass er zum Haslacher oder zum Waslinger. Mir ham scho seit mehr als zwanzig Jahr mit der Kälbermast nix mehr am Hut«, meinte der Bauer.
»Der hat doch an Schuss, so was g’hört doch wegg’sperrt, in a Gummizelle.«
»Äh … i glaub, er hat g’meint, er wär der verlorene Sohn«, wandte die Tochter ein. »Die Sach mit dem Kalberl, die is, glaub ich, eher übertragen g’meint g’wesen.«
»Bist sicher?«, wollte die Oma wissen.
»Ja, scho.«
»Aber an Schuss hat der doch trotzdem. Und was soll des denn hoaß’n? Verlorener Sohn? Wer glabt er denn, dass er wär? I hab nur oan Buam zur Welt bracht, und des is der Roman hier«, stellte die Großmutter mit Nachdruck fest.
»I hab mir die Sach ja a Weile ang’hört, aber es is letztlich doch nur a Haufen Schmarrn g’wesen«, erklärte der Hausherr. »Da hab i eam g’sagt, er soll sich schleichen. Damit er des aa versteht, hab i eam ausdrücklich ang’schafft, das Grundstück zu verlassen.«
»Der is aber ned ganga!«, ergänzte seine Ehefrau. »Immer mehr hat er sich aufg’regt, Sie ham’s ja erlebt. Da hab ich dann bei der Polizei ang’rufen.«
Eichler kehrte zu seinem Kollegen zurück. Sie ließen den Störer auf einem Bänkchen neben dem Stalltor sitzen, traten ein paar Schritte außer Hörweite, und Eichler berichtete.
»Ah … so war des also. Aber außer am Haufen G’schrei is nix weiter passiert?«
»Naa. Und des Kalb war wohl bloß a Anspielung auf den verlorenen Sohn. Was hast du herausg’funden?«
Der Eindruck, den der Kollege Karg von dem Störenfried hatte, war nicht sehr klar. »Er heißt wohl Werner Wollner, wohnt in Ramersdorf in München. Von Beruf ist er Buchhalter, hat er gesagt.«
»Ned gerade die klassische Kundschaft bei Hausfriedensbruch.«
»Ich hab scho alles erlebt. Dieser Buchhalter is aber, so scheint’s, a bisserl neben der Spur. Sagt, dass er erst kürzlich erfahren hat, dass er der Halbbruder von dem Herrn Bichler sei. Und er hat sich nun als Verwandter vorstellen wollen, dass er die Familie kennenlernt, zum Kontakt herstellen. Die Familie wär aber so bös gegen ihn g’wesen, hätt ihn so wüst beschimpft und davonjagen wollen, dass er schier verzweifelt ist. So ist jetzt seine schöne Familienzusammenführung g’scheid nach hinten losgegangen.«
»Ansonsten?«
»Er riecht nicht nach Alkohol, hat uns aber trotzdem ins Rohr gepustet. Auch den Drogenschnelltest hat er gemacht. Beides ist ohne Befund. Trotzdem … ganz sauber is der Kerl ned, wenn du mich fragst.«
Sie gingen zu Wollner zurück. Karg setzte sich zu dem Mann auf die Bank.
»So, Herr Wollner. Mein Kollege hat mit den Bichlers gesprochen. Die haben Ihnen das Betreten des Grundstücks untersagt. Das ham Sie doch verstanden? Nicht wahr?«
»Ja, das haben sie gesagt. Aber ich gehör doch dazu. Ich bin doch auch Familie. Das kann doch nicht sein.«
»Ich weiß nicht, ob Sie mit den Bichlers verwandt sind. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Sie haben den Hausherrn gehört. Und auch ich erteile Ihnen jetzt hiermit einen Platzverweis. Sie wissen, was das heißt? Sie müssen das Grundstück jetzt verlassen.«
»Ich soll gehen?«
»Sie müssen gehen«, sagte Eichler. »Und Sie dürfen das Grundstück auch nicht wieder betreten. Was ham S’ denn eigentlich erreichen wollen, Herr Wollner?«
»Dass sie mich akzeptieren. Nur das. Dass ich auch a Familie hab. Dass ich dazugehöre. Das wollt ich. Weil … das ist nämlich wichtig.«
»Sie haben doch sicher eine eigene Familie. Gehen S’ halt dahin zurück!«
»Ach, da ist bloß meine Frau. Die ist zwar lieb und alles. Aber die versteht mich ned.«
»Nun, die Familie Bichler versteht Sie im Moment auch nicht, und sie möcht Sie nicht hier haben. Wenn Sie bleiben und weiter Ärger machen, werden Sie sie sicher nicht überzeugen.«
Die Polizisten sprachen geduldig und ruhig mit Wollner, doch der ließ sich nur langsam überreden, den Hof zu verlassen.
Trotzig stellte er seinen Wagen gegenüber an den Straßenrand und starrte über den Asphalt hinüber, während die Polizisten die Familie Bichler informierten. Als sie vom Hof fuhren, stand Wollner immer noch dort. Eichler stieg aus und ging zum Fahrzeug hinüber.
»Wollen S’ nicht heimfahren?«, fragte Eichler. »Zu der Familie, die Sie schon haben?«
»Da mag ich nicht hin. Die hier mögen mich nicht. So wie es scheint, kann mich gar keiner nicht leiden. Aber hier ist öffentlicher Raum. Hier darf ich sein. Und drum bleibe ich hier.«
»Herr Wollner, ich hab nichts gegen Sie. Aber was bringt es, wenn Sie hier hinüber schauen?«
»Ach was! Sie mögen mich auch nicht, sonst würden Sie nicht zu den Bichlers halten. Sie sind parteiisch. Das hab ich schon gemerkt.«
»Ich bin nicht dazu da, den Bichlers zu helfen – oder Ihnen. Das ist nicht meine Aufgabe. Auch zum Frieden stiften bin ich nicht da. Ich soll nur für Recht und Ordnung sorgen. Und als Hausherr hat Herr Bichler das Recht, Sie vom Hof zu weisen.«
»Und was ist mit meinen Rechten?«
»Auch für Ihre Rechte werde ich mich einsetzen. Aber Sie haben kein Recht auf Familienanschluss. Selbst wenn Sie mit den Bichlers verwandt sein sollten.«
»Ich bleib da.«
»Ich kann es Ihnen nicht verwehren. Aber wir haben Ihre Personalien. Wenn die Bichlers sich von Ihnen verfolgt oder belästigt fühlen, sehen wir uns wieder. Tun Sie sich doch bitte einen Gefallen. Fahren Sie heim. Vielleicht schreiben S’ Bichlers einen netten Brief und erklären, was Sie möchten.«
1.12.1957
Franziska goss das letzte Wasser aus dem Kessel in den Porzellantrichter, strich eine ihrer widerspenstigen Locken aus dem Gesicht und sah zu, wie das Wasser im Kaffeesatz versickerte. Nun endlich stellte sie die Kanne zum Rest vom edlen Rosenthal auf das Tablett und trug dann alles hinüber in die gute Stube, wo ihre Großmutter die Familie zum Kaffeetrinken geladen hatte.
Die Arbeit blieb natürlich an Franziska hängen. Seit den schlimmen Bombennächten im April ’44 wohnten Mama und sie im rückwärtigen Zimmer bei ihrer Großmutter. Das Haus, in dem sie mit den Eltern gewohnt hatte, war von einer Bombe getroffen worden, ausgebrannt und in sich zusammengestürzt. Eineinhalb Tage waren sie im Keller verschüttet gewesen. Dann waren sie zu ihrer Großmutter gezogen. »Fürs Erste« hatte es geheißen. Doch ihr Vater blieb im Krieg vermisst. Als Ehefrau eines Vermissten bekam Franziskas Mutter natürlich keine Pension und war fast mittellos. So wurde aus dem Provisorium eine Dauereinrichtung.
Mama zeigte sich sehr dankbar und sagte stets, dass sie es viel schlimmer hätte treffen können. Das war nicht ganz falsch. Die Fünf-Zimmer-Wohnung der Großmutter war natürlich groß genug, und auch für sie war die Lösung von großem Vorteil. Die Zeiten, da sich die Witwe eines gehobenen Postbeamten ein Hausmädchen leisten konnte, waren vorbei. Statt Miete zu zahlen, hatte Mama stillschweigend den Großteil der Hausarbeit übernommen.
Dennoch hatte dieses Arrangement einen hohen Preis. Mama und auch Franziska selbst waren schleichend immer weiter unter die Knute der strengen Großmutter geraten. Nach all diesen langen Jahren sah sich die alte Dame als der Familienvorstand und herrschte absolutistisch, gelegentlich auch tyrannisch über ihre Lieben. Ihre Schwiegertochter behandelte sie eher wie eine Hausangestellte und versuchte dies auch bei Franziska.
Auch Franziskas Tante Iris, stolze Kriegerwitwe, konnte sich der Herrschsucht ihrer Mutter nicht komplett entziehen, litt aber weniger darunter. Als Postbeamtenwitwe mit Pension bewohnte sie eine etwas kleinere Wohnung zwei Häuser weiter und war finanziell unabhängig. Schleichend war sie aber ihrer Mutter immer ähnlicher geworden. Nun saß sie neben der Patriarchin am Kaffeetisch, während ihre Schwägerin den Tisch deckte und Franziska den Kaffee auftrug.
Als die erste Kerze am Adventskranz brannte, fragte die Tante: »Sag, Franziska, ist dein Kleid eingelaufen? Ich meine, es saß sonst nicht so stramm.«
»Ich hab wohl ein wenig zugenommen«, erklärte Franziska lächelnd.
Iris blickte säuerlich. »Du musst auf dich achten. Du hast immer noch keinen Mann! Wenn du dich jetzt schon gehen lässt, wird das am End nichts mehr mit dem Myrthenkränzchen.«
Die alte Dame blickte streng auf ihre Enkelin. »Ein Mädchen darf sich nicht gehen lassen. Aber schon gar nicht darf es sich hingeben. Und ich fürchte, das ist viel eher unser Problem. Ist es nicht so, Franziska?«
Franziska errötete schlagartig, ihre Mutter verstand nichts, und Iris blieb der Mund offen stehen.
»Du bist schwanger, Kind! Gib es zu«, stellte die Großmutter fest. Sie sagte es ruhig, schrie nicht, doch ihr Mund war dünn wie ein Strich. »Verbergen kannst du es über kurz oder lang ja sowieso nicht. Bald wird es jedermann sehen können.«
Franziska blickte stumm in ihren Schoß.
»Das musste ja passieren«, legte die Patriarchin nach. »Ich war immer schon dagegen, dass du dich auf dem Land als Magd verdingst. Fabrikarbeit war schon schlimm genug. Aber das … Und man sieht ja, was herauskommt.«