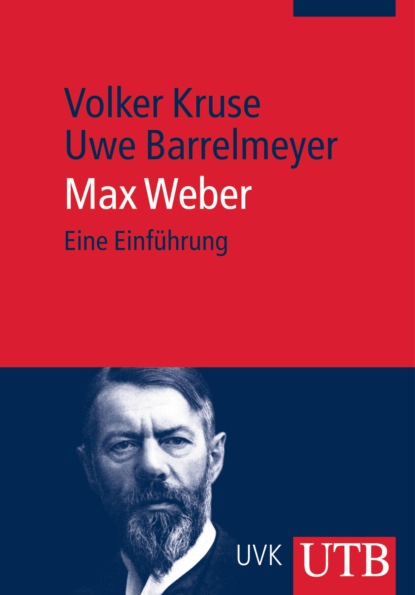- -
- 100%
- +
Welche wissenschaftslogischen Beiträge sind unter den Arbeiten Webers besonders hervorzuheben? Zum einen sind die zwischen 1903 und 1906 unter dem Titel Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie im Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich erschienenen Studien zu nennen. In ihnen versucht Weber die logischen Schwächen der Forschung der historischen Schule der deutschen Nationalökonomie herauszuarbeiten und zugleich eine theoretisch tragfähigere Neuausrichtung nationalökonomischer Forschung voranzubringen. Für ihn bedeutet dies insbesondere, in Abgrenzung von Schmoller über die wirtschaftsgeschichtliche Einzelforschung hinauszugehen. Zugleich lehnt er die verbreitete Entgegensetzung von theoretischer (Carl Menger) und historischer Nationalökonomie (Gustav Schmoller) als wissenschaftslogisch irreführend und unproduktiv ab (vgl. Kap. 2.1).
Zum zweiten ist der 1904 publizierte programmatische Aufsatz Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis zu berücksichtigen, den Weber anlässlich seines Eintritts in die Redaktion des Archivs für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik verfasst. Seine wissenschaftstheoretischen Überlegungen sind konzeptionell wiederum darauf gerichtet, zu klären, inwieweit auch die sozialwissenschaftliche Forschung auf eine strenge erfahrungswissenschaftliche Grundlage zu stellen ist. Als das Arbeitsgebiet sozialwissenschaftlicher Forschung definiert er die wissenschaftliche Erforschung der kulturellen Bedeutung der »sozialökonomischen Struktur des menschlichen Gemeinschaftslebens«, wobei gemäß seines dezidiert historischen Erkenntnisinteresses deren jeweilige »historischen Organisationsformen« in den Blick rücken müssen.
Im zugehörigen Geleitwort entwickelt Weber zusammen mit den Mitherausgebern Werner Sombart und Edgar Jaffé die Grundzüge eines interdisziplinär ausgerichteten sozialwissenschaftlichen Forschungsvorhabens. Es solle sich dem »grundstürzenden Umgestaltungsprozess« widmen, der das wirtschaftliche und kulturelle Leben der Gegenwart bestimme und das Erleben der Zeitgenossen zutiefst präge. Die Dynamik der wirtschaftlichen und kulturellen Umbrüche lässt sich für Weber und seine Mitherausgeber nur aus der »weltgeschichtlichen Tatsache« des »Vordringens des Kapitalismus« erklären, der die gegenwärtige »Geschichtsepoche« bestimme. Diesen Zusammenhang wollen sie im Sinne einer historisch-sozialwissenschaftlichen Zeitdiagnose genauer untersuchen. Erst durch genaue sozialwissenschaftliche Aufklärung sei in handlungspraktischer Absicht eine verlässliche Orientierung möglich. Um die spezifische kapitalistische Entwicklungsdynamik in Wirtschaft und Kultur der Gegenwart zu verstehen und zu erklären, müsse die sozialwissenschaftliche Zeitdiagnose zudem durch historische Forschungen unterstützt werden.
[25]Zum dritten sind Webers 1906 erschienenen kritischen Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik Zur Auseinandersetzung mit Eduard Meyer und Objektive Möglichkeit und adäquate Verursachung in der historischen Kausalbetrachtung hervorzuheben. In ihnen versucht er das für die Nationalökonomie und die Sozialwissenschaft relevante historische Forschungsinteresse insgesamt auf eine erfahrungswissenschaftlich tragfähige Grundlage zu stellen. Weber wendet sich gegen das objektivistische Wissenschaftsverständnis und das Verstehenskonzept, wie es in der damaligen deutschen Geschichtswissenschaft verbreitet ist. Diese beschränkt ihr Forschungsinteresse auf Staat und Politik und lehnt begriffliches Denken und theoretische Generalisierung ab. Zur genuin historischen Methode hat sie das Verstehen erklärt (vgl. Kap. 2.1).
Für einen Historiker wie etwa Leopold v. Ranke ist die Geschichte von willensmäßigen Handlungen erfüllt, die als Ausdruck des Geistes aufzufassen sind. Da Ranke den Menschen als Manifestation Gottes betrachtet, kann er den subjektiven menschlichen Geist und den objektiven göttlichen Geist als zusammenhängende Einheit begreifen. Der sich in der Geschichte manifestierende Geist bzw. die in der Geschichte wirkenden »Ideen« sind damit dem einfühlenden Verstehen des Historikers (»divinatorisches Verstehen«) prinzipiell zugänglich. Dagegen betrachtet es Weber als dringende Aufgabe, die, wie er es bezeichnet, unverändert gültige »metaphysische Wendung« in der zeitgenössischen geschichtswissenschaftlichen Forschung einer grundlegenden Kritik zu unterziehen. Er will für die historisch arbeitenden Kultur- und Sozialwissenschaften insgesamt die Frage beantworten, was es heißt, »Wissenschaft im strengen Sinne« zu betreiben.
Webers methodologische Texte enthalten zahlreiche wechselseitige Bezugnahmen und sind systematisch dem im Rahmen des Archivs für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik realisierten, interdisziplinär ausgerichteten sozialwissenschaftlichen Forschungsvorhaben (»Sozialwissenschaft als Wirklichkeitswissenschaft«) zuzuordnen, das auch für die späteren Arbeiten Webers Gültigkeit hat. Dies gilt insbesondere auch für Webers Konzept einer Verstehenden Soziologie (1913), die Konzeptualisierung des idealtypischen Vorgehens sowie für seinen Umgang mit der sozialphilosophisch zentralen Werturteilsfrage (1917).
1.3.4 Religionssoziologische Arbeiten
Webers Schriften zur Religionssoziologie behandeln aus einer historischen Forschungsperspektive die Frage nach den Ursachen, Erscheinungen und Auswirkungen des Kapitalismus und entfalten diese zugleich in typologisierender Absicht. In diesem Zusammenhang ist die unter dem Titel Die protestantische Ethik und der »Geist« des Kapitalismus zwischen 1904 und 1905 im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik veröffentlichte Artikelreihe anzuführen. Ihr stellt Weber 1906 den Aufsatz Kirchen [26]und Sekten ergänzend zur Seite; er wird später in erweiterter Fassung unter dem Titel Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus veröffentlicht.
Ein wesentlicher Ausgangspunkt dieser Arbeiten ist die sozialwissenschaftliche Beobachtung, dass in der wirtschaftlichen Welt Menschen protestantischen Glaubens überproportional vertreten sind. Weber nimmt ferner Bezug auf zeitgenössische Diskussionen, in denen als Ursache für die Entstehung des neuzeitlichen Kapitalismus die wechselseitige Einflussnahme religiöser und ökonomischer Faktoren herausgestellt wird. Wichtig ist auch Werner Sombarts 1902 erschienene Studie Der moderne Kapitalismus, in der dieser die Bedeutung von Calvinismus und Quäkertum für die Entstehung des Kapitalismus betont.
Weber versucht im Anschluss an Sombarts Überlegungen nachzuweisen, dass bestimmte Glaubenssätze protestantischer Glaubensgemeinschaften Normen der Lebensführung und insbesondere eine Wirtschaftsgesinnung (»Berufsmenschentum«) hervorgebracht haben, die das wirtschaftliche Gefüge im Sinne kapitalistischer Strukturen entscheidend verändert und dynamisiert haben. So habe insbesondere der Calvinismus die innerweltliche Askese als besonders wertvolles Verhalten religiös prämiert. Wirtschaftlicher Erfolg wird dabei als ein Zeichen göttlicher Auserwähltheit interpretiert. Diese Glaubensüberzeugung führt laut Weber dazu, dass die »Auserwählten« sich anstrengen, viel und produktiv zu arbeiten und Kapital anzusammeln. Die nichtintendierte Wirkung dieses religiös motivierten Verhaltens besteht also darin, Kapitalbildung und Kapitalismus voranzutreiben. Weber geht daher insgesamt von einem Wirtschaften aus, das vom »frühkapitalistischen Geist« getragenen wird (vgl. Kap. 3).
In den zwischen 1915 und 1919 wiederum im Archiv veröffentlichten Aufsätzen über Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen weitet Weber seine Forschungen zur Entstehung des Kapitalismus auf außereuropäische Religionen aus (z. B. Konfuzianismus, Taoismus, Hinduismus, Buddhismus). Sie dienen u. a. dem Zweck, die heftig kritisierte Protestantismusthese durch komparative Studien zu untermauern.
Weber fragt nun, warum in nichteuropäischen Kulturen kein Kapitalismus nach westlichem Muster entstanden ist (jedenfalls nicht aus sich heraus), obwohl diese zeitweise ein hohes und dem Okzident überlegenes Entwicklungsniveau erreicht haben, wie z. B. China oder die islamische Welt. Er analysiert in idealtypischer Darstellung historische Konstellationen, denen zwei Merkmale fehlen:
1. eine der protestantischen Wirtschaftsethik funktional äquivalente Wirtschaftsgesinnung
2. ein dem okzidentalen Frühkapitalismus vergleichbares Wirtschaftssystem.
Sowohl der Konfuzianismus als auch der Taoismus als kosmozentrische, weltbejahende »politische« Religionen hätten z. B. aufgrund ihrer traditionalistischen Prägung eine Ethik unbedingter Anpassung an die ewige Ordnung des Kosmos formuliert, was die Entstehung einer kapitalistischen Wirtschaftsgesinnung und einer kapitalistischen [27]Wirtschaft okzidentaler Prägung unmöglich gemacht habe. Entsprechende Argumentationsreihen entfaltet Weber auch für die übrigen Weltreligionen. Die Ergebnisse seiner historischen Konstellationsanalysen stützen für ihn die Plausibilität seiner Protestantismusthese: Der okzidentale Frühkapitalismus ist kausal zurechenbar durch die rationale Ethik des asketischen Protestantismus mit verursacht worden (vgl. Kap. 3).
1.3.5 Wirtschaft und Gesellschaft
Das von Weber in seinen Arbeiten über die Wirtschaftsethik der Weltreligionen bereits verarbeitete Material ist unter dem Titel Religionssoziologie. Typen religiöser Vergemeinschaftung in systematisierender Absicht in einen veränderten Darstellungszusammenhang aufgenommen worden. Der Text bildet ein größeres Kapitel der posthum veröffentlichten soziologischen Textsammlung Wirtschaft und Gesellschaft. Ursprünglich für das mehrbändige Handbuch Grundriss der Sozialökonomik vorgesehen, dienen die religionssoziologischen Passagen überwiegend der soziologischen Systematisierung und Generalisierung. Es ist nicht mehr länger von spezifischen historischen Individuen bzw. Konstellationen die Rede, sondern von Religionen, von religiösem Handeln oder religiöser Ethik im Allgemeinen.
Webers im engeren Sinne soziologische Arbeiten sind heute wesentlich in zwei Textfassungen zugänglich. Zum einen liegt die bereits angeführte Textsammlung Wirtschaft und Gesellschaft vor, ursprünglich herausgegeben von Marianne Weber, später in veränderter Fassung von Johannes Winckelmann. Bis in die 1970er Jahre galt Wirtschaft und Gesellschaft als unbestrittenes Hauptwerk Max Webers; er habe es in etwa dieser Form angestrebt, es sei ihm aber nicht vergönnt gewesen, es zu vollenden. Die Mehrheit der Weber-Forscher ist aber inzwischen der Ansicht, dass Weber ein solches Hauptwerk nie im Sinn gehabt hat. Daher werden in der Max-Weber-Gesamtausgabe die Manuskripte, die in Wirtschaft und Gesellschaft eingegangen sind, einzeln veröffentlicht. Die neuere Weber-Rezeption hat ganz entscheidend von dem Entstehen einer historisch-kritischen Gesamtausgabe der Schriften, Korrespondenz und Vorlesungen Max Webers profitiert. Seit den 1980er Jahren werden sukzessive mit beträchtlichen Forschungsmitteln an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München neue Bände der historisch-kritischen Werkedition herausgegeben. Diese neue Textgrundlage erlaubt es, einen vergleichenden Blick insbesondere auf die historischen Entstehungszusammenhänge der Arbeiten Webers zu werfen.
[28]1.3.6 Beiträge zur politischen Publizistik
Zeit seines Lebens interessiert sich Weber für politische Fragen und Probleme. Er erwägt verschiedentlich, eine politische Laufbahn einzuschlagen. Dies gelingt ihm allerdings nicht. Durch enge Kontakte zu bekannten Politikern (z. B. Friedrich Naumann) ist es ihm jedoch möglich, indirekt Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse zu nehmen. So nimmt er im Winter 1918/19 beispielsweise an den Beratungen zur Weimarer Verfassung und 1919 an den Friedensverhandlungen mit den Alliierten teil. Öffentlichkeitswirksam bezieht er vor allem als politischer Publizist Stellung zu gesellschaftspolitischen Streitfragen und Auseinandersetzungen.
In seinem politischen Denken orientiert sich Weber wesentlich an den »nationalen Interessen« Deutschlands. Diese trägt er in herausfordernder nationalistischer Diktion und Begrifflichkeit zunächst in seiner Antrittsrede Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik von 1895 in die gebildete Öffentlichkeit. Ausgehend von den Ergebnissen der bereits erwähnten Landarbeiter-Studie problematisiert er die Abwanderung der deutschstämmigen Bevölkerung sowie die im Interesse der Großgrundbesitzer von der Regierung erlaubte Einwanderung polnischer Saisonarbeiter. Diese Wanderungsbewegung führe zu einer nicht hinnehmbaren Verletzung der nationalen Interessen Deutschlands. Weber erhebt deshalb drei Forderungen: Bodenankauf durch den Staat, systematische Kolonisierung durch deutsche Bauern sowie die Schließung der östlichen Grenzen. Die Politik habe sich an den Interessen der gesamten Nation und nicht an denen der privilegierten Gruppe der Großgrundbesitzer zu orientieren.
In seinen späteren Schriften tritt Weber für eine weitere Demokratisierung der politischen Verhältnisse in Deutschland ein. Dies lässt sich gut an seinen Beiträgen zur politischen Neuordnung Deutschlands nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ablesen, mit denen er eine Bestandsaufnahme der Lage Deutschlands nach dem verlorenen Weltkrieg vorlegt. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang seine Kritik an der zunehmenden Bürokratisierung der Gesellschaft (»Wilhelminischer Obrigkeitsstaat«) sowie an der gefährlichen Demagogisierung der Politik. Seiner Auffassung nach ist eine stärkere parlamentarische Kontrolle dieser politischen Kräfte erforderlich. Nur so könne der Gefahr entgegengewirkt werden, dass die individuelle Freiheit der einzelnen Bürger und in Folge dessen das demokratische Leben insgesamt unter dem Druck insbesondere der staatlichen Bürokratisierungstendenzen zerstört werden. Für mindestens so bedeutsam erachtet er, dass eine klare politische Leitung der Bürokratie gegeben ist. Erfolgreiche politische Führung, so lässt sich Webers grundlegende politische Botschaft zusammenfassen, muss einen Ausgleich herstellen zwischen den Polen reiner bürokratischer und reiner charismatischer Herrschaft. Nur so könne verhindert werden, dass die blinde Umsetzung von Verwaltungsmechanismen auf der einen Seite und die verantwortungslose Demagogenherrschaft auf der anderen Seite ihre negative politische Wirkung entfalteten (vgl. Kap. 6.4). Webers Beiträge zu der [29]Frage, wie nach dem verlorenen Krieg in Deutschland eine verantwortungsbewusste politische Leitung etabliert werden kann, bewegen sich stets in diesem argumentativen Spannungsfeld. Insbesondere sein Artikel Der Reichspräsident (1919) hat die nachfolgenden politischen und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen über die späten politischen Positionen Webers entscheidend bestimmt (vgl. auch Kap. 6.4).
Wichtige Schriften Webers
Gesammelte Politische Schriften, 5. Aufl., hg. von Johannes Winckelmann, Tübingen 1988 (= GPS):
Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik (1895), S. 1–25.
Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland. Zur politischen Kritik des Beamtentums und Parteiwesens (1918), S. 306–443.
Politik als Beruf (1919), S. 505–560.
Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (1924), 2. Aufl., hg. von Marianne Weber, Tübingen 1988 (= GASW):
Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur (1896), S. 289–311.
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 7. Aufl., hg. von Johannes Winckelmann, Tübingen 1988 (= WL):
Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie (1903–06), S. 1–145.
Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis (1904), S. 146–214.
Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik (1906), S. 215– 290.
Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie (1913), S. 427–474.
Der Sinn der »Wertfreiheit« der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1917), S. 489–540.
Wissenschaft als Beruf (1919), S. 582–613.
Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft (1922), S. 475–488.
Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I (1920), 9. Aufl., hg. von Marianne Weber, Tübingen 1988 (= GARS I):
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1905/1920), S. 17–236.
Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen, Einleitung (1916), S. 237–275.
Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen, Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung (1916), S. 536–573.
Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der Verstehenden Soziologie, 5. Aufl., hg. von Johannes Winckelmann, Tübingen 1985 (= WuG):
Soziologische Grundbegriffe (1921), S. 1–30.
Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (1924), 2. Aufl., hg. von Marianne Weber, Tübingen 1988 (= GASW):
Max Weber, Entwicklungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter, S. 470– 507.
[30]Weiterführende Literatur
Eduard Baumgarten: Max Weber – Werk und Person. Tübingen 1964.
Reinhard Bendix: Max Weber – Das Werk. Darstellung, Analyse, Ergebnisse (1960), München 1964.
Kaesler, Dirk: Max Weber. Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung. 3. Aufl., Frankfurt a. M. 2003.
Wolfgang J. Mommsen: Max Weber und die deutsche Politik. 1. Aufl., Tübingen 1974.
Wolfgang J. Mommsen/Wolfgang Schwentker (Hg.): Max Weber und seine Zeitgenossen, Göttingen 1988.
Joachim Radkau: Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens, München 2005.
Guenther Roth: Max Webers deutsch-englische Familiengeschichte, Tübingen 2001.
Friedrich Tenbruck: Das Werk Max Webers. Gesammelte Aufsätze zu Max Weber, hg. von Harald Homann, Tübingen 1999.
Marianne Weber: Max Weber – Ein Lebensbild (1926), München 1989.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.