Ein verborgenes Leben (Steidl Pocket)
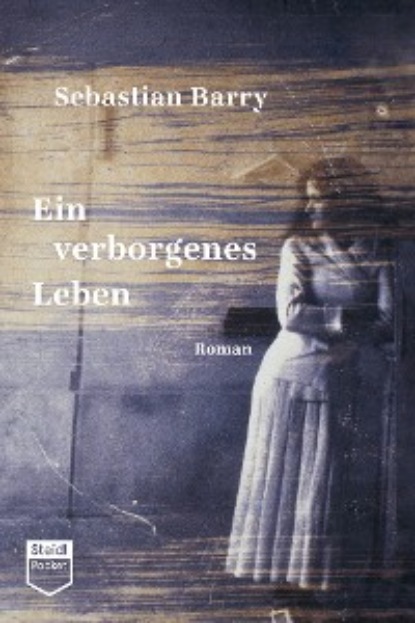
- -
- 100%
- +
»Oh«, machte ich.
»Das kann man bei Horaz nachlesen«, sagte er.
»Gebackene Bohnen von Batchelor?«
»Vermutlich nicht.«
Dr. Grene beantwortete meine Frage mit gewohnt ernster Miene. Das Schöne an Dr. Grene ist, dass er überhaupt keinen Sinn für Humor hat, was ihn fast schon wieder humorvoll wirken lässt. Glauben Sie mir, an einem Ort wie diesem ist das eine schätzenswerte Eigenschaft.
»Also«, sagte er, »Ihnen geht es so weit ganz gut?«
»Ja.«
»Wie alt sind Sie inzwischen, Roseanne?«
»Hundert, glaube ich.«
»Finden Sie es nicht bemerkenswert, dass es Ihnen mit hundert noch so gut geht?«, fragte er, als hätte er zu diesem Umstand irgendwie beigetragen, was er ja vielleicht auch hat. Immerhin bin ich schon seit rund dreißig Jahren, vielleicht noch länger, in seiner Obhut. Dabei ist er selbst alt geworden, wenn auch nicht so alt wie ich.
»Ich finde es äußerst bemerkenswert. Aber, Herr Doktor, ich finde so viele Dinge bemerkenswert. Ich finde Mäuse bemerkenswert, ich finde die seltsamen grünen Sonnenstrahlen bemerkenswert, die durchs Fenster herein klettern. Auch Ihren heutigen Besuch finde ich bemerkenswert.«
»Es tut mir leid zu hören, dass Sie noch immer Mäuse haben.«
»Hier wird es immer Mäuse geben.«
»Aber stellt John denn keine Fallen auf?«
»Das schon, aber er spannt die Sprungfedern nicht richtig, und die Mäuse können den Käse problemlos fressen und entwischen wie Jesse James und sein Bruder Frank.«
Jetzt nahm Dr. Grene seine Augenbrauen zwischen zwei Finger seiner rechten Hand und massierte sie eine Weile. Danach rieb er sich die Nase und stöhnte. Das Stöhnen enthielt all die Jahre, die er in dieser Anstalt verbracht hatte, all die Vormittage seines Lebens hier, all das sinnlose Geschwätz über Mäuse, Behandlungsmethoden und Alter.
»Wissen Sie, Roseanne«, sagte er, »da ich mich unlängst mit der rechtlichen Position aller unserer Insassen befassen musste, von der in der Öffentlichkeit so viel die Rede ist, habe ich mir noch einmal Ihre Aufnahmepapiere angeschaut, und ich muss gestehen –«
All dies sagte er in denkbar gelassenem Tonfall.
»Gestehen?«, fragte ich, um ihn zu ermuntern. Ich wusste, dass er dazu neigte, zu verstummen und privaten Gedanken nachzuhängen.
»O ja – entschuldigen Sie. Hmm, ja, ich wollte Sie fragen, Roseanne, ob Sie sich vielleicht noch an die näheren Umstände Ihrer Aufnahme hier erinnern können. Das wäre sehr hilfreich – wenn Sie es könnten. Den Grund nenne ich Ihnen gleich – wenn es denn sein muss.«
Dr. Grene lächelte, und ich hatte den Verdacht, dass die letzte Bemerkung scherzhaft gemeint war, auch wenn ich nicht verstand, was daran komisch sein sollte, zumal er sich normalerweise, wie gesagt, nie an Humor versuchte. Insofern vermutete ich, dass etwas Ungewöhnliches in ihm vorging.
Aber dann, fast so schlimm wie er, vergaß ich, ihm zu antworten.
»Können Sie sich an irgendetwas davon erinnern?«
»Sie meinen meine Ankunft, Dr. Grene?«
»Ja, ich glaube, die meine ich.«
»Nein«, sagte ich, denn eine entschiedene, eine unverfrorene Lüge war die beste Antwort.
»Nun«, sagte er, »leider ist ein Großteil unseres Archivs im Keller von Generationen von Mäusen als Bettstatt benutzt worden, ist ja auch kein Wunder, und nun ist alles ziemlich ruiniert und unlesbar. Über Ihre ohnehin schon schmale Akte sind sie auf höchst bemerkenswerte Weise hergefallen. Sie würde einem ägyptischen Grabmal alle Ehre machen. Bei der leisesten Berührung droht sie zu zerfallen.«
Danach herrschte langes Schweigen. Ich lächelte und lächelte. Ich versuchte mir vorzustellen, wie ich in seinen Augen wohl aussah. Ein Gesicht, so zerknittert und alt, so altersversunken.
»Natürlich kenne ich Sie sehr gut. Im Lauf der Jahre haben wir uns ja oft genug unterhalten. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Notizen gemacht. Es sind nur wenige Seiten, was Sie nicht überraschen dürfte. Etwas in mir sträubt sich dagegen, mir viele Notizen zu machen, was in meinem Metier vielleicht nicht eben nachahmenswert ist. Manchmal heißt es, wir bewirken nichts, für niemanden. Aber ich hoffe doch, dass wir unser Bestes für Sie getan haben, trotz meines sträflichen Mangels an Notizen. Ich hoffe es wirklich. Ich freue mich, dass Sie sagen, es gehe Ihnen gut. Mir würde der Gedanke gefallen, dass Sie hier glücklich sind.«
Ich beschenkte ihn mit meinem ältesten Altfrauenlächeln, als verstünde ich nicht recht.
»Weiß Gott«, sagte er dann mit einer gewissen geistigen Eleganz, »niemand könnte hier glücklich sein.«
»Ich bin glücklich«, erwiderte ich.
»Wissen Sie«, sagte er, »ich glaube Ihnen. Ich glaube, Sie sind der glücklichste Mensch, den ich kenne. Aber ich fürchte, ich werde Ihren Fall neu bewerten müssen, Roseanne, da es in den Zeitungen einen Aufschrei der Entrüstung gegeben hat über – darüber, dass Leute, die eher aus sozialen als aus medizinischen Gründen eingesperrt wurden, weiterhin, weiterhin –«
»Festgehalten werden?«
»Ja, ja, festgehalten werden. Und zwar bis auf den heutigen Tag festgehalten werden. Natürlich sind Sie seit vielen, vielen Jahren hier, ich vermute fast, es sind vielleicht schon fünfzig?«
»Ich weiß es nicht mehr, Dr. Grene. Mag wohl sein.«
»Möglicherweise betrachten Sie diese Anstalt ja auch als Ihr Zuhause.«
»Nein.«
»Nun, wie jeder andere haben Sie das Recht, frei zu sein, wenn Sie für … für die Freiheit taugen. Ich vermute, selbst mit einhundert Jahren möchten Sie vielleicht … möchten Sie vielleicht umherspazieren und im Sommer im Meer baden und die Rosen riechen –«
»Nein!«
Eigentlich wollte ich gar nicht schreien, aber wie Sie merken werden, ist der bloße Gedanke an derlei kleine Aktivitäten, die die meisten Menschen mit Behagen und Lebensglück verbinden, noch immer ein Messer in meinem Herzen.
»Verzeihung?«
»Nein, nein, bitte fahren Sie fort.«
»Wie auch immer, falls ich feststellen sollte, dass Sie ohne wirklichen Grund, sozusagen ohne medizinische Grundlage hier sind, müsste ich mich um eine andere Regelung bemühen. Ich möchte Sie nicht beunruhigen. Und ich habe nicht die Absicht, meine liebe Roseanne, Sie in die Kälte hinauszuschicken. Nein, nein, dies wäre eine sorgfältig abgestimmte Maßnahme und bedarf, wie gesagt, meiner vorherigen Neubewertung. Fragen, ich würde Sie befragen müssen – bis zu einem gewissen Grad.«
Ich war mir ihres Ursprungs nicht ganz sicher, aber in mir breitete sich ein Gefühl der Angst aus, so wie ich mir vorstelle, dass sich das Gift gespaltener Atome in den Menschen der Außenbezirke von Hiroshima ausgebreitet und sie ebenso sicher getötet hat wie die Explosion selbst. Angst wie eine Krankheit, die Erinnerung an eine Krankheit, zum ersten Mal seit vielen Jahren verspürte ich sie.
»Fehlt Ihnen etwas, Roseanne? Bitte regen Sie sich nicht auf.«
»Natürlich will ich meine Freiheit, Dr. Grene. Aber sie ängstigt mich auch.«
»Der Gewinn der Freiheit«, sagte Dr. Grene freundlich, »vollzieht sich stets in einer Atmosphäre der Ungewissheit. Wenigstens in diesem Land. Vielleicht in allen Ländern.«
»Mord«, sagte ich.
»Ja, manchmal«, sagte er sanft.
Dann schwiegen wir, und ich betrachtete das solide Rechteck aus Sonnenlicht im Zimmer. Dort hatte sich uralter Staub abgesetzt.
»Freiheit, Freiheit«, sagte er.
Irgendwo in seiner staubigen Stimme tönte undeutlich die Glocke der Sehnsucht. Ich weiß nichts von seinem Leben draußen, von seiner Familie. Hat er Frau und Kinder? Irgendeine Mrs Grene? Ich weiß es nicht. Oder doch? Er ist ein kluger Mann. Sieht aus wie ein Frettchen, aber das macht nichts. Jemand, der von den alten Griechen und Römern zu erzählen weiß, ist ein Mann ganz nach dem Herzen meines Vaters. Ich mag Dr. Grene, trotz seiner staubigen Verzweiflung, denn jedes Mal liefert er mir ein Echo der Redeweise meines Vaters, die sich aus Sir Thomas Browne und John Donne zusammensetzte.
»Nun, heute fangen wir nicht damit an. Nein, nein«, sagte er und erhob sich. »Ganz bestimmt nicht. Aber es ist meine Pflicht, Ihnen die Fakten vorzutragen.«
Und wieder durchquerte er mit einer Art unendlicher ärztlicher Geduld den Raum und ging zur Tür.
»Sie verdienen nichts anderes, Mrs McNulty.«
Ich nickte.
Mrs McNulty.
Immer wenn ich diesen Namen höre, muss ich an Toms Mutter denken. Auch ich war einmal eine Mrs McNulty, allerdings nie auf so überlegene Weise wie sie. Nie. Wie sie mir hundertfach deutlich machte. Außerdem, wieso habe ich meinen Namen seither immer als McNulty angegeben, wenn sich doch jedermann größte Mühe gab, mir den Namen wegzunehmen? Ich weiß es nicht.
»Vorige Woche war ich im Zoo«, sagte er plötzlich, »zusammen mit einem Freund und dessen Sohn. Ich war in Dublin, um ein paar Bücher für meine Frau abzuholen. Über Rosen. Der Sohn meines Freundes heißt William, was ja, wie Sie wissen, auch mein Name ist.«
Das wusste ich nicht!
»Wir kamen zum Giraffenhaus. William hatte große Freude an ihnen, zwei riesige, langhalsige Giraffendamen waren es, mit weichen, langen Beinen, sehr, sehr schöne Tiere. Ich glaube, ich habe noch nie so schöne Tiere gesehen.«
Dann bildete ich mir ein, in dem schimmernden Zimmer etwas Merkwürdiges zu sehen, eine Träne, die ihm in den Augenwinkel trat, über die Wange lief und rasch herabfiel, eine Art verborgenen, ganz intimen Weinens.
»So schöne Tiere, so schöne Tiere« sagte er.
Sein Gerede hatte mich in Schweigen gehüllt, ich weiß nicht, warum. Es war eben doch nicht das offene, unbeschwerte, frohe Gerede meines Vaters. Ich wollte ihm zuhören, ihm aber jetzt nicht antworten. Diese eigenartige Verantwortung, die wir anderen gegenüber verspüren, wenn sie reden: ihnen den Trost einer Antwort zu bieten. Wir armen Menschen! Außerdem hatte er mir gar keine Frage gestellt. Er schwebte lediglich dort im Zimmer, substanzlos, ein Mann mitten im Leben, der, noch auf den Beinen, unmerklich dahinstarb, wie wir alle.
VIERTES KAPITEL
Später kam John Kane in mein Zimmer geschlurft. Murrend schob er seinen Besen vor sich her, ein Mensch, den ich zu akzeptieren gelernt habe wie alle Dinge hier, die man, wenn man sie nicht ändern kann, ertragen muss.
Mit leisem Grauen bemerkte ich, dass sein Hosenstall offen stand. Seine Hose ist mit einer Reihe klobig aussehender Knöpfe verziert. Er ist ein kleiner Mann, zugleich aber ganz Muskeln und Manneskraft. Irgendetwas stimmt mit seiner Zunge nicht, weil er alle Augenblicke mit son der barer Mühsal schlucken muss. Sein Gesicht ist von einem Schleier dunkelblauer Äderchen überzogen, wie das Gesicht eines Soldaten, der beim Abfeuern einer Kanone zu dicht an die Mündung gekommen ist. In der Gerüchteküche der Anstalt genießt er einen schlechten Ruf.
»Ich verstehe nicht, wozu Sie all die Bücher brauchen, Missus, Sie haben doch gar keine Brille, um sie zu lesen.«
Dann schluckte er wieder, schluckte.
Ich kann auch ohne Brille sehr gut sehen, aber das verriet ich ihm nicht. Er bezog sich auf die drei Bände in meinem Besitz, die Ausgabe der Religio Medici meines Vaters, Der Jagdhund des Himmels und Mr Whitmans Grashalme.
Alle drei vergilbt und abgegriffen.
Doch ein Gespräch mit John Kane kann überallhin führen, wie die Gespräche mit Jungs, als ich noch ein Mädchen von zwölf oder dreizehn Jahren war, eine Schar von Jungs an unserer Straßenecke, die gleichmütig im Regen standen und mir mit leiser Stimme Dinge zuflüsterten – jedenfalls zu Anfang noch mit leiser Stimme. Hier, inmitten der Schatten und fernen Rufe, ist Schweigen die größte Tugend.
Die, die sie nähren, lieben sie nicht; die, die sie kleiden, fürchten nicht um sie.
Das ist irgendein Zitat, aber was oder woher, weiß ich nicht.
Selbst Geschwafel ist gefährlich, Schweigen ist besser.
Ich bin schon lange Zeit hier, und in dieser Zeit habe ich die Tugend des Schweigens ganz zweifellos erlernt.
Der alte Tom hat mich hier eingewiesen. Ich glaube, dass er’s war. Sich selbst zuliebe, denn er arbeitete als Schneider in der Irrenanstalt von Sligo. Ich glaube, er hat auch Geld dazugegeben, wegen dieses Zimmers. Oder zahlt Tom, mein Mann, für mich? Aber der kann doch gar nicht mehr am Leben sein. Es ist nicht die erste Anstalt, in die ich eingewiesen wurde, die erste war –
Aber mir geht’s nicht um Schuldzuweisungen. Dies ist ein anständiger Ort, wenn auch kein Zuhause. Wenn es mein Zuhause wäre, würde ich verrückt!
Oh, ich muss mich ermahnen, mich klar auszudrücken und sicher zu sein, dass ich weiß, was ich Ihnen da erzähle. Jetzt kommt es auf Richtigkeit und Genauigkeit an.
Dies ist ein guter Ort. Dies ist ein guter Ort.
Wie ich höre, gibt es hier in der Nähe eine Stadt. Die Stadt Roscommon. Ich weiß nicht, wie weit es bis dorthin ist, nur, dass ein Feuerwehrauto für die Strecke eine halbe Stunde braucht.
Das weiß ich deswegen, weil John Kane mich eines Nachts vor vielen Jahren aus dem Schlaf gerissen hat. Er führte mich hinaus auf den Flur und trieb mich zwei, drei Treppen hinunter. In einem der Gebäudeflügel war ein Feuer ausgebrochen, und er wollte mich in Sicherheit bringen.
Statt mich direkt ins Erdgeschoss zu geleiten, durchquerte er einen langen, dunklen Saal, in dem sich auch Ärzte und andere Mitarbeiter versammelt hatten. Von unten stieg Rauch auf, aber der Saal galt als sicher. Allmählich lichtete sich das Dunkel, oder meine Augen gewöhnten sich daran.
Es standen an die fünfzig Betten darin, ein langer, schmaler Saal, dessen Vorhänge alle zugezogen waren. Dünne, zerschlissene Vorhänge. Alte, alte Gesichter, so alt wie meines jetzt. Ich war erstaunt. Sie hatten nicht allzu weit von mir entfernt gelegen, und ich hatte nichts davon gewusst. Alte, stumme Gesichter, die erstarrt dalagen, wie fünfzig russische Ikonen. Wer waren sie? Nun, es waren Ihre Angehörigen. Sprachlos, stumm schliefen sie dem Tod entgegen, krochen auf blutenden Knien unserem Herrn entgegen.
Ein Völkerstamm von Frauen, die einmal Mädchen gewesen waren. Ich flüsterte ein Gebet, um ihre Seelen rascher in den Himmel zu befördern. Denn ich glaube, sie krochen nur sehr langsam dorthin.
Vermutlich sind sie alle längst tot, zumindest ein Großteil von ihnen. Ich bin nie wieder dort gewesen. Nach einer halben Stunde traf das Löschfahrzeug ein. Daran kann ich mich noch erinnern, weil einer der Ärzte eine diesbezügliche Bemerkung machte.
Diese Orte, so ganz anders als die Welt da draußen, Orte ohne all die Dinge, derentwegen wir die Welt preisen. Wo Schwestern, Mütter, Großmütter, Jungfern liegen, allesamt vergessen.
Die Menschenstadt in der Nähe schläft und wacht, wacht und schläft und vergisst ihre verlorenen Frauen dort, in langen Reihen.
Eine halbe Stunde. Ein Brand brachte mich dazu, sie zu sehen. Nie wieder.
Die, die sie nähren, lieben sie nicht.
»Brauchen Sie das noch?«, fragt John Kane dicht an meinem Ohr.
»Was ist es?«
Es lag auf seinem Handteller. Die halbe Schale eines Vogeleis, blau wie die Äderchen in seinem Gesicht.
»O ja, danke«, sagte ich. Es war etwas, das ich vor vielen Jahren im Park aufgelesen hatte. Das Ei hatte in einer Fensternische gelegen, und bis dahin hatte er es nie erwähnt. Aber es hatte dort gelegen, blau, ohne jeden Makel und alterslos. Und doch ein altes Ding. Vor vielen, vielen Vogelgenerationen.
»Vielleicht ist es ein Rotkehlchenei«, meinte er.
»Vielleicht«, antwortete ich.
»Oder ein Lerchenei.«
»Ja.«
»Jedenfalls lege ich es zurück«, sagte er und schluckte erneut, als wäre seine Zunge an der Wurzel verhärtet. Einen Augenblick lang trat sein Adamsapfel hervor.
»Ich weiß nicht, wo all der Staub herkommt«, sagte er. »Jeden Tag fege ich das Zimmer aus, aber dauernd liegt da Staub, weiß Gott, uralter Staub. Nicht etwa neuer Staub, niemals neuer Staub.«
»Nein«, sagte ich. »Nein. Verzeihen Sie.«
Er richtete sich einen Moment auf und sah mich an.
»Wie heißen Sie?«, fragte er.
»Ich weiß nicht«, sagte ich in einem Anfall von Panik. Ich kenne ihn schon seit Jahrzehnten. Warum stellte er mir diese Frage?
»Sie wissen Ihren eigenen Namen nicht?«
»Ich weiß ihn. Ich vergesse ihn.«
»Warum klingen Sie so erschrocken?«
»Ich weiß nicht.«
»Dazu besteht keine Veranlassung«, sagte er, fegte den Staub sorgsam auf sein Kehrblech und schickte sich an, das Zimmer zu verlassen. »Wie auch immer, ich weiß Ihren Namen.«
Ich fing an zu weinen, nicht wie ein Kind, sondern wie die alte, alte Frau, die ich bin, langsame, leichte Tränen, die niemand sieht, die niemand trocknet.
Ehe mein Vater wusste, wie ihm geschah, brach der Bürgerkrieg über uns herein.
Ich schreibe dies nieder, um meine Tränen zu stillen. Ich stoße die Worte mit meinem Kugelschreiber in das Papier, als wollte ich mich selbst festheften.
Vor dem Bürgerkrieg gab es einen anderen Krieg, einen Krieg dagegen, dass das Land von England aus regiert wurde, aber in Sligo fanden keine größeren Kämpfe statt.
Ich zitiere Jack, den Bruder meines Mannes, wenn ich dies schreibe, oder zumindest höre ich aus meinen Sätzen Jacks Stimme heraus. Jacks verschwundene Stimme. Neutral. Wie meine Mutter war Jack ein Meister des neutralen Tonfalls, wenn auch nicht der Neutralität. Denn am Ende zog Jack sich eine englische Uniform an und kämpfte in jenem späteren Krieg – fast hätte ich gesagt, in jenem echten Krieg – gegen Hitler. Auch er war ein Bruder von Eneas McNulty.
Die drei Brüder Jack, Tom und Eneas. O ja.
Im Westen Irlands besteht der Name Eneas übrigens aus drei Silben: En-i-as. In Cork, fürchte ich, sind’s nur zwei, und es hört sich eher nach Anus an.
Aber der Bürgerkrieg wurde durchaus in Sligo und an der gesamten Westküste ausgefochten, mit grimmigem Eifer.
Die Freistaatler hatten den Vertrag mit England akzeptiert. Die sogenannten Irregulären hatten davor zurückgescheut wie Pferde vor einer zerstörten Brücke im Dunkeln. Denn der Norden des Landes war aus der ganzen Angelegenheit ausgespart worden, und ihnen kam es so vor, als sei ein Irland ohne Haupt akzeptiert worden, ein Torso, dem der Kopf abgeschlagen worden ist. Es war Carsons Bande im Norden, die sie weiterhin an England fesselte.
Es war mir stets ein Rätsel, weshalb Jack sich so stolz damit brüstete, ein Cousin von Carson zu sein. Aber das nur am Rande.
Damals herrschte in Irland viel Hass. Ich war vierzehn, ein Mädchen, das versuchte, in die Welt hinauszublühen. Überall Wut und Hass.
Lieber Father Gaunt. So darf ich Sie doch anreden? Nie zuvor hat ein so rechtschaffener und ehrlicher Mann einem jungen Mädchen so viel Schmerz zugefügt. Denn ich glaube nicht einen Moment lang, dass er aus böser Absicht gehandelt hat. Und doch hat er mich kujoniert, wie die Landbevölkerung es nennt. Und in der Zeit davor hatte er meinen Vater kujoniert.
Ich habe schon gesagt, dass er ein kleiner Mann war. Damit meine ich, dass sein Scheitel den meinen nicht überragte. Geschäftig, hager und gepflegt mit seinen schwarzen Kleidern und seinem kurz geschorenen Haar wie ein zum Tode Verurteilter.
In meine Gedanken drängt sich die Frage: Was meint Dr. Grene damit, dass er meinen Fall neu bewerten muss? Damit ich hinausgehen kann in die Welt? Wo ist diese Welt?
Er muss mich befragen, hat er gesagt. Hat er. Da bin ich mir sicher, und doch höre ich ihn so richtig erst jetzt, da er schon lange aus dem Zimmer ist.
Die Panik in mir ist schwärzer als abgestandener Tee.
Ich bin wie mein Vater auf seinem alten Motorrad, der, na klar, in rasendem Tempo dahinjagt, sich aber so am Lenker festklammert, dass er eine Art Sicherheit genießt.
Lösen Sie bloß nicht meine Finger vom Lenker, Dr. Grene, ich flehe Sie an.
Fort aus meinen Gedanken, guter Doktor.
Father Gaunt, eilen Sie herbei aus den Schlupfwinkeln des Todes, eilen Sie herbei und nehmen Sie seinen Platz ein.
Stellen Sie sich vor mich hin, während ich krickele und krakele.
Der folgende Bericht mag sich anhören wie eine der Geschichten meines Vaters aus seinem kleinen Evangelium, aber diese hat er nie so richtig zum Vortrag gebracht oder so ausgeschmückt, dass sie sich wie zu einem Lied rundet. Ich liefere Ihnen sozusagen die bloßen Knochen, mehr habe ich nicht zu bieten.
Im Lauf dieses Krieges gab es zweifellos viele Todesfälle, und viele Todesfälle, die eigentlich nichts anderes waren als Mord. Natürlich oblag es meinem Vater, einige von diesen Toten auf seinem schmucken Friedhof beizusetzen.
Mit vierzehn war ich noch halb Kind und schon halb Frau. Ich besuchte eine kleine Klosterschule und war durchaus nicht gleichgültig gegenüber den Jungs, die nach dem Unterricht am Schultor vorüberschlurften, ja, ich scheine mich sogar daran zu erinnern, dass ich glaubte, von ihnen steige eine Art Musik auf, eine Art menschlichen Gesumms, das ich nicht begriff. Wie ich darauf kam, von so rohen Gestalten Musik aufsteigen zu hören, weiß ich aus dem Abstand dieser Jahre nicht mehr. Aber das ist nun mal die Zauberkunst der Mädchen: Sie verwandeln bloßen Lehm in große, klassische Ideen.
So schenkte ich also meinem Vater und seiner Welt nur halbe Aufmerksamkeit. Ich war mehr mit meinen eigenen Mysterien befasst, etwa mit der Frage, wie ich meinen grässlichen Haaren Locken einbrennen konnte. Viele, viele Stunden mühte ich mich mit dem Krageneisen meiner Mutter ab, mit dem sie immer das Sonntagshemd meines Vaters bügelte. Es war ein schlankes, schmales Gerät, das sich auf der Kaminplatte rasch erhitzte, und wenn ich meine glatten gelben Strähnen auf dem Tisch ausbreitete, hoffte ich, durch Alchimie Locken in sie hineinzaubern zu können. So war ich von den Ängsten und Ambitionen meines Alters völlig in Anspruch genommen.
Dennoch hielt ich mich oft im Tempel meines Vaters auf, erledigte meine Hausaufgaben und genoss das kleine Kohlenfeuer, das er dank seiner Brennstoffbeihilfe dort unterhalten konnte. Ich lernte meinen Unterrichtsstoff und hörte ihm zu, wie er »Im Traume sah ich mich im Marmorsaal« oder dergleichen sang. Und sorgte mich um mein Haar.
Was würde ich heute für ein paar Strähnen dieses glatten gelben Haares geben!
Mein Vater beerdigte jeden, der ihm zur Beerdigung übergeben wurde. In Friedenszeiten beerdigte er meist die Alten und die Siechen, doch in Zeiten des Krieges wurde ihm häufig der Leichnam eines jungen Burschen oder eines nur unwesentlich Älteren gebracht.
Dies bereitete ihm einen Kummer, den er sich bei den Alten und Schwachen nie anmerken ließ. Deren Tod, so dachte er, war unkompliziert und hatte seine Richtigkeit, und ob die Familienangehörigen und die Trauergäste am Grab nun weinten oder stumm blieben, er wusste, dass alle das Gefühl angemessener Lebensdauer und Gerechtigkeit hatten. Oft hatte er die alte Seele, die beigesetzt werden sollte, persönlich gekannt und teilte Erinnerungen und Anekdoten, wenn es ihm tröstlich und angemessen erschien. In diesen Fällen war er eine Art Diplomat des Leides.
Doch die Leichen der im Krieg Gefallenen betrübten ihn sehr, und zwar auf andere Weise. Man könnte meinen, als Presbyterianer sei ihm in der irischen Geschichte kein Platz vergönnt gewesen. Doch Rebellion, das verstand er. In einer Schublade in seinem Schlafzimmer verwahrte er ein Gedenkbuch an den Osteraufstand 1916 mit Fotos der wichtigsten Teilnehmer und einem Kalender der Kämpfe und Kümmernisse. Das einzig Schlimme, das der Aufstand für ihn beinhaltete, war dessen eigentümlich katholisches Ethos, von dem er sich natürlich ausgeschlossen fühlte.
Es war der Tod der jungen Männer, der ihn betrübte. Immerhin waren seit dem Gemetzel des Ersten Weltkriegs nur wenige Jahre vergangen. Von Sligo aus waren in den Jahren vor und nach dem Aufstand Hunderte von Männern losgezogen, um in Flandern zu kämpfen, und da die in diesem Krieg Gefallenen nicht zu Hause begraben werden konnten, waren diese Dutzende Männer gewissermaßen in meinem Vater begraben, im geheimen Friedhof seiner Gedanken. Jetzt, im Bürgerkrieg, noch mehr Tote, und immer die Jungen. Jedenfalls gab es in Sligo keinen Fünfzigjährigen, der im Bürgerkrieg gekämpft hatte.

