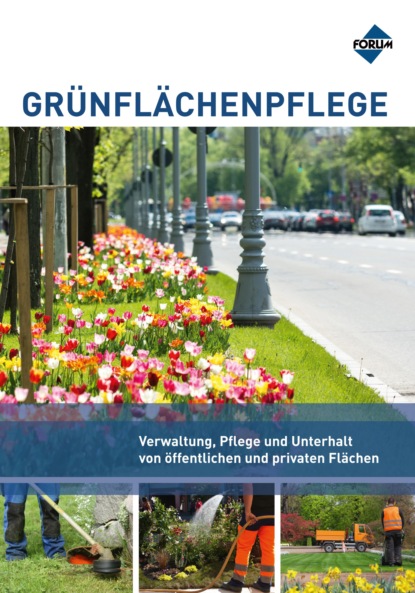- -
- 100%
- +
Internet: www.reform.at E-Mail: michaela.meister@kiefergmbh.de
Autorin des Kapitels „Geräte und Maschinen – Wartung“
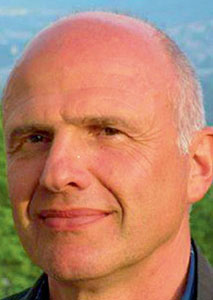
Volker Marwedel
Volker Marwedel ist gelernter Baumschuler und hat den Meister im Landschaftsbau 1989 gemacht. Er arbeitete 15 Jahre als Technischer Leiter in der Grünflächenunterhaltung und Baumpflege. Seit 2005 ist er Inhaber der Firma Marwedel Baum und Rasen. Er macht neben der klassischen Baumpflege Baumgutachten, Gehölzwertermittlungen und Baumkontrollen. Sein Wissen gibt er in Workshops, Seminaren und Fachartikeln weiter. Sein Motto: Erfolg ist, wenn sich Theorie und Praxis in der Mitte treffen.
Internet: www.baumundrasen.de E-Mail: info@baumundrasen.de
Autor des Kapitels „Sträucher und Gehölze“

Dr. Philipp Unterweger
Dr. Philipp Unterweger studierte Biologie, Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Tübingen und ist Mitbegründer der „Initiative Bunte Wiese“, einem bundesweiten Projekts zur Steigerung der Artenvielfalt auf Grünflächen. Unterweger promovierte über die Einführung eines insektenfreundlichen Grünflächenmanagements in Städten und erforschte dabei den Wert von Mahdreduktion für Insekten und kombinierte diese naturschutzfachlichen Ergebnisse mit sozialwissenschaftlichen Fragestellungen. Dabei lag sein Augenmerk auf Akzeptanz, Ästhetik und Zustimmung solcher Naturschutzprojekte bei den unterschiedlichen Nutzungsanliegern einer Stadt. Durch diese langjährige Arbeit bietet Philipp Unterweger Beratungen im Bereich der Biodiversitätsplanung an und ist als Autor tätig.
Internet: www.philippunterweger.de E-Mail: philipp.unterweger@biodiversitaetsplanung.de
Autor des Kapitels „Straßenbegleitgrün”

Kristian Onischka
Kristian Onischka ist leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit (staatl. anerkannt SMWA), Brandschutzbeauftragter, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator und FLL/BSFH zertifizierter „Qualifizierter Spielplatzprüfer“ der GAO – Gesundheits- und Arbeitsschutz Onischka UG (haftungsbeschränkt). Er kann auf verschiedenste Qualifikationen im Bereich des Arbeitsschutzes und der Arbeitswissenschaften zurückblicken. In den Themenfeldern Arbeitsschutz, Spielplatzmanagement und Spielplatzsicherheit ist er für verschiedene öffentliche Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen als Dozent und Referent tätig.
Internet: www.onischka.de E-Mail: info@onischka.de
Autor der Kapitel „Sicherheit und Arbeitsschutz” und „Geräte und Maschinen – Beschaffung“

Axel Raue
Axel Raue leitet seit 2010 den Osnabrücker Service Betrieb (OSB) und ist Geschäftsführer der Osnabrücker Kommunal Service GmbH mit weiteren Untergesellschaften. Der OSB hat sich über die Jahre zu einer Holding oder einer kleinen Unternehmensgruppe entwickelt. Der OSB ist ein kommunaler Dienstleister, vereint aber darüber hinaus auch die Fachlichkeit inkl. der Budgethoheit. Herr Raue ist weiterhin als Landschaftsarchitekt Präsidiumsmitglied der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (GALK e. V.); einer Plattform für Gartenamtsleiter aus bundesdeutschen Großstädten oder ähnlich konfigurierten Unternehmensformen.
Internet: www.osnabrueck.de/osb
Autor des Kapitels „Praxisbeispiel Osnabrücker Service Betrieb (OSB)“

Dr. Henrik Weiß, Dipl.-Ing. für Forstwirtschaft
1998 bis 2007 war Dr. Henrik Weiß wissenschaftlicher Assistent am Institut für Forstbotanik und Forstzoologie an der TU Dresden (Leitung Prof. Dr. Roloff) und u. a. für die Koordination des Forschungsprojekts „Entwicklung und Erprobung zerstörungsfreier Diagnosetechnik für die Baumpflege“ verantwortlich. Seit 2002 ist er Gutachter für Verwendung, Verkehrssicherheit und Wertermittlung von Gehölzen im Dendro-Institut Tharandt (An-Institut der TU Dresden). Außerdem ist er seit 2004 öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Gehölze, Schutz- und Gestaltungsgrün, Gehölzwertermittlung und Baumsanierung und Bewertung der Verkehrssicherheit. Henrik Weiß hat 2005 das Büro Baum & Landschaft gegründet.
Internet: www.baum-land.de E-Mail: info@baum-land.de
Autor des Kapitels „Baumkontrolle“

Karl Phillip Wiechardt und Patrick Stähr
(links: Patrick Stähr; rechts: Karl Phillip Wiechardt)
Karl Philipp Wiechardt schloss seine Ausbildung zum Abwassertechniker 2011 bei der Abwasserentsorgung Stade ab. 2013 übernahm er die Laborleitung und wurde 2015 2. Stellvertreter für den technischen Betrieb der Kläranlage mit Ausbaugröße von 200.000 EW. Im September 2015 gründete er zusammen mit Patrick Stähr die Firma Wiechardt & Stähr Teich- und Gewässerservice GbR.
Patrick Stähr begann seine Ausbildung zum Fischwirt (Schwerpunkt: Fischhaltung und Fischzucht) in Königswartha. Nach dem Abschluss der Berufsausbildung im Jahr 2010 war Herr Stähr als Mitarbeiter für das Institut für angewandte Ökologie in Marschacht tätig. Im September 2015 folgte die Gründung der Firma Wiechardt & Stähr Teich- und Gewässerservice GbR.
Internet: www.teich-und-gewässerservice.de E-Mail: service@wiechardtundstaehr.de
Autoren des Kapitels „Wasserflächen”
Grünflächenmanagement
Stadtgrün erfährt in Zeiten des Klimawandels und der Innenverdichtung einen bedeutenden Wertezuwachs. Die verantwortlichen Politiker, Ämter und Bauhöfe sowie die beauftragten GaLaBauer, Gärtner und Hausmeister werden nicht nur mit dem steigenden Nutzungsdruck konfrontiert, sondern auch mit der Frage, wie zeitgemäße Grünanlagen ausgestattet sein müssen, und mit welchen Methoden, die Pflege und Unterhaltung der Grünflächen bei anhaltendem Kostendruck und Personalmangel gemanagt werden kann. Der Aufbau eines effizienten Grünflächenmanagements ist die pragmatischste Methode, die finanziellen und personellen Möglichkeiten darzulegen und transparent zu machen, gewünschte Qualitätskriterien für das Stadtgrün zu formulieren, sowie Planung und Grünflächenunterhaltung wirtschaftlich zu steuern.
Bausteine des Grünflächenmanagements
Häufig gestellte Fragen rund um den Aufbau eines Grünflächenmanagements sind u. a.:







Für die Entwicklung eines effizienten Grünflächenmanagements müssen verschiedene Bausteine erarbeitet und ineinander verzahnt werden. Dazu zählen



Datenerfassung und Grünflächeninformationssystem (GRIS)
Die Erfassung der objekt- und anlagebezogenen Daten mit Angliederung an ein Betriebssteuerungssystem (GRIS) erfordert während der Aufbauphase einen hohen Aufwand, der sich jedoch in der anschließenden Fortschreibung erheblich reduziert.
Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Die Erfassung aller objektbezogenen Flächeninhalte und Daten sowie der dazu gehörigen Tätigkeiten schafft Transparenz in den Kosten und Arbeitsabläufen. Wirtschaftliches und organisatorisches Optimierungspotential wird sichtbar und kann gezielt in profitablere Umsetzungsmechanismen gelenkt werden.
Mit welchen Gruppengrößen, Tourenplänen, Maschineneinsatz und Werkzeugen können die anfallenden Arbeiten am effizientesten bewältigt werden? Welche eigenen Zeitwerte stehen hinter den zu erledigenden Aufgaben? In welchem Verhältnis steht der geplante zum tatsächlichen Mitteleinsatz? Wie können Arbeitsprozesse verändert werden, um befriedigendere Ergebnisse zu erzielen?
Auch bezüglich der Planung sind Kostenszenarien mit unterschiedlich simulierten Qualitätsstandards und Ausstattungen als Entscheidungsgrundlage für zukünftige Entwicklungen möglich. Nicht nur bei Neuplanungen, sondern bei der Revitalisierung des Bestandes ist das eine wichtige Komponente, um die Grünflächen im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zu pflegen und unterhalten zu können.
Grundbestandteil des GRIS ist das Grünflächenkataster, in dem alle Flächen sowie deren Inhalte wie Wege, bauliche Elemente, Ausstattungen oder Vegetation erfasst werden.
Die Verknüpfung des GRIS mit dem geographischen Informationssystem (GIS) gehört zum heutigen Standard, wobei es wichtig ist, dass die Sachdaten des GRIS unabhängig vom GIS abgelegt werden können. Diese ermöglicht spätere Änderungen des GIS ohne Daten- und Funktionsverlust. Die Daten für das Grünflächenkataster lassen sich aus unterschiedlichsten Quellen wie z. B. aus Luftbildern oder digitalen Plänen generieren. Es empfiehlt sich eine Analyse sämtlicher Daten im Vorfeld der Erfassung zu machen, um den Vorgang so effizient wie möglich zu gestalten.
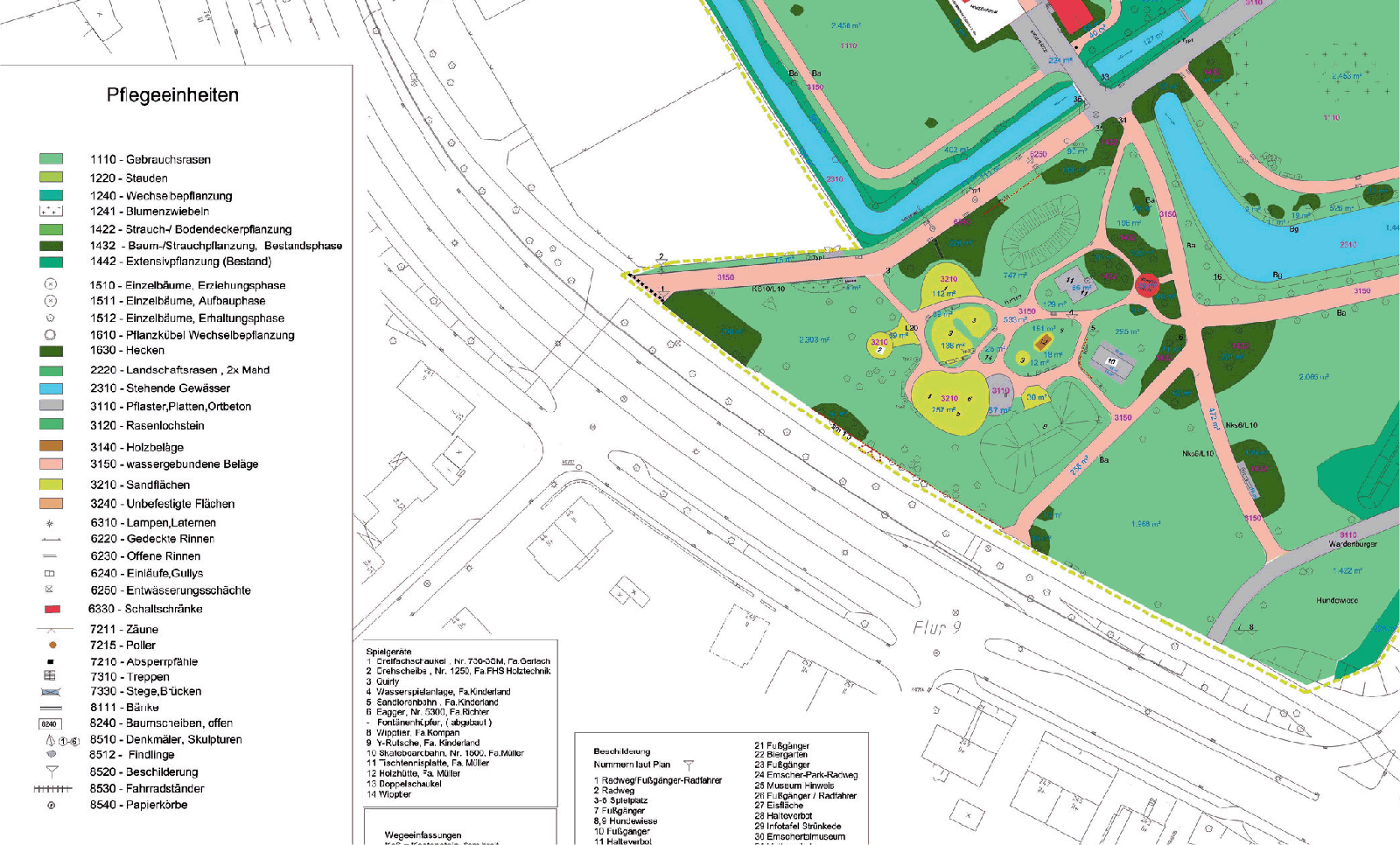
1 Darstellung der Pflegeeinheiten am Beispiel der Stadt Herne © Stadt Herne FB Stadtgrün
Erfolgt die Erfassung der Bestände auf der Basis georeferenzierter Luftbilder mit geeigneter Auflösung, so ist ein guter Zeitraum Ende März bis Anfang April (je nach jahreszeitlicher Entwicklung), wenn die Vegetations- und Rasenflächen gerade austreiben. Der Austrieb lässt dann eine feine Differenzierung der Vegetation zu, sodass ein Großteil der Flächen aus einem guten Luftbild gewonnen werden kann. Der Himmel sollte wolkenlos und klar sein, Schlagschatten lässt sich in den frühen Vormittagsstunden und nach 14 Uhr vermeiden. Die Befliegung mit Drohnen und der maßstabsgetreuen Verarbeitung der Aufnahmen ergibt sogar bessere Ergebnisse, da unterschiedliche Flächeninhalte auf den Fotos besser erkennbar sind, und damit Zeit für die sonst notwendige Auswertung vor Ort gespart werden kann.
Mit viel Sorgfalt muss die Festlegung der aufzunehmenden Inhalte des Objektartenkatalogs erfolgen, da auf dieser Grundlage die Pflegepläne erstellt werden. Der FLL-Objektartenkatalog Freianlagen (OK FREI) (entspricht DIN 276-1 Kosten im Bauwesen) oder die GALK-Empfehlung für eine Grünflächendatei haben sich als Vorlagen gut bewährt. In der Praxis werden die Inhalte (Flächenschlüssel) gemeinsam mit den administrativ Verantwortlichen und Mitarbeitern vor Ort erarbeitet. So wird gewährleistet, dass die Arbeiten von den Praktikern während der Eingabe genau zugeordnet und für die Auswertungen erfasst werden können.
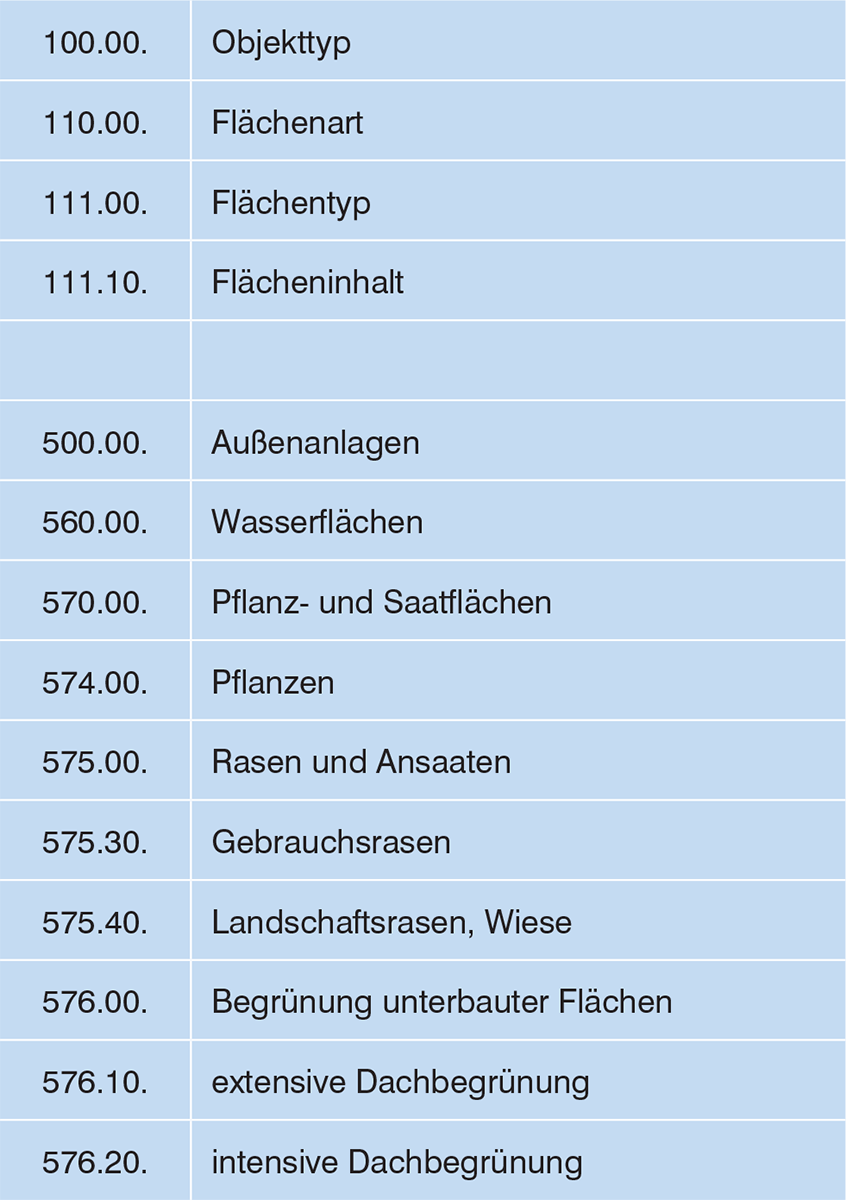
2 Beispiel für einen Objektartenkatalog
Der Personal- und Kostenaufwand ist trotz der geschilderten Vorteile des Betriebssteuerungssystems erheblich und von den jeweiligen Flächengrößen und Ansprüchen der Betreiber abhängig. Die Beauftragung von externen Büros kann den Personalaufwand reduzieren. Sie entbindet jedoch nicht von der Steuerung durch ein Projektteam während der Aufbauphase. Für die spätere Projektbetreuung wird mindestens ein kompetenter Ansprechpartner benötigt. Werden die Aktualisierungen des Datenbestandes extern erledigt, entfällt der ansonsten dafür benötigte Personalaufwand, der in Abhängigkeit des zu bewältigenden Pensums eine halbe bis ganze Stelle oder auch mehr betragen kann. Ist der Anfang erst einmal gemacht, wird der Nutzen eines GRIS für die effiziente Bewirtschaftung jedoch immer deutlicher, zum Wohle der transparenten und werterhaltenden Grünflächenpflege und Unterhaltung. Der Aufwand kann an anderer Stelle wieder eingespart werden kann.
Qualitätsmanagement
Die Formulierung der Qualitätskriterien für den gesamten Grünbestand ist ein weiterer wichtiger Baustein des effizienten Grünflächenmanagements. Denn damit wird zwischen Politik, Verwaltung und Ausführenden vereinbart, welche Standards mit welchem Pflege- und Unterhaltungsaufwand wünschenswert wären bzw. überhaupt finanziell geleistet werden können.
Pflegekategorien (Service Level)
Üblicherweise werden bis zu fünf Pflegekategorien (Service Levels) formuliert. Die Klassifizierung erfolgt nach den individuellen Ansprüchen jeder Kommune.
Sie richtet sich nach






Die folgenden beispielhaften Ausführungen werden auf Basis von drei Pflegekategorien erläutert.
Wie in Abbildung 3 dargestellt, nehmen die Bedeutung, Hochwertigkeit der Ausstattung und Pflegeintensität von Pflegekategorie (PK) 1 bis 3 ab. In der Praxis bedeutet dies, dass einige Grünanlagen noch in die zugeordnete Kategorie entwickelt werden müssen, weil sie sich noch nicht in dem gewünschten Ausstattungsgrad befinden. Beispielsweise kann in den Pflegkategorien 2 und 3 kein Wechselflor vorgesehen sein, sondern pflegeleichtere Vegetationstypen wie extensive Staudenbepflanzungen, Blumenwiesen sowie einheimische Gehölze.
Im Rahmen der Klassifizierung sollte als Ziel immer angestrebt werden, die Anlagen der einzelnen Kategorien so zu gestalten und auszustatten, dass sie trotz reduziertem Pflegeaufwand ihre Funktion erfüllen und eine werterhaltende Weiterentwicklung gewährleistet ist. Auf der Grundlage von Pflege- und Entwicklungsplänen mit Kostenaufstellungen, können so Prioritäten für die kurz-, mittel- und langfristige Realisierung gesetzt werden.
Sind die Qualitätsziele abgestimmt, werden sämtliche Freiflächen-Typen wie z. B. Friedhöfe, Parkanlagen, Spiel- und Sportplätze, Straßenbegleitgrün, Naturschutzgebiete etc. den jeweiligen Kategorien zugeordnet.
Im Modellprojekt Grünpflege-Konzept (Abbildung 7) ist eine beispielhafte Aufteilung schematisch dargestellt. Pflegekategorie 1 nimmt hier den geringsten prozentualen Anteil ein, gefolgt von Pflegekategorie 3. Der Löwenanteil ist für Anlagen der Kategorie 2 vorgesehen. Durch geschicktes Umschichten kann diese Verteilung im Bedarfsfall verändert werden.
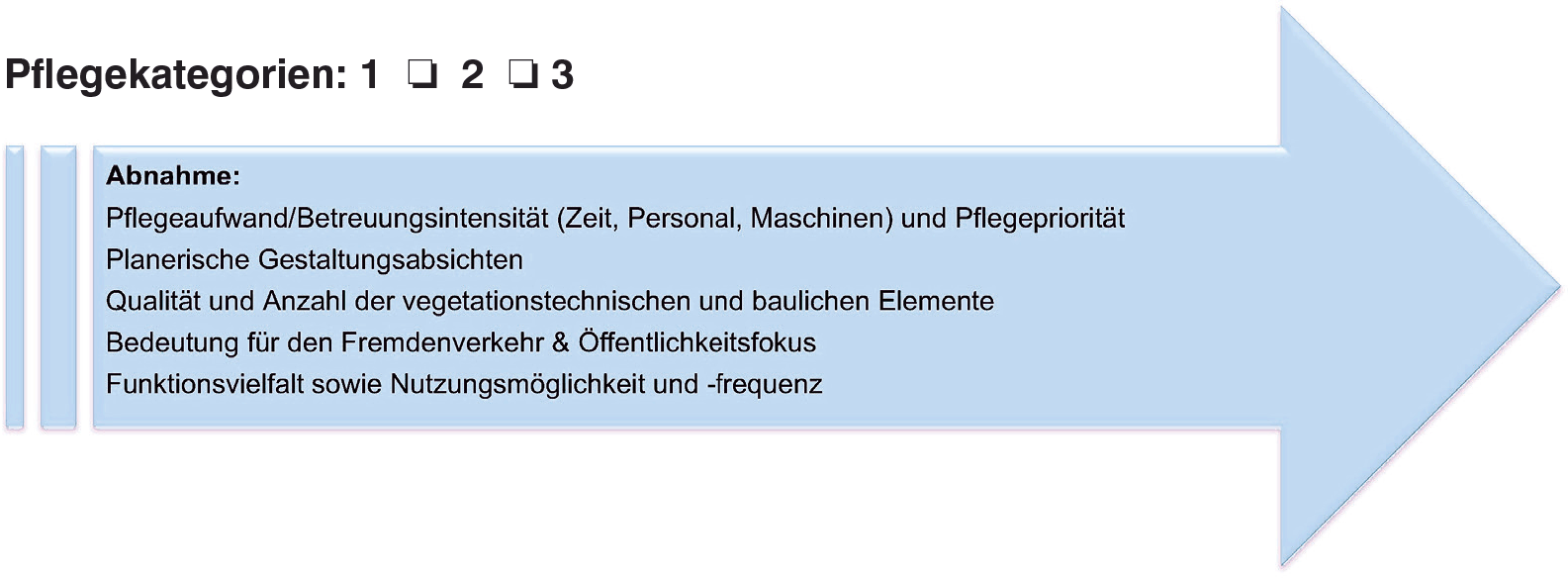
3 Hierarchie der Pflegekategorien © Monika Böhm
Zur Pflegekategorie 1 zählen repräsentative Anlagen mit großer Bedeutung für externe Besucher und Bürger. Die Qualitätsmerkmale sind pflegeintensive Flächeninhalte wie Rosen, Stauden und intensiv gemähte Rasenflächen. Die Gestaltung, Vegetation und Ausstattungsgegenstände sind hochwertig und differenziert, in gleichem Maße die Aufenthaltsqualität und Erholungsfunktion. Die Anlagen werden zum Teil stark genutzt und beansprucht. Die Ansprüche an den Pflegezustand und die Sauberkeit liegen im oberen Level.


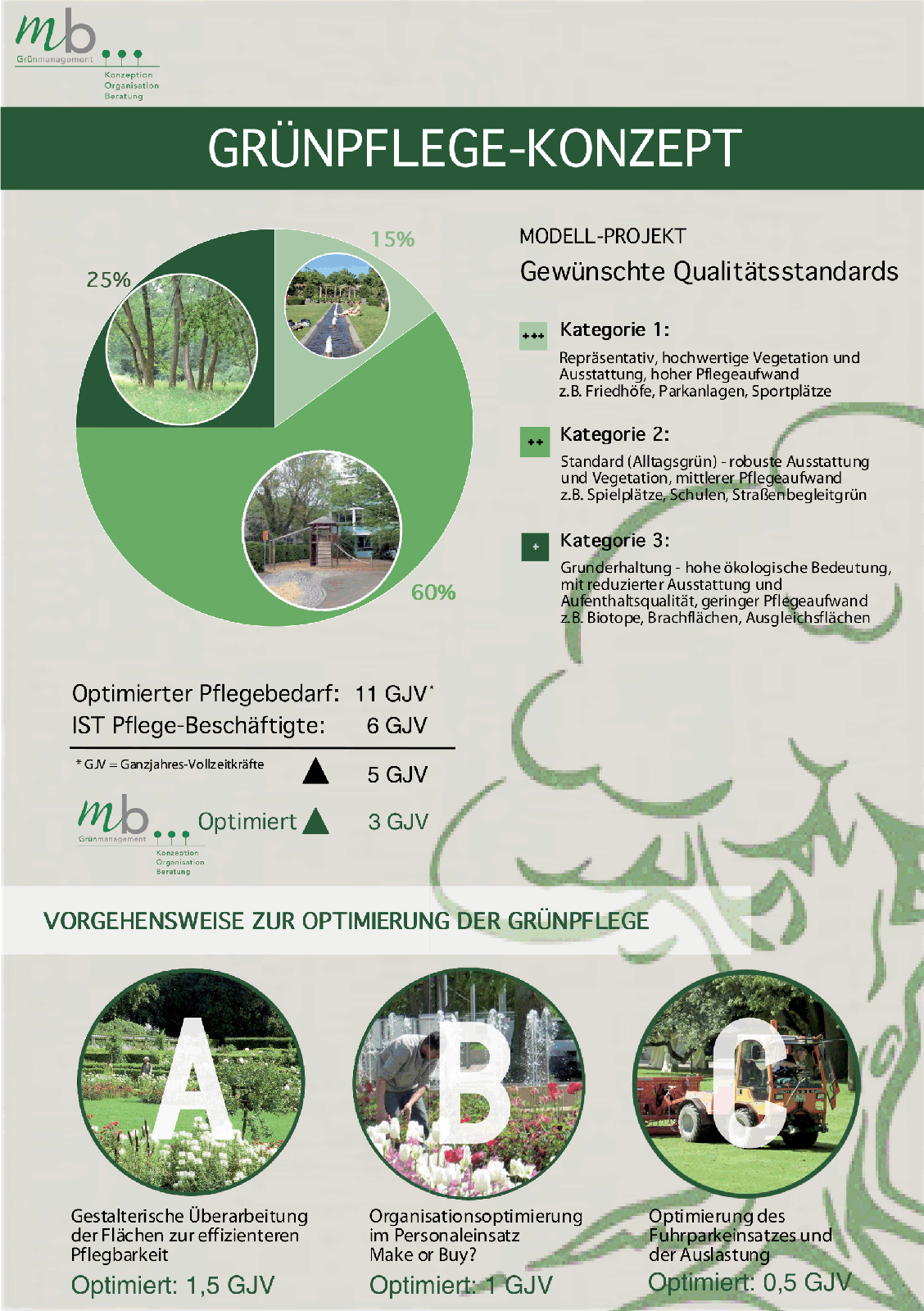
7 Anhand des Modell-Projektes für ein Grünpflege-Konzept wird deutlich, dass verschiedene Faktoren (Planung sowie Optimierung der Organisation und des Fuhrparks) die zukünftige Pflege sowie den dafür notwendigen (Personal-)Aufwand beeinflussen. © Monika Böhm
Jahrespflegepläne
Auf Grundlage der Qualitätsziele werden Jahrespläne für die fach- und normgerechte Pflege und Unterhaltung formuliert. Zuvor müssen gemeinsam mit den verantwortlichen Mitarbeitern der Grünpflege die aktuell durchgeführten Arbeiten erhoben werden. Dieser Prozess ist deshalb so wichtig, weil die Arbeiten häufig nur in den Köpfen existieren. Durch die Dokumentation werden die Arbeiten strukturiert und Denkprozesse hinsichtlich der Arbeitsorganisation angestoßen. Der Objektartenkatalog Freianlagen der FLL, Stand 2016, dient hier als Vorlage, muss aber auf die Anforderungen des jeweiligen Betreibers angepasst werden.
Neben der Strukturierung der Arbeitsabläufe dienen die Pflegepläne auch als Argumentationsgrundlage für die Durchsetzung von Prioritäten im Tagesgeschäft, wenn Aufträge auf Zuruf drohen, überhand zu nehmen.
Häufig klaffen die tatsächlich durchgeführten und die zur Werterhaltung notwendigen Maßnahmen mehr oder weniger auseinander.
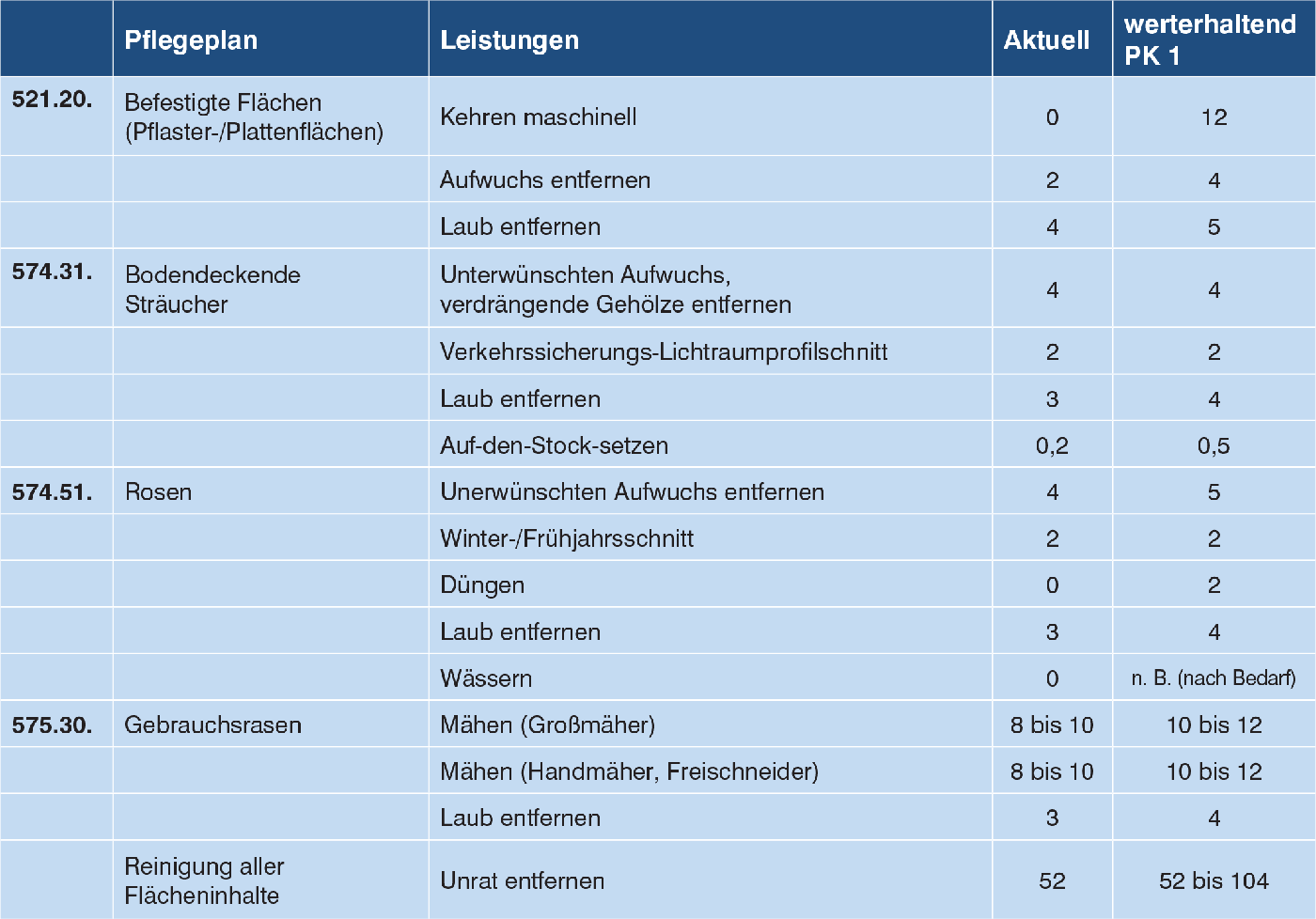
8 Ausschnitt eines Pflegeplans mit aktuellen und werterhaltenden Pflegestandards. © Monika Böhm
Empfehlung
Eine überschaubare Anzahl von Testflächen aller Pflegekategorien begutachten, um den Pflegezustand mit den derzeit durchgeführten Maßnahmen in Bezug setzen zu können.
Qualitätsbeurteilung ausgewählter Anlagen
Beurteilt werden bei der Begutachtung vor Ort neben der Funktionsfähigkeit und Gestaltung die Pflegezustände sämtlicher Flächeninhalte auf Basis der zukünftig gewünschten Qualitätsansprüche (Pflegekategorien). Erfahrungsgemäß sind immer wieder folgende Phänomene festzustellen:


– Die fachgerechte Reinigung und Instandhaltung der Wege wird vernachlässigt oder mit ineffizienten Methoden durchgeführt.
– Die Möblierung ist vernachlässigt, häufig sind Standorte unbefestigt.
– Die Gehölzpflege wird zu selten oder nicht fachgerecht durchgeführt. Bevorzugt wird der „Bubikopf-Schnitt“ anstelle eines fachgerechten Auslichtungs- und Verjüngungsschnittes angewendet.
– Pflanzlücken führen zur Degenerierung der Vegetation und erhöhen den Pflegeaufwand. Der Aufwand für die Pflege von Flächen mit mehr als 20 % Pflanzlücken steigt im Gegensatz zu lückenlos geschlossenen Flächen um das Fünffache an.


– Ungeeignete Pflanzenauswahl
– verwinkelt geplante und damit pflegeaufwendige Situationen auf Wegen und Rasenflächen
– ungeeignete Ausstattungen in stark genutzten Anlagen

9 Unbefestigte Bankstandorte sind pflegeaufwendig und werden häufig übersehen. © Monika Böhm