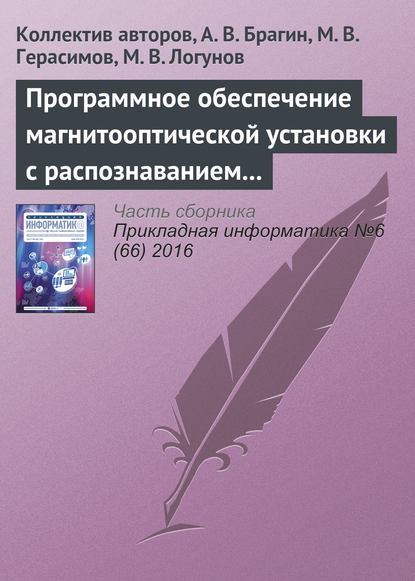Seewölfe - Piraten der Weltmeere 727

- -
- 100%
- +

Impressum
© 1976/2021 Pabel-Moewig Verlag KG,
Pabel ebook, Rastatt.
eISBN: 978-3-96688-149-4
Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de
Sean Beaufort
Höllischer Spuk und lautloses Verschwinden terrorisieren die Crew
Der Anführer der Küstenpiraten spielte mit der Spitze seines Krises und dachte an das Meer, an den Kampf, die Beute und die vielen Schiffe der Fremden, der Weißhäutigen, die den Reichtum vieler Küsten, vieler Inseln und auch seiner Heimat davonschleppten – in Länder, die er nie kennenlernen würde.
Je länger er nachdachte – und er überfiel schon seit Jahren die Fremden –, desto mehr stieg seine Wut.
Entweder starben er und seine mutigen, treuen, rücksichtslosen Kerle. Oder sie wurden zu reichen Männern. Er richtete sich auf und knurrte heiser wie ein gereizter Hund: „Auch das nächste Schiff, das hier vorbeisegelt, wird seinen Hafen nicht mehr erreichen. Tod den Fremden!“ Und nach einem Atemzug fügte er hinzu: „Und für uns die Beute …“
Die Hauptpersonen des Romans:
Djongrang – der Kapitän einer Piraten-Balor und dreier Piahiap-Boote wittert fette Beute, als der Ausguck eine tiefgeladene Fleute sichtet.
Pieter Heemskerk – der Kapitän der „Vlissingen“ sieht Holland nicht wieder – ein malaiischer Speer tötet ihn.
Frans z’Waele – sein Erster Offizier wehrt erbittert die Angriffe der Djongrang-Piraten ab, aber dann strandet die „Vlissingen“.
Philip Hasard Killigrew – als der Seewolf ein halbverbranntes Wrack sichtet, fühlt er sich verpflichtet, den Überlebenden zu helfen.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
1.
Sungh Ay drehte langsam den Kopf. Die großen, fast schwarzen Augen schienen plötzlich zu leuchten. Aber es waren die Strahlen der Nachmittagssonne, die bernsteinfarben in seine Augäpfel stach. Sunghs bloße Sohlen standen auf der obersten Sprosse der winzigen Bambusplattform, die, unsichtbar von See aus, sich in der Krone eines uralten, mächtigen Teakbaumes versteckte.
Drei kleine Segel konnten Sungh Ays scharfe Augen entdecken. Sie bewegten sich auffallend langsam vor der Nordspitze der Insel auf Nusa Penida zu.
„Faule, arme, stinkende Fischer“, sagte er, schlug nach Stechmücken und spuckte zwischen den dicken, dichtbelaubten Ästen hindurch.
Der Baum hatte seine riesigen Wurzeln weit nach allen Seiten ins Erdreich gekrallt. Geradeaus, wo eine Felswand von der schäumenden Brandung umspült wurde, dümpelte die Balor am Anker und zwei Landleinen. Eine lange Planke knarrte zwischen dem Felsen und dem Heckschanzkleid. Die drei schlanken Piahiap-Boote waren halb auf den Sand gezogen. Zwischen den Resten der Feuer schliefen einige der Männer. Sie waren satt und hatten die Vorräte des Palmweins halbiert.
Djongrang kauerte im Bug der Balor und zog einen flachen Stein über die breite Schneide des Haumessers. Ab und zu tauchte er den Stein in das Wasser der Tonschale und schliff die Schneide, die schon scharf wie ein Fluch war, ununterbrochen weiter, mit ruhigen, gleichmäßigen Bewegungen seines muskulösen Armes.
Hin und wieder warf der Kapitän einen langen Blick hinauf zum Ausguck. Sungh Ay kletterte die Bambusleiter wieder hinunter und setzte sich auf die Matten, die über der Plattform aus dicken Bambusstücken lagen. Es blickte auf die See hinaus. Das riesige Gestirn näherte sich dem dunklen Schattenriß der Insel, die vor der westlichen Spitze Komodos lag. Über der Kimm flammten die riesigen, langgezogenen Wolken auf. Langsam verging die Zeit.
Eine halbe Stunde später hörte Sungh Ay die Stimme des Mannes, dem die „Perle der Brandung“ gehörte.
„Nichts entdeckt, Ay?“
Der Ausguck beugte sich weit vor, winkte träge und rief zurück: „Nur Fischer! Keine Beute, Djongrang! Nicht heute nacht.“
„Warte ab. Auf unserer Seite ist die Zeit. Wir können warten. Die Weißhäutigen haben Eile. Schlaf nicht ein. Ich schicke dir in einer Stunde Batak. Er sieht mehr als du.“
Ay lachte und antwortete: „Aber nur im Dunkeln, Kapitän.“
Djongrang fuhr fort, seine Waffe zu schärfen, die fast so lang wie sein Arm war.
Die Bucht, in der die Balor und die drei Boote versteckt waren, war winzig. Aber sie stellte einen idealen Schlupfwinkel dar, auch wenn die Besatzung größer gewesen wäre. Mit sechsunddreißig Männern waren sowohl die beiden schnittigen Boote als auch die Balor gerade richtig bemannt. Auch alle Waffen, Werkzeuge und ebenso die Geräte, die man brauchte, um auf See als Fischer zu gelten, wurden richtig geführt. Fünfhundert Schritte landeinwärts hatte eine Dschungelquelle einen winzigen See gebildet, der frisches Süßwasser lieferte. Was man sonst brauchte, Früchte und Wild, gab der Wald her.
Aus dem Inneren der Insel wagte sich niemand in diesen abgeschiedenen Teil. Die wenigsten Bewohner Komodos kannten die Bucht. Manchmal hatte sich ein einzelner Fischer vor dem Sturm hierhergeflüchtet. Als die malaiischen Piraten durch einen Zufall die Bucht im Schatten der hohen Bäume gefunden hatten, entdeckten sie Bootsplanken, Reste von Feuern und Fischgräten, aufgeschlagene Kokosnüsse und verwickelte Leinen in einem Gewirr von Tang.
Sungh Ay blinzelte wieder in dem grellen Licht. Die Fischerboote waren nach rechts weitergezogen. Der riesige Ausschnitt des Meeres lag leer da. Auf den ruhigen Wellen leuchteten die Funken des Sonnenlichts, das sich langsam dunkler zu färben begann. In drei Stunden würde nach einer kurzen, mit riesigen Wolkenbergen aufflammenden Abenddämmerung die Nacht einsetzen.
„Aber heute nacht kann ich ruhig schlafen“, murmelte der Ausguck.
Er packte den Wassersack, nahm einen langen Schluck und rieb sich mit ein paar Handvoll Wasser die Stirn und die Augen ab. Er zwinkerte und versuchte, auf der riesigen, fast unerträglich hellen Fläche das zu erkennen, was sie alle sehen wollten und auf das sie warteten.
Beute. Die Schiffe, die sich von den reichen, fernen Molukken-Inseln, von den Goldbuchten und Schatzküsten näherten und mit gefüllten Laderäumen auf dem langen Weg in ihre Heimatländer zurücksegelten. Sungh Ay dachte das gleiche wie der Kapitän der „Perle“. Noch ein halbes Dutzend Jagden auf die Fremden, noch zwei oder drei Portugiesen oder Holländer mit vollen Truhen und schweren Säcken – und jeder der lauernden Piraten war in seinem Heimatdorf ein Fürst, dessen Reichtum sprichwörtlich sein würde.
Sunghs Gedanken an Gold und Sklavinnen, die zur Musik tanzten, wurden unterbrochen. Batak kletterte am Stamm und den schmalen Leitern aus Bambus und Lianenknoten aufwärts. Die Plattform schwankte, als die erste Brise des Abendwindes den Baum traf und die Blätter rascheln ließ.
„Ich bin’s, Ay“, sagte Batak und zog sich auf die Plattform. Er rückte das zusammengedrehte Tuch, das er über der Stirn trug, zurecht. „Nichts zu sehen?“
Ay grinste ihn an. Bataks Arm schlüpfte aus der Schlinge, an der er einen schlanken Krug um die Schulter hängen hatte.
„Nichts. Keine fetten Holländer.“
„Einen Schluck? Vom Faß der toten Ungläubigen?“
„Immer. Ich brauche meine Augen nicht mehr offen zu halten“, sagte Sungh und trank mit kleinen Schlucken aus dem kühlen Gefäß. „Ich glaube nicht, daß du heute etwas entdeckst. Ich bin hungrig.“
„Am Feuer ist genug für zwanzig Hungrige“, sagte Batak und nahm ihm den Krug ab. „Alles frisch.“
„Ist gut.“
Sie nickten einander zu. Sungh Ay warf seinen Wassersack über die Schulter und kletterte hinunter. Als er in den warmen Sand sprang, schaute er sich schweigend um. Außer ihm, dem Kapitän und Batak schienen sich alle anderen Männer in den Schatten verzogen zu haben. Aus verschiedenen Richtungen hörte Ay tiefe Atemzüge und rasselndes Schnarchen.
An die zwölf Bambushocker umstanden, tief in den Sand eingedrückt, die schwärzliche Glut unter dem Kessel. Rechter Hand steckten im nassen Sand, über der Hochwasserlinie, zwei Dutzend große Tonkrüge. Es war der Frischwasservorrat für die Besatzungen. Djongrang führte, was das Lager, die Schiffe und das Segeln betraf, eine strenge Herrschaft. Sonst konnten seine Männer tun und lassen, was sie wollten.
Sungh Ay setzte sich, schöpfte einen Becher voll vom starken Kräutersud aus dem Kessel und trank schweigend. Seine Blicke huschten über den Strand, über die kleinen Wellen der zischend auslaufenden Brandung und über die langen Schatten, die Rümpfe und Masten der Boote über den Strand warfen. Noch immer schliff Djongrang seine Waffe. Das Geräusch schnitt wie ein Messer durch die Stille.
Sungh fand warmen Reis, eine dicke Soße und kaltes Fleisch, gewürzte Stücke Fisch und eine Schale voller zerschnittener Früchte und Markfasern, die er eintunkte und langsam aß. Dann reinigte er die Gefäße im Salzwasser, spülte sie im Süßwasser und hängte sie auf das Bambusgitter, die Öffnungen nach unten.
Er stocherte mit einem Holzspan in den Zähnen und ging langsam über den Steg aufs Deck der Balor. Vor dem Kapitän blieb er stehen und sah zu, wie Djongrang mit einem schmutzigen Fetzen Tuch Kokosöl auf das funkelnde Haumesser verrieb und die Schneide hingebungsvoll polierte.
„Du hast offenbar viel vor, Kapitän?“ Sungh grinste und spuckte über Bord.
„Wenn nicht heute nacht, dann morgen oder übermorgen“, erwiderte der andere und grinste breit. „Oder glaubst du nicht mehr daran, daß wir Beute haben werden?“
„Natürlich glaube ich’s“, sagte Ay. „Wir müssen doch etwas dagegen unternehmen, daß die Fremden alle Inseln ausplündern, ohne daß wir es ihnen erlaubt haben.“
Sungh wußte es, ohne daß er hinzusehen oder gar den Kopf zu drehen brauchte: vom Bugspriet und der geschnitzten Maske des Vorstevens bis zum Ruder war die „Perle der Brandung“ mit größter Sorgfalt aufgeklart. Ein paar Befehle und einige Handgriffe genügten, und die Balor sowie die drei Boote legten ab und verließen das Versteck. Selbst die Bändsel, mit denen die Bambusspeere innen am Schanzkleid befestigt waren, zeigten die beste Art der Knoten.
Die Matten und Decken, die der Mannschaft zum Schlafen dienten, lagerten, eng zusammengerollt, in den Bambusverschlägen, in denen sich auch die kleinen Krüge mit dem minderwertigen Palmöl und dem dünnen Erdpech befanden.
„Oder wollen wir nach Norden, zu den Fischerweibern?“ fragte der Kapitän.
Sungh schüttelte den Kopf. „Nicht heute nacht. Ich bin müde. Was die anderen wollen, weiß ich nicht.“
Djongrang schob seine Waffe in eine zwei Hände breite Lederscheide und knotete die Riemen bedächtig an einer Traverse des Bugspriets fest.
„Die anderen, die kannst du hören. Sie schlafen. Gestern nacht ist es wild hergegangen.“
„Die Singaradja-Fischer, die Holzsammler und Waldjäger haben ein großes Fest gefeiert. Die Trommeln haben wir ja bis hierher gehört.“
„Deswegen sind sie so müde“, bestätigte der Kapitän.
Er enterte in die dunkle Tiefe des Schiffsrumpfes ab und kehrte mit einem Krug und zwei Schalen zurück. Auf dem dreieckigen Deck aus dicken, sorgfältig verfugten Planken, das bis fast zum Mast reichte, lag eine dicke Matte. Die Männer lehnten sich gegen das Schanzkleid und tranken.
„Von allem, was die Fremden mitbringen, ist dieser Saft, den sie ‚Wein‘ nennen, das zweitbeste“, sagte Sungh schließlich.
„Ihre Musketen, Pistolen und Feuerrohre sind das beste. Aber wir haben zu wenig von dem schwarzen Pulver und von den großen Kugeln erbeutet. Wir müssen beim nächsten Kampf unbedingt darauf achten. Wenn wir ihre Hälse durchgeschnitten haben“, der Kapitän führte eine entsprechende Geste unter dem Kinn durch, „und wenn das Schiff nicht wieder brennt, durchsuchen wir jeden Verschlag, gleichgültig, ob es eine Fleute oder eine Karavelle ist.“
„Ich habe das alles schon mit Romlok, Sen Phu und Thbong besprochen. Sie wissen, was zu tun ist.“
„Gut. Einverstanden.“
Hin und wieder hoben sie ihre Köpfe und blickten über das Steuerbordschanzkleid aufs Meer. Die Segel der Fischerboote waren verschwunden. Die Wolken begannen sich gelb, rot und braun zu färben. Am Himmel waren nur Kormorane, Reiher und Fischadler und über dem ruhigeren Wasser der Bucht ein paar Seeschwalben zu sehen, die nach Mücken jagten. Weit und breit kein Schattenriß mit großen, dreieckigen Segeln, der irgendwo aus der Richtung auftauchte, wo sich die Inseln von Pulau Kalaotoa hinter dem Horizont versteckten.
Schließlich, als er die Wirkung des warmen Weines zu spüren glaubte, sagte Sungh Ay halblaut: „Ich lege mich achtern hin. Wenn wirklich ein Fremder auftaucht, brauche ich nicht lange. Du weckst mich, Djong?“
Djongrang lachte schallend und versicherte: „Ich habe dich ganz schnell wach. Schneller als die anderen. Verlaß dich drauf.“
Sie nickten sich zu. Ay leerte die Schale und rollte auf den warmen Heckplanken die dicke Matte aus, zog ein dünnes Tuch über seinen Kopf und war nach wenigen Atemzügen eingeschlafen. Als er wieder aufwachte, hatte sich rund um ihn eine Unruhe ausgebreitet, die nur eine Bedeutung haben konnte.
Als er es nicht mehr aushielt, ins grelle rote Licht zu starren, drehte Batak wieder den Kopf und schaute nach Norden. Der Baumwipfel bewegte sich leicht im Wind, der jetzt aus Osten wehte, aus dem Inneren der Insel. Bisher hatten weder Sungh Ay noch Batak mehr gesehen als Einbäume und kleine Segler, einige langsame Lastschiffe, die dicht an den Ufern segelten und keinen Überfall lohnten. Die Seeleute waren noch ärmer als die Fischer.
Batak spürte die letzte Wärme der Sonnenstrahlen auf den Schultern und auf dem Hals. Er starrte durch die raschelnden Blätter, und plötzlich sah er fast am Rand des Blickfeldes, rechts vor der niedrigen Huk, eine Unterbrechung der Kimmlinie.
„Das ist kein Fischer“, murmelte der Späher. „Eine ganz andere Farbe.“
Er schloß die Augen, holte tief Luft und wartete eine Weile. Dann blickte er wieder in dieselbe Richtung. Aus dem ungewissen Punkt war ein Dreieck geworden. Ein bräunliches, großes Segel, das unverkennbar zu einem Schiff der Fremden gehörte. Batak wollte sicher sein und wartete.
Fast unmerklich langsam wurde das Bild deutlicher. Nichts veränderte sich, als er zum zehntenmal hinblickte. Er sah den Rumpf und erkannte die Form jener Schiffe, mit denen die Holländer segelten. Wie nannten sie ihre großen Kanus?
„Richtig, Fleute“, sagte er und versuchte die Entfernung genau abzuschätzen. Er sah die schäumende Bugwelle, das Flattern der ausgebleichten Flagge, und ganz winzig erkannte er ein paar Gestalten auf dem hochgezogenen Achterdeck. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr. Die Sonne war halb hinter die Kimm getaucht und überschüttete die Bucht, das Meer und auch das große Dreiecksegel des Fremden mit ihrer blutigroten Farbe. Batak beugte sich vor, steckte zwei Finger in den Mund und pfiff dreimal scharf und gellend.
„Ja?“ rief Djongrang, der neben dem Feuer stand. Er hob den Kopf. Batak winkte und deutete nach Nordosten.
„Ein Schiff! Von Nordosten. Ich hab’s genau gesehen. Von uns etwa vier Stunden weit weg, Kapitän.“
„Kannst du genau sehen, wie tief es liegt?“
„Nicht gut, Djong. Wenig Licht. Aber …“ Er strengte sich an, im letzten Licht etwas zu sehen und glaubte zu erkennen, daß der Rumpf aus dunklem Holz tiefer in den Wellen lag als einige andere Schiffe, an die er sich erinnerte.
Er rief zum Kapitän hinunter: „Sie sind gut beladen. Vielleicht nicht sehr gut. Und sie sind nicht sehr schnell, obwohl der Wind draußen auf See gut ist. Aber ich weiß, daß sie bald in unserer Nähe sein werden.“
„Dann holen wir sie uns, Batak“, sagte der Kapitän. „Bleib oben, bis du nichts mehr siehst, klar?“
„Bis ich nichts mehr erkenne“, bestätigte Batak und sah gerade noch, wie der Kapitän in die Glut blies, ein paar Handvoll Blätter und dürre Ästchen hineinwarf und schließlich eine Fackel an den Flammen entzündete. Die Sonne versank hinter der Linie des Horizonts, und die Wolken schienen zu brennen. Vor den schreiend bunten Farben verschwand das fremde Schiff völlig. Batak schloß wieder die Augen und wartete. Er hatte sich die Stelle, an der er das Schiff zuletzt gesehen hatte, genau gemerkt. Aber er entdeckte es erst wieder, als nach einer kurzen Dämmerung sekundenschnell die Nacht einfiel und die Sterne aufflammten.
„Sie wissen nicht, daß wir sie beobachten“, murmelte der Späher. „Verrückte Weißhäutige.“
Die Fremden hatten in der kurzen Zeit, in der er das Schiff aus den Augen verloren hatte, eine Buglaterne und eine Hecklaterne gesetzt. Beide Lichter waren heller als die Sterne am Horizont. Das Schiff segelte den Kurs, der ihn an der Westspitze der Insel vorbeibringen würde. Ob sie nach Süden abbogen oder nach Westen weitersegelten, das wußte nicht mal der Kapitän, der mit der geschwungenen Fackel über den Strand lief und seine Männer aufweckte.
„An Deck! Bereitet alles vor! Eine Jagd in der Nacht, ohne Licht und mit vollen Segeln!“ rief er.
Ein Drittel der malaiischen Besatzung war schon wach. Die Männer badeten im Meer, tranken oder hockten da und aßen. Die Kommandos und die Rufe Djongrangs rissen sie aus der schläfrigen Beschaulichkeit.
Schließlich rief Batak von seinem Hochsitz: „Sie halten Kurs! Wenn wir jetzt ablegen, haben wir sie um Mitternacht eingeholt!“
„Steig runter und hilf deinem Steuermann!“ rief Djongrang zurück.
„Bin schon unterwegs.“
Flammen loderten unter dem Teekessel. Die Männer hasteten nicht, aber sie bewegten sich zielstrebig und schnell. Sie wußten, was zu tun war, und Batak hatte ihnen bestätigt, daß sie noch genug Zeit hatten, zu essen und sich vorzubereiten. An Bord der „Perle“ wurde es lebendig. Einige Öllampen brannten auch in den Hecks der Piahiaps. Riemen und Bambusstangen klapperten. Batak ging zu Djongrang, zeichnete neben dem Feuer Linien in den Sand und erklärte den Kurs, den der Holländer segelte.
„Gut so. Du hast recht. Wir haben sie um Mitternacht“, sagte schließlich der Kapitän. „Spätestens.“
Er winkte und rief zu den anderen: „Vergeßt nichts! Habt ihr alle Waffen auf den Booten? Die ‚Perle‘ wird zuerst lossegeln!“
„Der Wind ist gut“, erklärte Batak und nickte. „Wir müssen kreuzen. Ich glaube nicht, daß die Fremden von uns wissen.“
„Bisher hat’s keinen gegeben, der es ihnen erzählen konnte!“
Djongrang schlug Batak mit der Faust lachend gegen den Arm. „Los, hol dein Zeug!“
Die Besatzungen der Boote hatten vor zwei Tagen die Arbeiten an den Rümpfen, am Rigg und an den Segeln beendet. Die Balor und die Piahiaps waren an den Strand gezogen und zur Seite gelegt worden. Jede Handbreit der Rümpfe glänzte, jede Leine war straff. Von diesen Arbeiten – jeder war nicht nur ein ausgezeichneter Seemann, sondern auch ein hervorragender Handwerker mit gutem Werkzeug – hatten sich die Malaien im Schatten ausgeruht, einen ganzen Tag und länger. Die Lagerstätten befanden sich zwischen den Wurzeln und im Sand am Waldrand, tief im kühlenden Schatten, unter geflochtenen Dächern. Jeder hatte seinen eigenen Platz, und dort bewahrte auch Batak seine Ausrüstung auf.
Er lieh sich von Semang das Öllämpchen und sammelte seine Waffen. Er füllte den Wasserschlauch, trank heißen, honigsüßen Tee und knotete seinen knielangen Schurz neu, ehe er die Krise in den Gürtel schob. Ein paar Atemzüge später stand er neben Sungh Ay auf dem Achterdeck der Balor.
„Schade, Ay“, sagte er grinsend. „Ich habe die Fremden gesehen. Du bist zu früh hinuntergeklettert.“
Sungh Ay winkte großzügig ab. „Ich kann’s verschmerzen. Der Unterschied wird nicht groß sein, verlaß dich drauf.“
Sie sprangen zu Semang und seiner Gruppe, die das Segel aufzogen. Das Ruder war frei. Die erste Belegleine wurde in mäßiger Eile eingeholt. Mit langen Bambusstangen stakte die Besatzung die kleinen, schnittigen Boote aus dem flachen Wasser und in engem Bogen vor dem Bug der „Perle der Brandung“ nach Norden aus dem Bereich der verschwiegenen Bucht hinaus.
Sen Phu und Thbong, die letzten Inselpiraten auf dem Strand, schütteten sorgfältig einen Wall aus Sand um das Feuer. Die Flammen durften nicht übergreifen. Ein Sturm würde den Dschungel abbrennen lassen. Und es war immer ein Vorteil, wenn sie, mit Beute beladen, zurückkehrten – mit ein paar Handgriffen hatten sie wieder Feuer unter den Kesseln.
Dann liefen sie zur Planke, lösten an Bord die Knoten und kippten das schmale Gerüst zurück in den Sand.
„Kurs auf die fremde Fleute!“ Djongrangs Stimme hallte über das Wasser der Bucht. „Wir holen uns die Beute, und wenn die Sonne im Mittag steht, liegen wir wieder zufrieden im Sand, erfolgreich und nach einer guten Jagd!“
Von den Booten und von Deck der „Perle“ antwortete das Geschrei der Malaien dem Kapitän. Langsam entfernten sich die „Perle“ und die drei Boote aus der Bucht. Sie waren nur schattenhaft zu erkennen, denn schon jetzt befanden sich die kleinen Öllämpchen im Schutz des Dollbords. Es gab gerade so viel Licht an Bord, daß die Malaien nicht ins Leere griffen.
Der Wind ließ das Dschunkensegel herumschwingen. Nur Mondlicht und der schwache Widerschein der Sterne verrieten, daß sich auf der endlosen Fläche des dunklen Meeres die Schiffe der malaiischen Inselpiraten bewegten. Sie waren nicht mehr als trügerische Schatten auf den lichtgesprenkelten Wellen. Die Dünung hob und senkte die Boote, als sie die Brandungswellen hinter sich ließen und die beiden Lichter ansteuerten, die etwa sieben Seemeilen vor dem Bug der schnittigen Balor standen.
Djongrang erschien achtern, lehnte sich neben Sungh Ay ans Schanzkleid und sagte: „Unsere Freunde sind entschlossen. Es wird keine einfache Jagd, die Fremden wissen sich zu wehren.“
Batak zurrte einen Knoten fest und erwiderte: „Auch heute nacht, Djong, werden wir sie halbwegs im Schlaf überraschen. Wie immer. Du weißt, daß wir so lautlos kämpfen wie die Dschungelteufel.“
„Ich weiß. Aber ich spür’s bei mir selbst: langsam habe ich das Küstenpiratenleben satt. Ich will zurück in mein Dorf, zu den Kindern und den Frauen.“
Am Ruder deutete Sungh Ay eine Verbeugung an und sagte spöttisch: „Deine Frauen, o Meister des lautlosen Gurgelschnittes, werden sich unendlich freuen, wenn du als reicher Pirat heimkehrst. Deine Söhne werden die Schulen der Weißen besuchen und klüger werden als ihre Väter. Auch für meine undankbare Brut habe ich dieses Schicksal geplant.“ Er stieß ein heiseres Lachen aus. In der Dunkelheit blitzten seine Zähne. „Und deine Töchter, als reiche Bräute, sie werden die besten und schönsten Männer finden.“
Djongrang, der nicht genau wußte, ob ihn seine Freunde auslachten, oder ob sie im Ernst sprachen, murmelte: „Was soll das? Was wollt ihr mir sagen?“
„Nichts anderes, Herrscher der Ebbe“, erwiderte Batak, „daß auch wir nicht für alle Zeiten Inselpiraten bleiben. Noch zwei, drei Schiffe, dann haben wir genug für die Ewigkeit und zerstreuen uns in alle Winde.“
Djongrang ballte die Hand. „Aber heute nacht gedenkt ihr schon zu kämpfen? Oder soll ich wieder allein alles tun?“
Sie lachten laut. Der Rudergänger lehnte sich schwer gegen die Pinne aus glattpoliertem Holz. Er hatte sie selbst aus einem riesigen Stück Treibholz gesägt, geschnitzt und geschliffen.
„Wir alle, Djong, werden wie Piraten kämpfen, die keine Furcht und nur den Sieg kennen. Wir holen uns das Schiff. Die Fremden werfen wir ins Meer, mit durchgeschnittenen Kehlen oder einem Kris zwischen den Rippen.“
„Wir haben schon fünf Schiffe zwischen die Klippen gejagt und geplündert“, sagte Djongrang entschlossen. „Wir holen uns auch heute wieder was sie uns gestohlen haben.“
„Bei allen Meergöttern!“ Sungh Ay sah zu, wie die „Perle“ weit nach Steuerbord überlegte und dann rasch Fahrt aufnahm. „Es wird eine gute, lange Jagd werden.“