Glauben - Wie geht das?
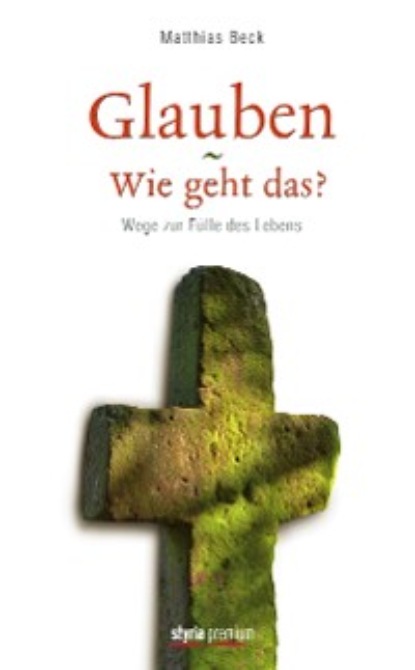
- -
- 100%
- +
Die Mühsal des Weitergehens in die Freiheit führt immer wieder in die Versuchung, umzukehren und zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurückzukehren. Da war zwar Knechtschaft und Gefangenschaft, aber es war bequemer. Freiheit und Eigenverantwortung erfordern tägliche Arbeit, gehen durch Einsamkeit und Wüste hindurch und machen auch Angst. Der Weg in die Freiheit ist beschwerlich. Aber er geht unaufhaltsam weiter und ist nahezu unumkehrbar.23 So wie ein Kind, das gezeugt wurde, geboren werden muss, da es sonst, wenn es im Geburtskanal stecken bleibt, stirbt und den Organismus der Mutter vergiftet, so muss sich auch Freiheit immer weiter nach vorne entwickeln auf mehr Freiheit hin.
Bevor genauer bestimmt wird, was diese Freiheit ist, soll noch einmal festgehalten werden, dass der Mensch auch in der Geschichte erst langsam zu dieser Freiheit heranreift. Er wird erst langsam durch seine eigene Entwicklung hindurch freiheitsfähig. Wie in der Kindheitsentwicklung ein Werdeprozess stattfindet vom Gehorsam des Kindes seinen Eltern und anderen Über-Ich-Strukturen gegenüber hin zum Freiwerden des jungen Menschen zur Selbstbestimmung (was dann auch mehr Verantwortung bedeutet), so gibt es auch einen Reifungs- und Befreiungsprozess des Menschen in der Weltgeschichte hin zum Mündigwerden des Einzelnen und zu seiner Autonomie.
Man kann den Prozess der inneren Reifung des Menschen hin zur Befähigung zum Freiheitsvollzug auch so nachzeichnen: Der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten mit der befreienden Tat Gottes ist in der Weltgeschichte relativ jung. Erst vor etwa 3500 Jahren beginnt Gott, sich ganz langsam dem Volk Israel mit seinem Befreiungshandeln zu nähern. Es beginnt seine Selbstoffenbarung. Und erst vor etwa 2000 Jahren verdichtet und konkretisiert sich der göttliche Logos zu einer menschlichen Gestalt mit dem Ziel, den Menschen auch innerlich zu befreien.
Erst jetzt beginnt nach der äußeren Befreiung im Alten Testament der lange Prozess der inneren Befreiung des Menschen im Neuen Testament. „Zur Freiheit hat uns Christus befreit.“ (Gal 5, 2) Auch dieser Prozess dauert in der Weltgeschichte einige Zeit. Was in der Biografie des Einzelnen zehn oder 20 Jahre dauert, dauert in der Weltgeschichte vielleicht 1000 oder 2000 Jahre. Nach dem alten Satz, „dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind.“ (2 Petr 3, 8) Auch die europäische Geschichte musste sich erst mühsam über viele Kriege zu dieser Befreiung hin durchkämpfen. In Nordafrika und in den muslimischen Ländern beginnt sie gerade erst.
Es sieht so aus, als würde die äußere Befreiung, die im Judentum begonnen hat und die sich als innere Befreiung des Menschen im Christentum weiterentwickelt, erst jetzt in der Gegenwart ganz langsam beim Menschen ankommen. Der Mensch befreit sich mehr und mehr von Über-Ich-Strukturen und äußeren Autoritäten. Das hat mit der 68er Generation begonnen und setzt sich fort im Raum der Kirche. Der Mensch emanzipiert sich von äußeren Über-Ich-Strukturen. Er will sich von äußeren Autoritäten nichts mehr sagen lassen. Er möchte selbst entscheiden können, was er tut, und er möchte selbst herausfinden, worum es im Leben geht.
Er möchte Zusammenhänge verstehen lernen sowie innere geistliche Erfahrungen machen, und nicht mehr nur Befehlen, Geboten oder Verboten folgen. Er braucht Argumente, um einsehen zu können, warum er so oder so handeln soll, und er bedarf der Reflexion über seine inneren Erfahrungen, um sein Innenleben verstehen zu können und zu erkennen, was in ihm vorgeht. Es ist der Überstieg von der äußeren Autorität hin zur inneren Autorität. Dies ist die wahre Autorität (von „augere“: „wachsen lassen“). Denn diese innere Autorität macht den Menschen nicht klein und unterdrückt ihn, sondern macht ihn groß und führt ihn in die Freiheit und Autonomie.
Und so gehört beides zusammen: Ethik und Spiritualität. Es ist eine zentrale Aufgabe für das Christentum, dem Menschen ethische Argumente für sein Handeln zu liefern und ihm zu helfen, seine inneren Erfahrungen und Seelenregungen verstehen zu lernen. Das eine ist die äußere Autorität der Normen, und das andere ist die innere Autorität der Wahrheitsstimme, des Gewissens, der Stimme Gottes. Die verschiedenen Stimmen und Seelenregungen im Menschen unterscheiden zu lernen (s. u.), nennt die Tradition die „Unterscheidung der Geister“. Gerade diese Kenntnis ist heute von zentraler Bedeutung für konkrete Entscheidungsfindungen im Alltag. In beiden Bereichen müsste der Mensch von heute besser unterrichtet werden.
Es scheint so zu sein – allem Wehklagen zum Trotz –, dass Gott dem Menschen heutzutage noch näher kommt als im Judentum und im bisherigen Christentum: Der Mensch kann Gott und sein Wirken in seiner leiblichen Verfasstheit erspüren. Aber er braucht „Lehrer“, die ihm helfen, das zu entdecken. Es scheint nämlich so zu sein, dass das Normalste und Selbstverständlichste in der Welt zu etwas Göttlichem wird: dass man sich über etwas freuen kann, dass man sich irgendwie fühlt, dass man irgendwie in Stimmung ist, dass man – wie Heidegger sagt – immer irgendwie gestimmt ist: fröhlich, traurig, gelangweilt, interessiert, zerrissen oder ganz bei sich, in seiner Mitte oder „außer sich“. All diese Stimmungszustände haben etwas mit dem Verhältnis des Menschen zu Gott zu tun. Diese inneren Gestimmtheiten verstehen zu lernen, wäre heutzutage ein wichtiges Desiderat für die Vermittlung von christlicher Spiritualität. Denn Gott zeigt sich ganz still und ganz verborgen, er will gefunden und entdeckt werden. Vielleicht sollte man deswegen auch nur ganz sparsam über ihn reden, umso mehr mit ihm.
Eine solche christliche Spiritualität sollte dem Menschen durch konkrete Alltagsanleitungen helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Es ist eine Spiritualität der richtigen Entscheidungen und des Handelns aus der inneren Mitte heraus. Diese Entscheidungen wären nicht von außen aufoktroyiert, sondern von innen her als richtig und tragfähig erkannt (vgl. das Kapitel über die Unterscheidung der Geister). Anders gesagt: Wenn Gott dem Menschen innerlicher ist als er sich selbst ist, (Augustinus) dann kann der Mensch aus dieser inneren Mitte heraus bessere Entscheidungen treffen als ohne diese Anbindung – und die Wahrheit nicht nur besser erkennen, sondern sie vor allem tun, und das heißt, das Richtige tun! Daher heißt es im Neuen Testament: „Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht.“ (Joh 3, 12)
Vielleicht kann man als Zwischenresümee Folgendes feststellen: Es hat den Anschein, als würde die Welt immer säkularer. Ein Teil davon ist auch sicher richtig. Aber vielleicht gibt es auch eine andere Seite der Medaille: Gott rückt dem Menschen innerlich immer näher. Es ist die Zeit der Suche nach innerer Erfahrung, die Zeit der Mystik, zumindest eine Zeit der Sehnsucht danach. Wieder anders betrachtet wird die Welt scheinbar immer unabhängiger von Gott oder bestimmten Gottesbildern. Man braucht Gott offensichtlich nicht in der Medizin, weil vieles machbar geworden ist, man braucht ihn nicht als Erklärungslückenbüßer in der Natur, weil vieles naturwissenschaftlich erklärbar geworden ist, man braucht ihn kaum noch in der Ethik, weil sehr vieles philosophisch durchreflektiert wurde (Menschenwürde, Menschenrechte, Personencharakter des Menschen, Schutz des Individuums).
Der Mensch scheint ihn auch nicht zu brauchen, er kommt offensichtlich auch ohne Gott ganz gut aus. So wird die Welt säkularer, und es fragt sich, ob das Christentum selbst zu dieser Säkularisierung beigetragen hat,24 weil der Glaube die intellektuelle Auseinandersetzung sucht (fides quaerens intellectum, der Glaube sucht den Intellekt). Vieles, was früher zum Thema Glauben gehörte, ist heute entweder erklärbar oder unwesentlich geworden. So müssen wir im Folgenden weiterfragen, wie es um die Frage nach Gott und den Glauben heute steht, wie Gott sich heute zeigt und welche Transformationsprozesse zurzeit ablaufen.
Um sich zunächst der Frage nach Gott und seiner Erscheinungsweise im Menschen Jesus Christus zu nähern, kann man zwei Wege wählen. Man kann entweder fragen, ob das überhaupt denkbar ist, dass Gott Mensch geworden ist, und dann von dort aus das Verhältnis von Gott Vater und dem Mensch gewordenen Sohn rekonstruieren. Dann stellt sich das Problem, dass man einige Voraussetzungen übernehmen muss, die erst hinterher erklärt werden können. Oder man geht den umgekehrten Weg – der hier eingeschlagen wird –, dass man zunächst die Setzung des Christentums mit einem dreifaltigen Gottesbild übernimmt und dann rückwärts aufrollt, wie es dazu gekommen ist: beide Wege haben ihre Schwäche, weil man immer zuerst etwas voraussetzen muss, was erst später erklärt werden kann. Dem Leser kann diese Mühe leider nicht erspart bleiben. Wenn er offen ist, kann er den Weg gut und leicht mitgehen. Es ist auch der Versuch, das Gottesbild mit Grundstrukturen der Welt in Verbindung zu bringen.
2. Das dreifaltige Gottesbild – Die Grundstruktur der Welt ist Beziehung
Man kann einen ersten Zugang zur heutigen Gottesfrage finden, indem man sich dem christlichen Gottesbild zuwendet. Es ist ein Gottesbild, bei dem das Wort des Gottes Mensch wird. Dieser Mensch gewordene Gott (Jesus Christus) nennt den Gott Jahwe seinen Vater. Das Verhältnis beider wird vermittelt durch den einen göttlichen Geist, den Heiligen Geist. Die Theologie sagt, dieser Gott sei ein Gott in drei Personen. Und dann geht es um die Frage, wie man sich dieses Verhältnis von Vater, Sohn und Heiligem Geist vorstellen kann. Es geht dabei um das Verhältnis dieser drei göttlichen Personen vor der Erschaffung der Welt und nach der Erschaffung der Welt, also in dieser Welt. Es geht auf der einen Seite um ein innergöttliches Geschehen und auf der anderen Seite um das Verhältnis dieses Gottes zum Menschen in dieser Welt. Philosophisch kann man es so ausdrücken: Der Grund allen Seins ist nicht eine starre Substanz, sondern ein dynamisches Beziehungsgeschehen zwischen Vater, Sohn und Geist. Es ist ein Beziehungsgeschehen des Dialoges und der Liebe, und in dieses Beziehungsgeschehen ist der Mensch mit hineingenommen.
Gott ist also schon vor Erschaffung der Welt ein Beziehungsgeschehen in sich selbst in der Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Er ist sich selbst genug und braucht die Welt nicht als Gegenüber. Das bedeutet zweierlei: Er ist in sich ein Liebesgeschehen dreier Personen und er ist dadurch ganz frei. Gott braucht die Welt und den Menschen nicht als ein „Liebesobjekt“. Er ist alles in sich und kann daher die Welt aus voller Freiheit schaffen. Daran hängt – das wird später ausgeführt – auch der ganze Freiheitsgedanke des Menschen.
Gott hätte die Schaffung einer endlichen Welt auch lassen können. Die theologische Antwort auf die Frage, warum es die Welt gibt, kann eigentlich nur so lauten: weil Gott es aus seiner Freiheit heraus wollte. Es gab keine Notwendigkeit zur Welt. Wie die Welt dann entstanden ist, ob durch Urknall oder anders, ist eine naturwissenschaftliche Frage. Gott setzt eine Initialzündung und dann entwickelt sich die Welt von selbst. Wenn die Welt durch die Initialzündung des Urknalls entstanden ist und die Urknall-Theoretiker mit dem Urknall die Nichtexistenz Gottes aufweisen wollen, müsste man sie fragen, ob das Nichts überhaupt knallen kann, ob da, wo nichts ist, überhaupt etwas aus dem Nichts entstehen kann. Anders gesagt: Wo nichts ist, knallt auch nichts.
Das Entstehen aus dem Nichts ist das, was die Theologie Schöpfung nennt. Gott allein, der sich aufgrund seines innergöttlichen Beziehungsgeschehens aus sich selbst heraus versteht und insofern selbst-verständlich ist, kann etwas aus dem Nichts ins Sein setzen (creatio ex nihilo, Schöpfung aus dem Nichts). Wenn er diese Welt aus dem Nichts schafft, was nur er selbst kann,25 kann er sie so schaffen, dass sie sich dann von selbst weiterentwickelt. Insofern – das wurde schon gesagt – kann Schöpfung durchaus evolutiv vonstattengehen.
Wenn es diese Einheit der drei göttlichen Personen vor Erschaffung der Welt gibt, dann ist es eine Einheit in Verschiedenheit, eine Einheit von Beziehungen, eine Einheit in Polarität (der Vater ist ganz anders als der Sohn), eine Einheit in Pluralität. Das ist die Grundlage dafür, dass es auch in der Welt Spuren von Polarität gibt (Plus- und Minuspol, Mann und Frau), Spuren von Pluralität (zum Beispiel unterschiedliche Positionen in einer Demokratie oder die Pluralität von Weltanschauungen und Religionen) und die Einheit der Beziehung innerhalb einer Liebe (die Liebe zwischen verschiedenen Menschen).
Mit der Schaffung einer endlichen Welt und mit dem Menschen hat Gott auch eine endliche Freiheit geschaffen. Damit hat er die Möglichkeit eröffnet, dass der Mensch „Nein“ sagt zu Gott. Damit geht Gott das Risiko ein, dass der Mensch sich gegen ihn wendet und damit letztlich auch gegen sich selbst und gegen den anderen. Genau das hat der Mensch auch getan. Angesichts dieses vollzogenen „Nein“ des Menschen zu Gott (geschildert mit dem Ungehorsam in der Paradiesgeschichte; Gen 1, 3) und des Missbrauches der Freiheit kommt es im Alten Testament sogar zu der Aussage: „Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh“ (Gen 6, 6).
Mit der Schaffung endlicher Freiheit hat sich Gott womöglich auch seiner Allmacht beraubt. Vor der Schöpfung war er allmächtig, er konnte die Welt schaffen oder auch nicht. Nach der Schaffung des Menschen mit seiner Freiheit war er es womöglich nicht mehr, denn jetzt ist er auf das Mitwirken des Menschen in der Welt angewiesen. Er kann an der Freiheit der Menschen vorbei womöglich nichts tun. Er kann den Menschen nicht zu sich hinzwingen. Denn dieser Zwang widerspräche der Freiheit und der Liebe. Die Freiheit ist offensichtlich der Preis der Liebe,26 denn Liebe geht nicht ohne Freiheit. Niemand kann zum Lieben gezwungen werden.
Wenn Gott innerhalb seines Beziehungsgeschehens die Liebe ist (1 Joh 4, 8), dann will er keine Menschen als Marionetten und keine Wesen, die irgendwelchen Schicksalsmächten unterworfen sind, sondern Wesen, die aus ihrer Freiheit und ihrem Willen heraus „zurücklieben“ und etwas Selbständiges tun.27 „Ohne die Annahme des freien Willens und seiner selbstursächlichen Letztverantwortung könnte sich der Mensch überhaupt nicht als Subjekt betrachten; er wäre vielmehr ein Spielball fremder Kräfte, die ihren Streit in seiner Seele austragen.“28 Und so soll der Mensch auch aus freien Stücken der Liebe Gottes mit seiner Gegenliebe antworten. Liebe ist immer Antwort auf Geliebtwerden. Allerdings sind sowohl der freie Wille als auch das Lieben-Können „angeschlagen“. Der Mensch neigt zum Nein gegen Gott, er will das Gute tun, tut doch das Böse und versteht sich selbst nicht. (Röm 7, 19)
Das liegt daran, dass der Mensch hineingestellt ist in die Unheilsgeschichte der Welt. Er bekommt von den Eltern das an Verstellungen mit auf den Weg, was die Eltern nicht aufgelöst haben. Und so geht das durch die Generationen hindurch. Letztlich geht es zurück bis zu den ersten Menschen, die sich von Gott abgewendet haben. Durch diese Abwendung begann die Unheilsgeschichte der Welt. Der einzelne Mensch, aber auch ganze Völker sind in sie verwickelt, ob sie wollen oder nicht. Die theologische Tradition hat hieraus die Lehre von der Erbsünde entwickelt. Diese hat nichts mit persönlicher Schuld zu tun, sondern mit dem Hineinverwobensein in diese unheilvolle Weltgeschichte. Aus dieser inneren Verwobenheit, Gebrochenheit, Zerrissenheit und der daraus resultierenden Unfähigkeit, seine Freiheit wirklich vollziehen zu können, muss der Mensch befreit werden. Der Mensch muss zur Freiheit befreit werden, (Gal 5, 1) damit er das Gute auch wirklich tun kann.
Die Auffassung vom dreifaltigen Gott sagt auch etwas aus über die Grundstruktur der Welt. Der Grund von allem (Gott) ist ein Beziehungsgeschehen, er ist ein ständiger Dialog (Trialog) zwischen den göttlichen Personen. Darin kann man wieder Mehreres erkennen: zum einen, dass diese Grundstruktur – wie schon erwähnt – Bedingung der Möglichkeit der Liebe und der Freiheit ist und dass der Mensch nur frei werden kann, wenn auch Gott ganz frei ist. Gleichzeitig kann der Mensch nur deshalb lieben, weil er in diesen Dialog der Liebe eingebunden ist. Innerweltlich heißt das, dass er sich dieser Liebe aktiv zuwenden sollte, da er letztlich nur aus dieser Angebundenheit heraus sich selbst und damit den anderen dauerhaft zu lieben vermag.
Daher ist das Gebot der Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe auch genau so zu lesen: In der Anbindung an Gott findet der Mensch seinen inneren Halt. Er ist von Gott bedingungslos angenommen und geliebt. Dadurch kann er schrittweise ein gutes Selbstverhältnis und eine gute Selbstliebe aufbauen sowie auch alle seine eigenen Schattenseiten akzeptieren lernen. Er kann all seine Projektionen, mit denen er sich ein Bild von sich selbst und vom anderen macht, schrittweise zurücknehmen. Er kann auch, weil er von Gott unbedingt angenommen ist, alle Kompensationsversuche, die ihn seine Minderwertigkeitsgefühle überdecken lassen, zurücknehmen und so immer authentischer werden.
So wird er langsam ein gutes Verhältnis zu sich selbst finden (Selbstliebe) und von dort aus auch den anderen annehmen und lieben lernen. Da er so immer authentischer wird, wird er selbst auch immer liebenswerter und attraktiver. Ohne in der Quelle der Liebe und der Wahrheit verankert zu sein, wird der Mensch letztlich nicht zu seiner Wahrheit, seiner Authentizität und Attraktivität finden, und seine Kraft zum Lieben wird im Laufe des Lebens abnehmen. Sie reicht dann nicht für ein ganzes Leben, und die Lichter gehen zu früh aus.29 Selbsterkenntnis, Erkenntnis des anderen als des anderen und Erkenntnis Gottes gehören ebenso zusammen wie Selbstliebe, Gottesliebe, Nächstenliebe.
3. Die drei göttlichen Personen in der Welt
Die drei göttlichen Personen sind also in einem dynamischen Zueinander vor Erschaffung der Welt „da“ und zeigen sich in unterschiedlicher Weise auch in dieser Welt. Der Schöpfergott Jahwe, der vom göttlichen Sohn als der Vater bezeichnet wird, zeigt sich indirekt in der Größe und Schönheit seiner Schöpfung. Der Sohn zeigt sich als Mensch unter den Menschen. Er lebt den Menschen vor, wie das Leben geht.30 Und er sagt von sich als dem menschlichen Gegenüber: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18, 20) Dieser göttliche Sohn wird schließlich getötet und hinterlässt der Welt nach seinem Tod den göttlichen Geist, den Heiligen Geist. Dieser Geist zeigt sich im Innersten des Menschen als Teil seines Gewissens (s. u.). Er zeigt sich auch in der Welt, in der Kirche und in den Heiligen Zeichen der Kirche, die als Sakra-mente (Heilige Mittel) bezeichnet werden. Dieser Geist wirkt indirekt in den Zeichen der Zeit sowie in den Ereignissen des Lebens. Er ist der Geist, der lebendig macht, (Joh 6, 63) und die Früchte dieses Heiligen Geistes sind Liebe, Freude und innerer Friede. (Gal 5, 22)
So wie Gott sich in seiner Dreifaltigkeit in dieser Welt zeigt, so kann der Mensch umgekehrt dieses Wirken des dreifaltigen Gottes in dieser Welt erkennen. Er kann – wie erwähnt – Gott als den Vater in der Schöpfung erkennen, den Sohn in jedem zwischenmenschlichen Kontakt und den Heiligen Geist in seinem Innersten, aber auch in den Sakramenten, in der Kirche, in der Welt. Allerdings kann man die drei göttlichen Personen nicht so auseinanderdividieren, das man hier den Vater, da den Sohn und dort den Heiligen Geist erkennt. Es ist der eine Gott und der eine Geist, der in allem wirkt. Der ganze Kosmos ist durchwirkt und getragen von diesem dreifaltigen Gott.31
Daher geht es bei einer solchen Auffassung von der Dreifaltigkeit auch nicht darum, diese Dreifaltigkeit als ein Dogma des Christentums auswendig zu lernen, sondern zu verstehen, was sie für den Alltag des Menschen aussagt. Sie sagt nämlich nicht nur etwas aus über Gott, sondern auch etwas über sein Verhältnis zur Welt und zum Menschen sowie über die Struktur der Welt. Es geht also um etwas Grundsätzliches und Existenzielles, und nicht um etwas, das der Mensch zusätzlich auswendig lernen muss. Er muss einmal darauf hingewiesen werden, dass sich im Menschen sowie in den Strukturen der Welt der dreifaltige Gott in je unterschiedlicher Weise zeigt. Dieser Gott ist also in allem und nicht neben allem.
Es stellt sich dabei immer wieder die Frage, woher der Mensch das alles weiß, woher er weiß, dass der christliche Gott ein dreifaltiger Gott ist und dass er Mensch geworden ist. Es muss hier wiederholt werden, was schon gesagt wurde, dass der Mensch zwar an das Absolute herandenken kann, aber von sich aus nicht wissen kann, wie es ist. Das Absolute selbst muss sich zu erkennen geben und sich zeigen, es muss sich offenbaren. Das hat der Gott Jahwe getan, indem er sich in der Schöpfung geäußert hat, und dadurch, dass er einzelne Menschen wie die Propheten, Mose und Abraham berufen hat. Schließlich hat er sich geäußert in seinem Sohn als Mensch. Judentum und Christentum sowie später der Islam werden deshalb auch als Offenbarungsreligionen bezeichnet.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

