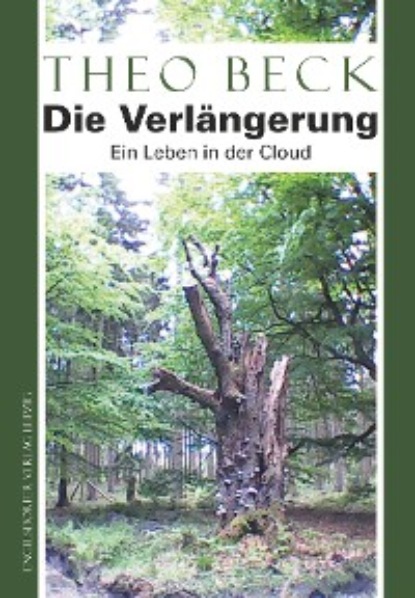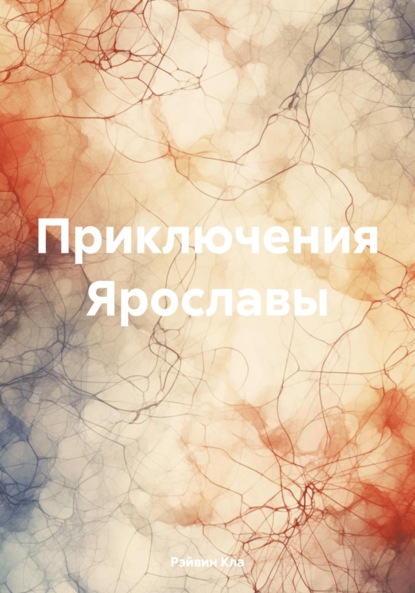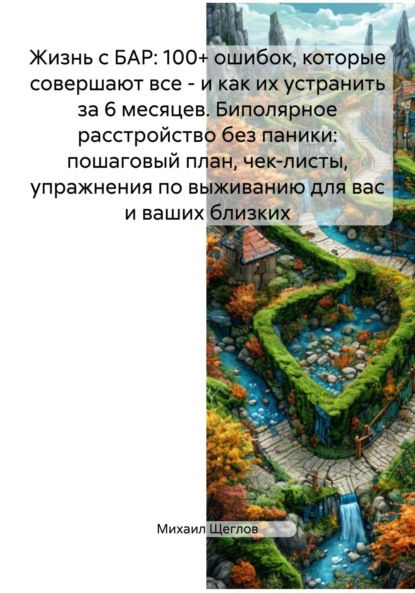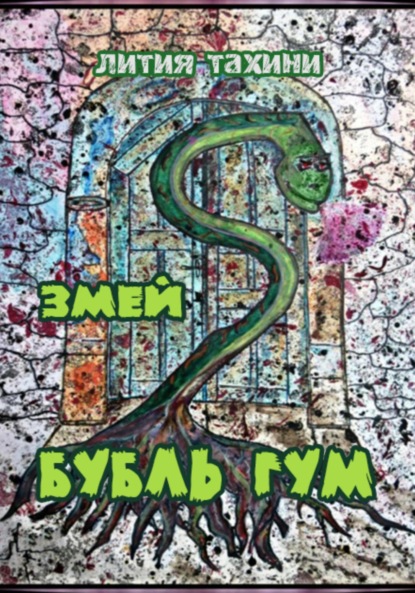- -
- 100%
- +
Ich habe sofort gemerkt, dass das live ist. Der junge Pfleger steht in seinem blau-weiß gestreiften, schmuddeligen Kittel im Gang und sieht entsetzt auf die rote Leuchte über meiner Tür. Er ist in freiwilligem Einsatz, Wehrdienstverweigerer. Eigentlich noch ein großer Junge, ganz sympathisch in seiner ungelenken Verlegenheit. Anfangs war er sehr schüchtern, mochte mich nicht anfassen. Wenn er mich waschen sollte, machte er um den Schambereich immer einen großen Bogen, als wär es eine verbotene Zone. Er weiß natürlich, dass ich nur noch künstlich versorgt werde.
Wieso leuchtet die Lampe? Er starrt auf die rote Signalleuchte über der Tür. Der kann gar nicht mehr klingeln! Der ist doch gar nicht mehr da! Plötzlich geht die Tür ganz auf. Wie ein Blitz durchfährt ihn der Schreck. In Schockstarre sieht er auf Dr. Mohr, als der durch die Tür kommt, starrt ihn mit leicht geöffnetem Mund und aufgerissenen Augen an.
„Ich, eh, das Licht, eh, wieso?“
Mohr sieht auf die Leuchte: „Ach, da bin ich wohl versehentlich gegen den Knopf gekommen. Bestätigen Sie den Alarm mal.“ Er lässt die Tür auf und geht in Richtung Schwesternzimmer.
Da hat er mal wieder gelogen. Ich habe genau gesehen, wie er auf den Knopf gedrückt hat. Ist doch klar. Er wollte, dass Angela ins Zimmer kommt, wollte mit ihr allein sein. Meine Anwesenheit stört ihn nicht. Er weiß ja nicht, dass ich ihn durchschaue, höre, was er sagt, und ahne, was er denkt. Sein aufgerichteter Kopf und sein Gesichtsausdruck zeigten seine Gewissheit. Aber was ist es, das ihn jetzt Angela suchen lässt? Ich verliere ihn nun leider aus meinem Blickfeld. Was will er von ihr? Von hier kann ich das nicht hören. Wie kann ich … Ach was, ich zieh mich zurück und mach die Augen zu. Wenn hier nichts los ist, geh ich wieder in meine Cloud. Soll doch jemand anders weitererzählen!
6. Wer glaubt
Dr. Ewald Mohr war noch ganz erfüllt von den Gesprächen der Sitzung im Kirchenvorstand. Seine Gewissheit bestärkte ihn. Natürlich musste er davon niemandem berichten. Das hatte er nicht nötig. Aber die tiefgründigen Gedanken dort, die gesprochene Bedeutung, der heilige Ernst der Worte bedrängten sein Empfinden. Er konnte das nicht bei sich behalten. Es musste raus.
Angelas bewundernde Blicke, ihre Dankbarkeit, dass sie von ihm eingeweiht wurde, ließen ihn Stolz fühlen. Sie hörte, wie man seine Meinung bestätigt hatte, wie er sich durchgesetzt hatte und wie der Herr Pfarrer ihn bestärkt hatte in der Angelegenheit des Komapatienten, nachdem er ihnen von dem Verlangen der Tochter, der Patientenverfügung und der Mitgliedschaft in der „Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben“ berichtet hatte. Den Brief der Tochter, der ihn beschuldigte, nicht hinreichend dem Willen des Patienten gefolgt zu sein, hatte er geschildert. Er solle sich von dem Druck der Sterbeindustrie nicht beeinflussen lassen, hatte der Herr Pfarrer ihn gedrängt.
„In der heutigen Gesellschaft wird der Tod nur als Ende und nicht mehr als Abschied und Vollendung und schon gar nicht als Weg zu Gott gesehen“, hatte der gesagt und sich dabei aus seiner sonst oft gebeugten Haltung aufgerichtet. Die amtliche Sicherheit sprach aus seinen Mahnungen.
„Allzu oft wird ein Schreckensbild des Sterbenden gezeichnet, den die Gerätemedizin nicht in Ruhe und Würde seinen Weg zu Gott finden lässt. Dabei wird die Menschenwürde zu einem Abstraktum, das nichts mehr davon weiß, wie sehr wir in unserem Wollen von den Erfahrungen unserer kreatürlichen Existenz abhängen, insbesondere in der Konfrontation mit Leiden und Todesangst. Stattdessen glauben die Selbstmordvereine, über eine Lebenslage sicher urteilen zu können, von der sie aus eigenem Erleben nichts wissen. Unter diesen Vorzeichen müssen Wert und Grenzen von Patientenverfügungen gesehen werden. Schließlich können sie auch eine verkennende Willensbekundung sein, die auf der leider gesellschaftlich vorherrschenden Verdrängung von Leid fußt oder, schlimmer noch, der individuellen Erwartung des Umfeldes entsprechen. Der Achtung der Menschenwürde entspricht viel besser eine gemeinsame Entscheidung, zu der sich christlich gesinnte Betreuer und ärztliches Konsilium verantwortlich vereint verständigen können, also dem, was dem Willen des Patienten in seiner Lage gleichkommt.“
Aha! Das war es also! Dr. Mohr war beseelt von der mit christlichem Geist und ärztlicher Verantwortlichkeit erfüllten Sitzung. Es hatte ihn gedrängt, sich darüber mitzuteilen. Aber mir wäre es lieber gewesen, ich wäre von seinen Glaubensgewissheiten verschont geblieben. Sie infizieren meine Erinnerung durch die Bilder vom Grauen im Namen Gottes. Sie stehen sofort vor mir, ungerufen, unlöschbar. Sie drängeln sich einfach vor.
Immer wieder sehe ich die Szene vom Handabhacken im Gefängnis von Mekka vor mir. Oder das Bild von der Folterung des Cuautémoc, jene schrecklichen Quälereien durch die spanischen Missionare in Südamerika, oder die Unmenschlichkeiten der Inquisition. Ich erinnere mich an die Sammlung von Bildern und Zitaten von Päpsten und Kardinälen zum Gold der Kirche. Ihr Reichtum ist Blutgeld. Wie viel Gold sie wirklich besitzen, erpresst von Ureinwohnern, gestohlen oder erzwungen von allen, halten sie geheim. Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts schrieb die italienische Presse, dass der Vatikan bereits einen Goldschatz von 10.000 Tonnen habe.
Auch Hans bekommt auf der Hinfahrt seiner bemerkenswerten Reise nach Sizilien etwas davon mit. In Rom hat er einen halben Tag Zeit, sich die Stadt anzusehen. Und da steht er nun und staunt.
Ich verstehe das. Wer würde sie nicht bewundern wollen, die Pracht dieser Kirche, „Santa Maria Maggiore“, in Rom. Ich glaube, sie ist eine der vier Papstbasiliken und zugleich Pilgerkirche und gehört dem Vatikan. Ich schätze etwa fünftes Jahrhundert. Die Tafel, die Hans da liest, sagt, sie sei ein Denkmal des Marienkultes und zugleich Grabstätte mehrerer Päpste. Und sie liegt ganz in der Nähe vom Bahnhof Termini, von dem er gekommen ist. Die Engelsburg und die Brücke über den Tiber, die Hans aus der Oper Tosca kennt, sind weiter entfernt. Aber auf dem Platz vor der Basilika steht die Mariensäule, die, wie er gelesen hat, aus dem „Forum Romanum“ stammt. Und dass der Campanile der Kirche zu den höchsten Glockentürmen Roms gehört, hat er auch gelesen. Aber auch das: „Mit dem ersten Gold aus der Süd-Amerika-Beute ließ Papst Alexander VI. die Decke von Santa Maria Maggiore in Rom verzieren und mit dem Symbol seiner Familie versehen.“
„Pharisäer!“
Was, wie Pharisäer? Was hast du dagegen? Mich beeindrucken die Kirchen. Ja, von außen betrachtet, sind sie oft etwas bröckelig, oder sagen wir mal renovierungsbedürftig. Aber innen, mit den vielen Bildern, Fresken oder Mosaiken als Zeichen des Glaubens, die Insignien und so weiter, die sind doch bewunderungswürdig.
„Was begeistert dich daran?“
Na, also, zum Beispiel die Kleider und Umhänge in den Vitrinen mancher Kirchen. Das sind alles alte Originale, sorgsam gehütet, über Jahrhunderte, und kostbar bestickt.
„Ja. Und von wem bestickt? Wer hat die schneidern und besticken müssen? Wer hat das Material dafür liefern müssen? Die Träger bestimmt nicht! Sie hängen sich das Zeug um, nur um Eindruck zu schinden, um etwas Besonderes zu sein, um ihre Macht zu demonstrieren! Imitiert haben sie das meiste! Der Habit, wie sie das nennen, hat sich aus der Arbeitskleidung der Bevölkerung im Italien des sechsten Jahrhunderts entwickelt. Der Habit war äußeres Zeichen der Armut und des einfachen Lebens, mit dem sie sich auf die gleiche Ebene jener Menschen stellten, die sie überzeugen wollten. Der Habitus hat etwas mit Gesinnung und Verhalten zu tun. Der Träger dieser Kleidung brachte damit seine innere Einstellung zum Ausdruck. Wie früher die Mönche. In den Kirchen täuschten sie damit vor, sie seien so etwas wie Franziskaner oder Benediktiner. Aber von deren Vorbild der Einfachheit und Armut ist nicht mehr viel verblieben. Heute schmücken sich die vom heiligen Geist befruchteten Herren mit farbigen Umhängen als Rangabzeichen wie die Garde in einem Karnevalsverein, gefertigt und bezahlt von ihrem Fußvolk.“
Na, na! Und die Krone, die Mitra, Brustkreuz oder Krummstab, die Ringe, die sind doch alle echt, die ich da in der Vitrine gesehen habe.
„Ja, vermutlich. Nur auch hier: Wer hat sie so kunstvoll gefertigt? Die Bischöfe bestimmt nicht. Und von wem kommt das Gold? Jetzt schmücken sie sich damit, als wären es ihre Leistungen oder die ihrer Kirchen. Glaubst du, die Besitzer haben es ihnen freiwillig geschenkt? Man hat sie bestohlen und erpresst! Hieronymus, Bischof von Breslau‚ soll gesagt haben: ‚Wir brennen wahrhaftig vor Geldgier, und indem wir gegen das Geld wettern, füllen wir unsere Krüge mit Gold, und nichts ist uns genug.‘“
Und was war mit dem Handabhacken?
„Ich mag das nicht gerne erzählen, sieh doch selbst hin.“
7. Hand ab
Ja, den kenn ich, das ist Alfred Wessel. Er war Storekeeper auf der „MS Usambara“, ein spindeldürrer Mann von mittlerer Größe und etwa 45 Jahre alt. Als Storekeeper war er Vorgesetzter der Mannschaft, die zur technischen Besatzung gehört, also der Reiniger, Schmierer, Heizer und so weiter. Er und seine Leute wohnten nicht mittschiffs wie die nautischen und technischen Offiziere und ihre Assistenten, sondern achtern, unter der Poop. Sie hatten dort zusammen mit dem Bootsmann, Zimmermann und der übrigen Decksmannschaft eine Mannschaftsmesse, in der sie von den Schiffsjungen bedient wurden. Und sie alle mochten den Storekeeper, weil er gut erzählen konnte.
Alfred Wessel fuhr schon lange zur See, sagte er, eigentlich seitdem er zu den Erwachsenen zählte. Aber er hat immer wieder mal eine Pause eingelegt, einen Zwischenstopp für Abenteuer, sagte er. Wenn sich ihm die Chance bot, irgendwo auszusteigen, an einem Ort oder in einem Land, das ihn interessierte, hat er das getan, sagte er. Und das war die Ursache, warum er viel zu erzählen hatte. Zur Freude der Schiffsjungen. Und eine Geschichte war die vom Handabhacken. Er hatte ein handgebundenes, schmales Heft darüber verfasst, DIN A4, mit einem blauen Pappeinband und auf blauem Luftpostpapier in Schreibmaschinenschrift beschrieben. Dieses Erlebnis konnte er also vorlesen. Das fiel ihm leichter.
„Das Gefängnis von Mekka ist ein großer, viereckiger Bau ohne Fenster nach außen. Es ist ein Ringgebäude, das man durch ein eckiges, schmuckloses, eisernes Tor betritt, durch das man in den großen, sandigen Innenhof kommt. In den allermeisten Fällen fährt man durch das Tor. Auch mich hat man hierhergefahren. In einem Polizeiwagen. Der hielt dann direkt vor dem Gebäudeeingang an der Innenseite, so nahe, dass die Gefangenen nicht gesehen wurden, die angeliefert wurden. Vermutlich war das Absicht, denn die Insassen hingen häufig vor ihren vergitterten Fenstern und sahen auf den Hof. Ich auch.
Es war eine schmutzig-graue, bröckelige Fläche, eine Kreisfläche von etwa sechzig Metern Durchmesser in der Mitte, eher einem ungepflegten Spielplatz ähnlich als einem Gefängnishof. Einmal am Tag, meistens abends, konnten ausgewählte Gefangene den Platz betreten und dort spazieren gehen. Natürlich nicht alle. Das wären zu viele gewesen. Ich schätzte sie auf vierhundert. Aber genau wusste ich es auch nicht, als ich dort eingesperrt war. Man hatte mich erwischt.
Es war mein schon lange gehegtes Ziel gewesen, einmal nach Mekka zu pilgern. Die Stadt liegt, wie man weiß, in Saudi-Arabien, in der Region Hedschas, und sie ist die heiligste Stadt der Muslime. Jedes Jahr pilgern mehrere Millionen von ihnen dort hin. Und das wollte ich auch. Ich hatte mir die landessüblichen Kleider besorgt und saß auf der Ladefläche eines Pickups, der mich von der Küste aus in die Stadt mitnehmen sollte. Bezahlen musste ich ihn gleich am Anfang. Da hatte der Fahrer mich bereits danach gefragt und ich hatte ihm versichert, dass ich Muslim bin.
Ich war in Dschidda ausgestiegen, hatte mir die Stadt angesehen. Es ist eine große Stadt und eigentlich wollte ich wieder an Bord. Aber Dschidda ist seit dem siebten Jahrhundert das Tor nach Mekka und für alle Religionen offen. Im Gegensatz zu Mekka. Und zu der Zeit war gerade Hadsch. Das war nicht zu übersehen. Im Hafen kamen Tausende und Abertausende an, in Schuten, Booten, Bussen, Transportern und anderen Fahrzeugen, und suchten Fahrgelegenheiten für die etwa achtzig Kilometer bis Mekka. Da hatte ich die Idee, das auch zu machen. Das war mal was Besonderes, dachte ich.“
Storekeeper Wessel sieht kurz von seinem Buch auf, als wollte er sich versichern, dass auch alle gut zuhören.
„War das auch. Kurz vor Mekka stand ein großes Schild quer über der Autostraße. ‚Muslims only‘ war geradeaus, ‚For non muslims‘ ging rechts ab. Mein Fahrer fuhr geradeaus. Da war es zu spät für mich umzukehren.
Natürlich war mir bekannt, dass Mekka eine verbotene Stadt ist. Was ich nicht wusste, war, wie ernst das gemeint war. Da in der Gegend nimmt man ja auch anderes nicht immer so genau, dachte ich mir. Vor der ersten Straßensperre kroch ich unter die Plane, die die Ladung abdeckte. Es waren Kartons mit Wasserflaschen. Viele. Wenige Minuten nachdem wir weitergefahren waren, hielt der Fahrer auf einem kleinen Platz, wo nicht so viele Leute waren, und ließ mich aussteigen. Ihm war die menschliche Fracht wohl nicht ganz geheuer.
Von da ab ging alles ganz einfach. Ich brauchte nur den Menschen zu folgen. Es wurden immer mehr. Man konnte gar nicht mehr raus aus der Menge. Als es dunkel wurde, beobachtete ich, was die anderen machten. Viele hatten ein Quartier, in das sie gingen, einige aber, die im Freien schlafen wollten, hatten eine Unterlage. Ich nicht. Also setzte ich mich etwas abseits mit dem Rücken an eine Mauer, um etwas zu schlafen. Bis jemand an mir rüttelte. Da war es geschehen. Ich war einem von den vielen Aufsehern aufgefallen. Meine Schuhe hatten vorne kein Loch, waren geschlossen, was verboten war für den Ihram, den Weihezustand beim großen Hadsch. Und so landete ich im Gefängnis.
Gleich am ersten Tag hörte ich den Lärm. Eine Gruppe von Männern führte einen Gefangenen in die Mitte des Sandplatzes. Richtiger gesagt, sie schleppten ihn dahin, denn er kreischte, wehrte sich, schrie vor Schmerz, wenn sie ihm die Arme auf dem Rücken noch weiter hochdrehten, damit er in Bückhaltung zur Platzmitte kroch.
‚Er ist dran mit Handabhacken‘, sagte mein Mitgefangener.
‚Warum?‘, fragte ich und starrte durch die Gitterstäbe auf die grausame Szene.
‚Ich weiß es nicht‘, sagte er, ‚vielleicht hat er gestohlen. Unsere Religion schreibt dafür Handabhacken vor. Aber kann auch was anderes sein. Wer die Kirchengesetze nicht befolgt, wird bestraft. Auspeitschen, Handabhacken und so.‘
Mir zog sich der Magen zusammen.
‚Sie machen das immer auf dem Platz da. Damit alle das mitkriegen.‘ Dann sah er nach draußen.
Ein dicker Hauklotz stand dort und ein rostiges Fass, unter dem man ein Feuer gemacht hatte. Einer der Wärter war für das Abhacken verantwortlich. Andere für die Gewalt, um den Gefangenen zu fixieren. Gleich nachdem die Amputation erfolgt war, steckten sie den Arm in das Fass. Das Geschrei des Mannes war nicht zu ertragen. Dann fiel er in eine gnädige Ohnmacht. Ich sah meinen Mitgefangenen an.
‚Da ist kochendes Öl drin‘, erklärte er. ‚Zur Desinfektion. Damit er nicht stirbt. Allah ist groß und mächtig.‘“
„Und was war mit dir?“, fragt der dicke, blonde Matrose aus Husum.
„Ich war auch erst für Handabhacken vorgesehen. Aber dann haben sie mich laufen lassen. Der Agent von unserer Reederei hatte genügend Freunde und was man sonst noch so braucht. Den Hadsch habe ich aber nicht mitmachen können. Ich hab auch nie geglaubt, dass ich das wirklich wollte. Bin ja nur aus Versehen da hingekommen.“
Alfred Wessel ist noch kleiner und schmaler geworden während seiner Lesung. Der Zimmermann, der an der anderen Seite der Back sitzt, schüttelte immer leicht den Kopf. Er steht schon kurz vor der Rente. Jetzt ist es ein deutliches Kopfschütteln.
„Wie viele Verbrechen hat es gegeben im Namen von Religionen seit Menschengedenken? Von Menschenopfern über Handabhacken bis Blendung. Früher brauchte man Götter im Dutzend, um seine Irrtümer zu erklären. Heute genügt einer in jeder Region. Und alle wissen, dass ihrer der einzig richtige ist.“
„Na, nun backt mal ab“, sagt der Bootsmann zu den Decksjungen. „Wir ändern die Welt nicht mehr. Die wartet nicht auf uns. Aber die Arbeit. Es ist Zeit.“
Nun stehen alle auf und gehen aus der Messe. Nur die beiden Jungs sieht man noch Backschaft machen.
Der eine war höchstens vierzehn. Harald hieß der, glaube ich. Aber den hat Hans erst viel später kennengelernt. Hier auf der Straße mit dem Grünstreifen in der Mitte und den neu gepflanzten, biegsamen Alleebäumen ist Hans ja noch ein Junge in ganz kurzen Hosen.
8. Kupfermühle
Zum Mädchengymnasium hat er nur gut hundert Meter zu laufen. Ganz oben ist der Gymnastikraum. Man muss erst die mächtige, steinerne Treppe hoch, mit dem abgerutschten Holzgeländer. Jetzt, wo ich die sehe, kommt mir doch die Idee, mich noch mal draufzusetzen, ein halbes Stockwerk runterzurutschen, so wie früher. Aber natürlich ist mir sofort klar, dass das jetzt nicht mehr geht. Außerdem will ich den Jungen sehen, also hoch, nicht runter. Nun muss man durch die breitflügelige Mahagonitür. Moment mal, das ist ganz schön schwer mit dem hydraulischen Türschließer. Ja, hier ist es. Jede Menge Tischtennisplatten.
Hinten in der Raummitte, in der letzten Reihe, da sehe ich ihn. Eine braune, samtartige, kurze Hose hat er an. Sehr kurz, zu kurz scheint mir. Das fällt heute richtig auf: Der größte Teil seiner Oberschenkel ist nackt. Und eng ist sie! Und neu. Leider zu klein gekauft. Aber eine größere dieser Art hatte das Kaufhaus nicht. Und ein anderes Modell konnte seine Mutter nicht aussuchen. Sie hatte in einer Art von Notwehr ihren obersparsamen Mann überlistet, um notwendige Kleidung für ihre Kinder zu besorgen. Die DEBEKA, das deutsche Beamtenkaufhaus, bot einen Kredit in Höhe von fünf Monatsraten an. Da hat sie zugeschlagen, ohne ihn zu fragen. Damit waren Fakten geschaffen. Er musste eine Rate jeden Monat überweisen und sie hatte einmalig für einen Einkauf in Höhe des Fünffachen und für jeden Monat der Rückzahlung wieder den einfachen Betrag zur Verfügung. Deshalb die zu knappe Hose. Er findet sie gut und das ist schließlich die Hauptsache.
Er ist auch gut anzusehen, dort an der Platte, in seinen jungenhaft geschmeidigen Bewegungen. Die Dame, die mit ihm trainiert, mag ihn auch. Das merkt man. Nicht nur, dass er hübsch anzusehen ist. Sie freut sich besonders über seinen bedingungslosen Eifer. So, als wäre das Tischtennisspielen das Wichtigste von der Welt. Er springt von einer Seite der Platte zur anderen, starrt jeden Ball mit weit aufgerissenen Augen an, als wollte er ihn aufsaugen, und nimmt jedes Wort auf, das die Trainerin sagt. Sie ist schon etwas älter, aber sie weiß offensichtlich genau, was nötig ist.
„Ziehen, Hans, ziehen!“
Immer wieder spielt sie ihm den Ball auf seine Vorhand. Hans übt schmettern.
„Ziehen, Hans, ziehen.“
Wenn das man so einfach wäre! Schließlich muss man dabei auch noch den Ball treffen. Und wenn er die Platte verfehlt, rennt Hans los, um ihn zu holen. So schnell wie möglich muss die weiße Kugel wieder auf die Platte, ins Spiel. Nur keine Pause! Seine Welt hat die Größe einer Tischtennisplatte!
Nicht zu vergleichen mit früher, beim Fußball. Das große, schlackebedeckte Sportfeld des Gymnasiums war auch schnell zu erreichen. Nur sein Verein hatte keine Fußballabteilung. Dafür aber Handball. Seiner Mutter war das auch viel lieber. Ihr war der Fußballsport für den geliebten Jungen zu rau. Handball ja, das durfte er.
Die schwarze, kurze Turnhose und das Sporthemd mit kurzen Ärmeln, auch schwarz, aber mit rot abgesetzten Rändern und dem ovalen Vereinsemblem auf der Brust, war das Erste, was er brauchte. Mehr zufällig, der Nähe der Sportstätten geschuldet, war Hans also Mitglied des zweitältesten Sportverein Hamburgs geworden. Und das war eine glückliche Fügung. Alles, was ihm für sein weiteres Leben wichtig schien, baute darauf auf.
Jetzt sieht man, wie er gleich nach der Schule durch die Straßen rennt. Natürlich läuft er wieder. Nicht weil er die Schularbeiten verdrängt hat. Man sieht es ihm an: Sein Bewegungsablauf kennt nur laufen. Jetzt geht er in das Haus dort, den ziegelroten, wiederaufgebauten Wohnblock an der Friedhofstraße, zwei Stockwerke hoch, klingelt und gibt einen kleinen, selbst ausgefüllten Zettel ab.
„Ingo darf doch kommen?“, fragt er.
Die Frau sieht kurz auf den Zettel und bewegt leicht zweifelnd den Kopf.
„Er muss kommen! Sonst sind wir nicht voll!“
„Na gut“, sagt sie und schließt die Tür.
Hans springt die Treppen runter. Dann rennt er erleichtert weiter zur Wandsbeker Chaussee. Auf der anderen Seite beginnt der Neue Weg. Es geht etwas bergab, Richtung Eilbeker Krankenhaus. Aber schon vor dem Eilbektal verschwindet er wieder in einem Wohnblock. Das ist auch gut so, weil mein Bild wechselt. Es wird wässrig, tritt höflich zurück und ein anderes drängelt sich vor. Nicht, dass ich das wollte, nein, meine Augen wollen dahin, zum Eilbektal, genau dorthin, wo die Backsteinkirche steht.
Da kommt ein ganz kleiner Junge aus dem Eingang eines vornehmen Altbaus mit gekacheltem Eingang und Marmorgehplatten. Er geht an dem schmiedeeisernen Zaun des Minivorgartens entlang, bleibt an der Straße stehen und schaut auf die andere Seite zum kieselbelegten Vorplatz der Kirche. Er sieht ihn als riesig an. Und die Kirche reicht für ihn bis in den Himmel. Es gibt keine Autos auf der Straße. Der kleine Junge überquert sie, macht die Pforte zur Kirche auf und ist in seiner Welt. Die vielen kleinen Kieselsteine sind seine Spielkameraden. Da hockt er auf dem sandigen Platz, sammelt, verteilt, ordnet und die Sonne und der kirchliche Frieden lassen ihn in seiner Fantasie. Ich weiß, am nächsten Tag konnte er das Tor nicht mehr öffnen, in die Welt des Hausherren passten keine kleinen Steinesammler, nur große, die das Haus Gottes größer und mächtiger werden lassen.
Eigenartig. Mir fällt auf, dass weit und breit keine Ruinen zu sehen sind! Das muss eine andere Zeit sein! Es ist ärgerlich. Warum blenden die Bilder so unordentlich ein? Das kann mein Laptop besser. Nein, auch das Weihnachtsfest dort in dem vornehmen Altbau gehört viel weiter an den Anfang. Die reichliche Bescherung war schon. Das Kleinkind hockt auf dem vornehmen Teppich. Der Hausherr, Anfang dreißig, gut genährt, gute Zigarre, sitzt wohlig im Ledersessel und schaut ihm zu. Eine Spielzeuglokomotive und ein Handwerkskasten liegen auf dem Fußboden. Es ist also ein Junge, der seine Weihnachtsgeschenke ausprobiert. Was man mit dem Hammer macht, hat er schon gesehen. Und das probiert er jetzt an seiner Lokomotive aus. Als die Hausfrau in die Tür tritt, strahlt er sie an.
„Mama.“
Und nun zeigt er ihr, was er gelernt hat. Nimmt den Hammer in die kleine Faust und testet die Standfestigkeit der Blechlokomotive mit zunehmender Intensität. Immer feste druff!
„Aber Hans, nicht doch!“, ruft die Mutter und der Vater sitzt im Sessel und amüsiert sich köstlich über die Tatkraft seines Sohnes.
Schluss jetzt! Ich muss zurück, oder besser gesagt vorwärts, da kommt Hans wieder aus dem Haus in der Neuen Straße. Wieder ist er eine Spieleinladung losgeworden, hat einen Zettel weniger und eine Zusage mehr. Das war das Wichtigste. Er war Mannschaftsführer! Wie alt mag er da sein? Elf oder zwölf, denke ich.
Er hat die Schule gewechselt. Besucht die Mittelschule in Hamm. Auch dort gibt es eine Schulmannschaft, in der er spielt. Aber nur unter ferner liefen. Er hat keinen guten Schuss. Genau ja, sichere Ballbehandlung ja, aber eben keinen Bums! Dafür gab es andere. Peter Sigl zum Beispiel, den Kraftprotz, einen Kopf größer als Hans. Der spielte im Nachbarverein, HT 16, in der ersten Jugend. Die glaubten immer, was Besseres zu sein, weil sie noch älter waren, von 1816, und damit die Ältesten in Hamburg. Die waren so vornehm, dass sie sich gleich nach dem Krieg eine eigene Sporthalle bauen konnten, in der Zeit, als in der Gegend noch viel Gelände in Trümmern lag. Hans trainierte im Winter in der zu kleinen Schulturnhalle am Burgweg oder so ähnlich, irgendwas mit Burg, die ihnen die Behörde stundenweise lieh.