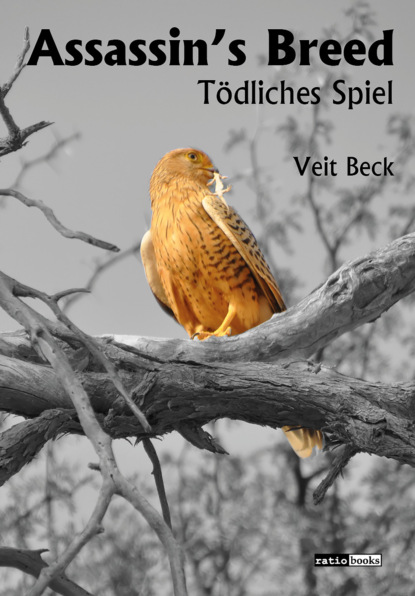- -
- 100%
- +
„Sie haben das, was wir brauchen“, setzte Leo fort. „Was wir unbedingt brauchen, weil es unsere letzte Spur sein dürfte. Alle anderen Möglichkeiten hat Dimitri schon durch seine Untersuchungen ausgeschlossen. Also bleibt uns nur das digitale Vermächtnis des Jungen.“
„Und wie hast Du Dir das vorgestellt?“, fragte Boris und legte seine hohe Stirn in Falten.
„Da bin ich offen für Vorschläge“, spielte der Consultant den Ball mit einem Lächeln zurück.
„Da Du mich mit Deinem Vorhaben zugegebenermaßen überrascht hast, muss ich darüber noch nachdenken. Bevor wir uns da festlegen, sollten wir auch noch Erkundigungen einziehen. Wir müssen uns den Laden erst ansehen, Sicherheitseinrichtungen, Zuständigkeiten und den ganzen Kram. Wir sind ja nicht die Polizei, können da nicht mit einem Durchsuchungsbeschluss einmarschieren, die Bude auf den Kopf stellen und mitnehmen, was uns interessiert.“
„Wie lange wirst Du brauchen?“, fragte Leo.
„Keine Ahnung. Und erspare uns Deine Vorgaben oder Wünsche“, ergänzte Boris mit leicht angehobener Lautstärke, als der Consultant ansetzte ihn zu unterbrechen. „Ich weiß, dass wir es eilig haben. Deshalb verschwinde jetzt und lass mich meine Arbeit machen. Du bekommst Bescheid, sobald ich genügend Informationen habe. Es war mir ein Vergnügen.“
„Ich erwarte Deinen Anruf“, sagte der Consultant. Er erhob sich, reichte Boris die Hand über den sie trennenden Schreibtisch und verließ den Raum.
25.
Endlich! Er hatte gefühlt schon mindestens fünfzigmal in dem geheimen Briefkasten nachgesehen. Der Meister war nervös gewesen, hatte Zweifel gehabt, wusste, dass er sich nicht die eigentlich notwendige Zeit bei der Auswahl genommen hatte. Musste er den Neuen auch abschreiben, genauso wie diesen Marc Johann? Denn der würde nicht mehr zurückkommen. Nachdem er Tage auf ein Lebenszeichen gehofft hatte, musste er jetzt hoffen, dass Marc tot war und sein Geheimnis, ihr Geheimnis mit in sein Grab genommen hatte. Das war schade. Weil er Potenzial in dem Jungen gesehen hatte. Drei Aufträge hatte er für ihn schon ausgeführt. Richtige Aufträge, keine Probearbeiten, kein bloßes Einwerfen der Scheibe eines Ladenlokals, wie es der Nachfolger heute Morgen machen sollte. Aber immerhin hatte der Nachfolger die regionale Lücke geschlossen. Das war auch ein Parameter bei der Auswahl seiner Gefolgsleute, die Regionalität. Er versuchte mit seinen Jüngern, ein die Bundesrepublik möglichst überspannendes Netz zu bekommen. Das vermied lange Reisen. Nicht, dass es ihm um das Sparen von Reisekosten gegangen wäre. Die zahlten seine Gefolgsleute selber. Aber Auswärtseinsätze waren langwieriger in der Vorbereitung. Natürlich wollten und sollten, die mit der jeweiligen Ausführung der Taten beauftragten Jünger sich die Ausführungsorte vor der Tat ansehen. Nach Deckungen und Fluchtmöglichkeiten suchen, möglichst gute Zeiten für die Durchführung ausbaldowern. Insbesondere letzteres konnte, zum Beispiel wenn Personen das Anschlagsziel waren, schon einiges an Beobachtungszeit erfordern. Um die Lebensgewohnheiten der Zielpersonen kennenzulernen, mussten sie beschattet werden. Und das war nicht einfach für einen Jugendlichen in einer fremden Stadt, insbesondere, wenn er morgens zur Schule musste. In seiner Heimatstadt.
Da! Endlich hatte sich der Neue zurückgemeldet. Hastig überflog der Meister den Bericht in dem Briefkasten.
„… erfolgreich ausgeführt!“, waren die letzten Worte. Damit war er zufrieden, aber der Rest des Berichts zeigte ihm, dass der Neue noch nicht so weit war. Drei Stunden war der Junge laut seinem Bericht um sein Ziel herumgeschlichen, zu einer Zeit, in der es in der Nähe des Tatortes, wie es ebenfalls in dem Bericht stand, „gottverlassen“ war. Da wäre es besser gewesen, schnell zuzuschlagen, anstatt zu riskieren, durch immer neue Annäherungen an das Ziel aufzufallen. Im ungünstigsten Fall sogar noch gefilmt zu werden. Es gab immer mehr Kameras und die wurden immer kleiner, konnten häufig nur mit Mühe und Glück entdeckt werden. Doch egal. Grübeln half hier nichts mehr. Er würde abwarten müssen, ob der Junge erwischt werden würde. Bis dahin würde er ihn in Ruhe lassen müssen, schon zur Sicherheit, um keine aktuellen Bande zwischen ihnen zu etablieren, die für Verfolger zur Spur werden könnten. Nur eines blieb im Moment noch zu tun. Den Neuen an sich zu binden, ihn zu belohnen, ihn in die Gemeinschaft aufzunehmen. „Gut gemacht!“, schrieb er in einen neuen, extra für die Antwort erstellten Briefkasten.
„Kauf Dir einen grauen Hoodie. Aber in einem großen Geschäft. Nicht im Internet bestellen. Ich melde mich für einige Zeit nicht. Sieh aber täglich nach, ob wir Dich brauchen.“
26.
Es hätte nicht passieren dürfen, aber natürlich war es passiert. Sie hatte ihn getroffen. In der Kaffeeküche. Und hatte sie es schon als schwierig empfunden, ihre Gefühle im Besprechungsraum zu kontrollieren, so erschien ihr dies nun rückwirkend als leichte Übung. Dort war sie vorbereitet gewesen, geschützt auch durch das Korsett der Öffentlichkeit. Diese Hilfen gab es in der Kaffeeküche nicht, dort war sie ungeschützt, überrascht. Als sie um die Ecke bog, die Gedanken auf den Fall gerichtet und dann so plötzlich in ein Chaos stürzte. Da waren sie wieder, die Gefühle aus der Vergangenheit. Die Begierde war wie ein Tier, hatte das in Sekunden freigescharrt, was sie über Monate zu vergraben versucht hatte. Sofort hatten sich ihre Augen getroffen. Und was sie gesehen hatte oder zu sehen geglaubt hatte, hatte ihre Gefühlswelt in ein noch größeres Chaos gestürzt. Schmerz, Trauer, Hoffnung und Angst, alles in einem Blick, in zwei Augenpaaren.
„Hallo“, hatte sie gestammelt und so ein Gespräch eröffnet, das nicht zu ihrer beider Gedanken und Gefühlen passte. Belangloses Geschwätz über den Fall, um abzulenken von den eigentlichen Gefühlen, um sie zu unterdrücken, nicht gleich zu kapitulieren. Fast war sie froh gewesen, als Strecker hinzukam und die Intimität des Augenblicks sprengte. Überrascht, fast beschämt hatten sie ihre Köpfe gesenkt, den Blickkontakt abgebrochen und begonnen, sich auf ihr Gespräch zu konzentrieren. Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit hatte sie dann die Flucht ergriffen. Doch es war zu spät. Es war als hätte eine Harpune ihr Herz getroffen und je weiter sie sich von ihm wegbewegte, desto straffer wurde das Seil, desto schwerer wurde die Last, desto größer wurde der Schmerz.
Jetzt saß sie wieder mit Marten und Strecker im Büro. Doch nur körperlich, ihre Gedanken waren woanders, kreisten um ihn, gleich Trabanten, die ihren Planeten umkreisen, ihn aber nicht erreichen können.
Nur gedämpft, wie durch eine dicke Watteschicht, vernahm sie die weit entfernte Stimme von Kommissar Marten, der versuchte, ihnen die Welt zu erklären. Die Welt der Spiele, die nichts mit ihrem Leben und ihren Gefühlen zu tun hatte. Denn das war kein Spiel.
„Viele Spiele werden heutzutage online gespielt“, erläuterte der Kommissar. „Das impliziert, dass die Spielprogramme nicht auf den Rechnern der Spieler installiert sind, sondern auf den Servern der Anbieter. Bevor Missverständnisse auftreten. ‚Assassin’s Creed‘ ist gar kein typisches Onlinespiel. Die dritte oder vierte Ausgabe hatte zwar eine entsprechende Erweiterung für das Zusammenspiel mehrerer Spieler enthalten, doch andere Spiele setzen deutlich mehr auf Kooperation der Spieler. Aber ‚Assassin’s Creed‘ passt halt gut von der Geschichte her. Eine verschworene Gemeinschaft, die Anschläge ausführt, eben ganz wie in unserem aktuellen Fall. Zusammenarbeit wird am intensivsten in Kriegsspielen genutzt, insbesondere in solchen, in denen kleine militärische Spezialeinheiten schwierige Aufträge durchführen. Typische Vertreter heißen ‚Counterstrike‘, ‚Call of Duty‘. Natürlich gibt es auch Sport- und Rennspiele oder auch Mischformen, wie ‚Grand Theft‘. Es gibt Hunderte solcher Spiele und täglich kommen neue hinzu. Der vermisste Junge hat aber fast ausschließlich Kampfspiele gespielt. Viele dieser Spiele bieten neben dem eigentlichen Spiel Funktionen, mittels derer die Spieler während des Spiels miteinander kommunizieren können. Aber diese spielspezifischen Kommunikationshilfen braucht man gar nicht unbedingt, denn es gibt auch eigenständige Programme, die die Kommunikation zwischen den Nutzern während des Spielens ermöglichen. In der Regel über Chat- oder Sprachkanäle. Das wahrscheinlich meist genutzte Werkzeug heißt ‚Teamspeak‘, aber derzeit boomt ein neues namens ‚Discord‘. Auch diese beiden Programme, das hat die Analyse seines Rechners gezeigt, hat Marc Johann benutzt. Ihr seht, das Feld ist groß und wird täglich größer. Aber Details müsst Ihr wahrscheinlich gar nicht kennen, nur dass man heutzutage jederzeit von jedem Ort mit Internetzugang mit jedwedem beliebigen anderen Spieler zusammenspielen und dabei per Sprache oder Chat kommunizieren kann. Das ist unsere Aufgabe, die der IT-Spezialisten, diese digitale Welt zu durchsuchen und Spuren zu finden. Spuren, die in die reale Welt führen, wo Ihr sie dann weiterverfolgen könnt.“
27.
Diesmal war es anders. Er fühlte sich anders. Größer. Hatte er sich früher nur mit Widerwillen, fast mit Angst auf den Weg gemacht, so konnte er es dieses Mal kaum erwarten hinzukommen. Dass das Wetter widerwärtig war, dass es stürmte und es regnete, war ihm egal. Der Regen perlte an ihm ab, der Wind biss, aber er ignorierte den Schmerz. Er hatte sich eingehüllt in seine Gedanken, fühlte sich mächtig und unangreifbar. Was konnte ihm da so ein bisschen Wetter schon anhaben. Im Bus saß er wie immer schweigsam auf seinem Platz. Die Augen starr auf das Display seines Handys gerichtet, den Rest der Außenwelt sperrten seine Kopfhörer aus. Auf seinem Smartphone lief zwar ein Video, aber davon bekam er eigentlich gar nichts mit. Denn in seinem Kopf lief ein ganz anderer Film ab. Immer wieder sah er den Stein auf die Scheibe aufschlagen und zurückprallen, sah das kleine Loch in der Scheibe, die sich schnell ausdehnenden Risse und hörte das ohrenbetäubende Getöse, als alles undurchsichtig wurde und das Glas in tausend kleine Stücke zerbrach und mit lautem Geschepper auf die Straße und in die Auslage fiel.
Fast hätte er seinen Halt verpasst. Gerade noch rechtzeitig bemerkte er, dass alles um ihn herum in Bewegung geraten war, sich eine Unmenge von Leibern, drängelnd und fluchend in Richtung der Türen bewegte und sich in den, sich aus mehreren Bussen nährenden Strom von Schülern mischte, der sich langsam über den Hof auf den Eingang des Schulgebäudes zubewegte. Rasch raffte er seine Utensilien zusammen, verstaute das Handy in der Jackentasche, warf sich seinen Rucksack über die rechte Schulter und schloss sich der Prozession an. Er war einer von Vielen, obwohl er nun gar nicht mehr so recht dazugehörte, denn er war nun auch einer von Wenigen, einer der Auserwählten. Gestern hatten sie sich noch über ihn lustig gemacht, aber schon bald würden sie ihn fürchten. „Ein Wolf unter Lämmern“, dachte er sich, während er sich die Kapuze über den Kopf zog. Und der Wolf, der war er.
28.
Boris hatte keine Zeit verloren. Denn er wusste, dass die Angelegenheit drängte. Er war als umsichtig bekannt, versuchte die Zukunft zu antizipieren und hatte seinen Chef schon zahlreiche Male damit überrascht, ihn verblüfft, wie schnell die Organisation handlungsfähig war. Aber einen Einbruch beim BKA, wie hätte er den voraussehen und vorbereitende Maßnahmen treffen können? Aber er hatte. Natürlich hatte er keine Baupläne, Schlüssel oder Zugangscodes. Aber einen Informanten, den hatte er. Und er war, rückblickend betrachtet, gar nicht teuer gewesen. Gestern hätte Dimitri die Angelegenheit wahrscheinlich noch anders beurteilt. Was Boris durchaus hätte nachvollziehen können, denn wenn du jeden Monat 1000 Euro an jemanden zahlst und keinerlei Gegenleistung dafür bekommst, dann sieht das erst einmal nach einer schlechten Investition aus. Das war im Übrigen nicht die einzige Position dieser Art in ihrem Budget. Und viele dieser Positionen hatte er in der Vergangenheit gegenüber Dimitri verteidigen müssen. Was meist schwierig war, denn wenn man Geld für Vorsorge ausgibt, hat man erst einmal nichts davon. Jetzt etwas geben, um später vielleicht davon zu profitieren, fällt vielen schwer. Er hatte immer damit argumentiert, dass diese Positionen wie Versicherungen zu betrachten sind. Dargestellt, dass man jetzt ein wenig gibt, um später im Bedarfsfall den Schaden zu minimieren. Aber eine solche Argumentation bleibt natürlich immer hypothetisch. Es sei denn, du bekommst einen Präzedenzfall. Und den hatte Boris jetzt.
„Nein, Du suchst ihn noch heute auf und erklärst ihm, was wir erwarten. Und morgen Abend habe ich das Ergebnis. Als Erstes möchte ich nur wissen, wer sich um den Fall kümmert. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt“, sprach Boris in die Muschel seines Telefons. „Morgen Abend“, setzte er fort, nachdem er einige Sekunden schweigend zugehört hatte. „Mach ihm klar, dass wir es nicht dabei belassen, die Zahlungen einzustellen, wenn er nicht pünktlich liefert.“
Bevor sein Gesprächspartner noch weitere Erläuterungen geben konnte, um ein potenzielles Scheitern zu rechtfertigen, beendete Boris einfach das Gespräch. Solche Menschen konnte er nicht leiden. Die, anstatt zu überlegen, wie man erfolgversprechend vorgehen könnte, gleich tausend Gründe suchten und erläuterten, die zum Scheitern führen konnten. Was machte das denn für einen Unterschied? Am Ende zählte immer nur das Ergebnis. In allen Organisationen. Natürlich hatte ein Scheitern in ihrer Organisation meist besonders unangenehme Konsequenzen für die Verantwortlichen. Aber das wussten sie alle, im Voraus. Und außerdem hatten sie bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen auch mehr Möglichkeiten, wurden nicht durch Gesetze oder Vorschriften unnötig eingeengt. Morgen Abend würde er mit den notwendigen Informationen beliefert, um sie am Morgen darauf dem Consultant liefern zu können. Er war mit sich zufrieden und auch Dimitri und der Consultant würden mit ihm zufrieden sein.
29.
Das war die Art von Arbeit, die er liebte. Vor Ort schnüffeln, mit Menschen reden, Verdächtige und Zeugen befragen, rhetorische Fallen stellen und sich Tatorte und Umgebungen ansehen. Oder nach Tatorten suchen, so wie er es im Augenblick tat. Seit zwei Stunden streifte Hauptkommissar Strecker jetzt schon durch die Kölner Innenstadt, durch die nördliche Innenstadt um genau zu sein, durch die Gegend um den Ebertplatz. Wenn sich ein Rudel junger Menschen trifft, um eine Straftat zu begehen, ist es doch unwahrscheinlich, dass sie sich an einem Ort treffen, der nichts mit dem eigentlichen Zielort zu tun hatte. Sie konnten ja schlecht mit den Öffentlichen zum vorgesehenen Tatort fahren, riskieren aufzufallen oder von den Kameras in den Fahrzeugen aufgenommen zu werden. Nein, der Ort, den er suchte, musste hier ganz in der Nähe sein. Aber es ist schwierig etwas zu finden, wenn man eigentlich gar nicht weiß, wonach man sucht. Neben dem sich entwickelnden Frust, ob seiner Erfolglosigkeit, machte ihm auch die Kälte zunehmend zu schaffen. „Jetzt mal analytisch“, ermahnte er sich gedanklich selbst. „Wenn eine solche Horde junger Menschen aktiv wird, bleibt das doch nicht unbemerkt. Das wird hektisch, das wird laut, das muss doch jemandem auffallen. Dadurch fühlt sich doch irgendjemand gestört. Und vielleicht hat sich dieser Jemand beschwert.“
Strecker kramte mit klammen Fingern sein Handy aus der Manteltasche und wählte eine ihm mehr als vertraute Nummer.
„HK Garber“, kam aus dem Lautsprecher.
„Strecker hier“, antwortete er. „Ich wildere in Ihrem Revier und brauche Ihre Hilfe. Genau genommen suche ich den Ort an dem Marc Johann und seine Kumpanen aktiv geworden sind. Könnten Sie mal die Leitstelle anrufen und nachfragen, ob in der Nähe des Ebertplatzes, sagen wir mal im Radius von einem Kilometer und innerhalb einer Zeitspanne von vielleicht zwei Stunden nach dem beobachteten Treffen, irgendwelche Meldungen eingegangen sind? Notrufe, Beschwerden über Ruhestörungen, einfach alles. Bitte schicken Sie mir das Ergebnis auf mein Handy.“
„Gut“, antwortete die Hauptkommissarin. „Ich kümmere mich gleich darum. Brauchen Sie Unterstützung?“
„Danke, nein“, sagte er. „Ich werde hier nicht verloren gehen. Höchstens erfrieren, wenn es zu lange dauert.“
„Das ‚Café Schmitz‘ soll geheizt sein“, bemerkte Frau Garber. „Es sollte aber nicht lange dauern. Ich melde mich.“
„Danke. Ich warte. Voller Ungeduld“, antwortete er, beendete das Gespräch und spazierte, mit hochgezogenem Mantelkragen den Ring herunter, Richtung Café. „Wirklich schön warm“, dachte er, nachdem er das Café betreten hatte. Strecker fand einen freien Platz an einem Tisch mit Fensterblick, öffnete den Mantel und ließ sich in den bequemen Stuhl fallen. Während er auf seinen Kaffee, schwarz und ohne Zucker wartete, blickte er gedankenverloren aus dem Fenster. „Irgendwo dort draußen liegt der Anfang zu der Spur zu Marc Johann“, sinnierte er. „Jetzt fange ich auch schon an mit dem Smartphone zu spielen, meine Zeit mit dem Betrachten von unnützen Bildern und unnötigen Nachrichten zu vergeuden“, dachte er und legte das Handy, mit dem er fast unbemerkt zu hantieren begonnen hatte, neben die Kaffeetasse auf den Tisch.
Doch besser fühlte er sich nicht. Das Warten zerrte an seinen Nerven. Geduld war noch nie seine Stärke gewesen. In seinen Gedanken ging er immer wieder durch die Gegend rund um den Ebertplatz. Wozu braucht man eine Gruppe von Jugendlichen?
Er hatte keinen Schimmer. Keine diskrete Aktion, wie die Beschädigung eines geparkten Fahrzeugs. Kein Anschlag auf eine Person. Das hätte zu viel Aufmerksamkeit erregt. Was es auch war, es musste sich irgendwo innerhalb eines Gebäudes abgespielt haben.
Ein „Ping“ seines Handys riss ihn aus seinen Überlegungen. Er griff sich das Telefon, öffnete die Nachricht und hatte die Lösung. Strecker erhob sich, knöpfte den Mantel zu, warf drei Münzen auf den Tisch, verstaute das Handy in der Manteltasche und stürmte grußlos aus dem Café. Er war sich sicher, musste das aber noch verifizieren, nicht für seine Überzeugung, sondern für die Kollegen. Bis in die Sudermannstraße waren es nur zwei Minuten. Genauso wie es auch nur zwei Minuten vom Ebertplatz zur Sudermannstraße waren. Dann stand er auch schon vor dem „Queens“, einem Lokal mit wechselhafter Geschichte, mit wechselnden Besitzern und wechselnden Angeboten. Aktuell war das Angebot auf den anspruchsvollen Gentleman ausgerichtet und die Besitzer waren, wenn man den einschlägigen Gerüchten glaubte, Mitglieder der russischen Mafia. Und ohne noch mit dem Bewohner aus dem gegenüberliegenden Mietshaus, der ungewöhnlichen Lärm am Tatabend gemeldet hatte, sprechen zu müssen, waren nun zwei Dinge klar. Erstens: Der Club war wegen Renovierung geschlossen. Wahrscheinlich war er durch einen Überfall beschädigt worden. Zweitens: Der Überfall war nicht angezeigt worden. Folglich gehörte der Club jemandem, der an Ermittlungen der Polizei nicht interessiert war. Vielleicht auch deshalb, weil er etwas mit dem Verschwinden von Marc Johann zu tun hatte. Vielleicht, weil der Junge dabei helfen sollte, die anderen am Überfall Beteiligten zu finden. Was auch den Einbruch bei den Johanns erklären dürfte. Das Puzzle fügte sich zusammen. Ein Teil jedoch würde aber künftig mit Sicherheit nicht mehr dazugehören. Sofern seine Theorie richtig war, musste man davon ausgehen, dass sie Marc Johann nicht mehr lebendig auffinden würden. Und seine Mutter war wahrscheinlich ein weiteres, auf ewig fehlendes Puzzleteil.
30.
„Das hätte nicht passieren dürfen“, dachte Hauptkommissar Faber, während er sich selbst im Spiegel betrachtete. Müde Augen, wirres Haar und ein zerknittertes Gesicht zeigten ein deutliches Resultat der letzten Nacht. Einer weiteren Nacht, in der er kaum Schlaf gefunden hatte, weil er dem Schlaf keine Chance gegeben hatte, weil er zu sehr mit Grübeln beschäftigt war. Über Monate hatte er gegen die Gefühle angekämpft, versucht vernünftig zu sein, sich einzureden, dass es besser war, vernünftig zu sein und geglaubt, dass er auf einem guten Weg war. Er hatte versucht, sich auf seine Familie zu konzentrieren, wollte ein Teil der Familie sein. Oder es, um ehrlich zu sein, wieder werden. Denn für einige Wochen war er raus gewesen. Nicht einmal mehr Teil der bereits zur Routine gewordenen Abläufe. Denn er war bei ihr gewesen. Häufig an diversen Orten im Ruhrgebiet, in Cafés, Restaurants und zumeist in Hotelzimmern. Die restliche Zeit in Gedanken, gefangen in einem quälenden Sehnen, nach dem nächsten Treffen gierend. Das begann bereits in dem Moment, in dem er sie verließ, sich von ihr entfernte und es steigerte sich, bis zu dem Tag, an dem das nächste Treffen anstand, bis er sich in seinen Wagen setzte und das Sehnen durch Vorfreude abgeschwächt wurde. Die Tage dazwischen waren eine stetige Qual für ihn, ein nicht enden wollendes Schauspiel, in dem er in der Rolle des Familienvaters gefangen war.
Natürlich blieb seiner Frau seine Veränderung nicht verborgen. War er, beruflich bedingt schon immer oft abwesend, die vielen Dienstreisen ließen seine Abwesenheit für seine erotischen Ausflüge leicht erklärbar machen, so war er jetzt sogar nicht präsent, wenn er zu Hause war. Es waren nur Kleinigkeiten, Antworten und Gesten die Sekundenbruchteile zu spät kamen, Termine, die er vergaß. Selbst ein Heimspiel seines geliebten FC hätte er vielleicht sogar verpasst, wenn ihn sein Sohn nicht daran erinnert hätte. Natürlich fiel auch ihm auf, dass es anders war, dass er anders war. Er zwang sich zu funktionieren. Wie immer, wie vorher, musste sich aber eingestehen, dass ihm dies nicht gut gelang. Also versuchte er Nebelkerzen zu zünden, Ablenkungsmanöver zu gestalten, ihren Blick auf vermeintliche berufliche Probleme zu lenken, ihr von den aktuellen Fällen zu erzählen. In der Hoffnung, dass sie keinen Verdacht schöpfte. Ob das gelang, wusste er nicht. Sie fragte ihn nicht, sie kommentierte nichts, sie beklagte sich nur. Leise, aber beständig. Die Situation wurde unerträglich für ihn, ruinierte sein Leben, beeinträchtigte ihn auch im Beruf. Auch im Dienst war er abgelenkt, unkonzentriert, machte Fehler, reagierte unbeherrscht, unberechenbar. Für einen Bruch, für eine Flucht hatte er keinen Mut. Ein weiter so, war aber auch nicht möglich. Also beendete er die Affäre, er litt wie ein Hund, war aber auch stolz auf sich, dass er es gewagt hatte, dass er es versuchte. Und mit der Zeit wurde es einfacher. Die Erinnerung verblasste, das Sehnen ließ nach, der Alltag gelang ihm nach und nach besser. Er wurde nicht glücklich, aber die Ruhelosigkeit ließ nach, er konnte wieder leben, denken. Der Kopf steuerte, nicht mehr der Unterleib. Bis gestern. Die Besprechung hatte er noch einigermaßen überstanden. Er war vorbereitet, gefasst, konzentriert, hatte sich selbst hypnotisiert, versucht, seine Gefühle zu kontrollieren. Und er war stolz. Weil es ihm gelungen war. Erst gegen Ende der Besprechung fing er an zu wanken, konnte die Besprechung aber beenden, bevor seine Rüstung barst, konnte fliehen, in der Hoffnung es wäre überstanden. Natürlich mussten sie weiter zusammenarbeiten, aber weitere Treffen waren nicht zwingend nötig. Und falls doch, er glaubte, dass er widerstehen konnte. Bis zu dem Moment in der Kaffeeküche. Da war er unvorbereitet, wie damals in Karlsruhe. Es brauchte kein Wort, nur einen Blick und die Flamme brannte wieder. Er wusste, dass er alle belogen hatte, seine Frau, seinen Sohn und sich selbst. Es würde wieder von vorne anfangen. Das wusste er. Alles, was er noch nicht wusste, wo genau vorne war, an welcher Stelle es wieder anfangen würde.
31.
Das war genau der Auftrag, den er sich nicht gewünscht hatte. Nichts passte. Aber auch gar nichts. Weder die Art des Auftrags, noch der Ort. Die Neigung, den Auftrag abzulehnen, nur diesen einen, nur dieses eine Mal, war groß. Warum schon wieder in Köln? Und dann noch ein Mord. In aller Öffentlichkeit. Die Polizei würde sofort erkennen, dass es seine Handschrift war, dass es sein Werk war, falls er den Auftrag annahm und er ausgeführt würde. Aber wem sollte er den Auftrag geben? Ein Mitglied hatte er in Köln verloren. Und der Neue? Der war noch nicht so weit. Der hatte gerade mal eine Scheibe eingeworfen. Der kam also nicht infrage. Also muss ich einen Ortsfremden auswählen. Das bedingt Reisen, braucht einen längeren Vorlauf, erhöht das Risiko. Er hatte ein schlechtes Gefühl. Aber der Preis war gut. Ein Mord war am teuersten, ein Mord auf eine bestimmte, auf eine bestellte Art und Weise, erhöhte den Preis sogar noch. Und wenn es dann noch öffentlich passieren sollte, war das extrem teuer für den Kunden. Für ihn war es demgemäß extrem lukrativ. Trotzdem hatte er ein ungutes Gefühl, nachdem er den Auftrag angenommen, die Bestätigung und die Modalitäten für die Anzahlung versandt hatte.