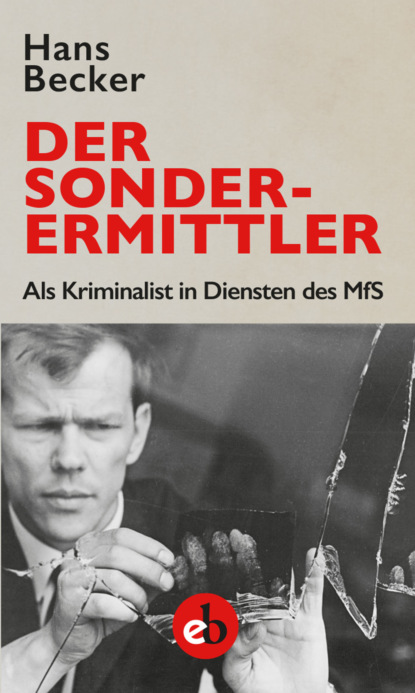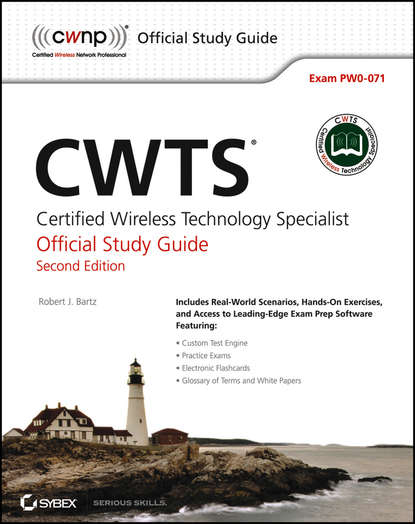- -
- 100%
- +
Das Leben in der MUK war ungleich schwieriger als die Tätigkeit im Präsidium. Die MUK bestand damals aus dem Leiter, mir als Sachbearbeiter, einem Kriminaltechniker und einem Kraftfahrer. Uns stand ein Pkw zur Verfügung, für welchen wir monatlich 3.000 Kilometer Benzindeputat hatten. Das zwang uns oftmals irgendwo weitab von unseren Familien zu übernachten, um nicht kostbare Kilometer für die Heimfahrt zu vergeuden. Durch Ermittlungsarbeit z.B. in Zeitz oder auch in Quedlinburg waren wir oft am Rande des Limits. Dieses ließ sich aber umgehen, indem ich mit einem so genannten Fahrauftrag zum Chef Operativ der Bezirksbehörde, einem alten Kriminalisten, ging, der auf das Formular schrieb »MUK unbegrenzt«. Das Ärgerlichste aber war, dass nur der Kraftfahrer ein Telefon in der Wohnung hatte und wir oftmals eine Woche von der Familie getrennt waren, ohne uns verständigen zu können. So hatten wir auch bei Alarmen, wenn wir uns in der Wohnung befanden, keine Vorwarnzeit. Der Kraftfahrer sammelte uns einfach ein.
Meist hatten wir Totschlagsdelikte, Körperverletzungen mit Todesfolge oder auch so genannte autoerotische Unfälle, aber auch Kindestötungen unmittelbar nach der Geburt zu untersuchen. Geplante Tötungsdelikte, also echte Morde, waren selten. Aber alles war sehr zeitaufwendig. Finanziell war unser Leben auch sehr schwierig. Ich hatte knapp 700 Mark Gehalt, das Bewegungsgeld war auch knapp und wurde erst später zurückgezahlt. Aber wir waren mit Begeisterung Morduntersucher und konnten alle Delikte klären.
Ein Tötungsdelikt ist mir in besonderer Erinnerung. In Dölau, am Rande von Halle, hatte ein »Überflieger« – so nannten wir sowjetische Soldaten, welche ihr Objekt verließen, um irgendwo Alkohol zu trinken – einen deutschen Zivilisten, der am Arm seiner Freundin in der kleinen Siedlung spazieren ging, erstochen. DDR-Bürger, die das sahen, hatten einen der beiden sowjetischen Soldaten eingefangen und an einen Baum gebunden. Das war aber der falsche, wie uns die Kommandantur später erklärte. Der Täter, der schon wieder in der Kaserne war, war natürlich leicht zu ermitteln. Wir hatten alles an die Kommandantur übergeben und hatten so mit dem eigentlichen Delikt nichts mehr zu tun.
Diese Tat hat natürlich in der Bevölkerung viel Aufregung hervorgerufen, zumal das Opfer aus einer fortschrittlichen Familie kam. Die Stimmung gegen die sowjetischen Soldaten war sehr erregt, viele schrien: »Das habt ihr nun von eurer Freundschaft zu den Russen« und Ähnliches. Die Beerdigung war entsprechend politisch aufgeladen. Die Sportmannschaft und die Feuerwehr von Dölau, auch die Bevölkerung hatten für die Sargträger Spalier gebildet. Alles war sehr emotional und kurz vor der Explosion. Außer uniformierten VP-Angehörigen waren natürlich auch wir anwesend, da wir ja die Eltern und die Freundin des Opfers kannten. Glücklicherweise kam es nicht zu Ausschreitungen. Aber nur wenige Tage nach der Beisetzung erhielt ich den Befehl, bei den Eltern den Kondolenzbesuch eines Generals des sowjetischen Oberkommandos vorzubereiten. Beide Eltern und auch die Freundin des Opfers waren einverstanden und hatten mir versprochen, ihre Emotionen zu zügeln und den General nicht zu beleidigen. So fuhr ich dann mit dem General und dem Dolmetscher der Kommandantur zu den Eltern. Nach wenigen Minuten verloren die Eltern die Kontrolle. Sie wurden dem General gegenüber, der sich wortreich für das Verbrechen entschuldigte, recht bösartig, und ich war froh, dass der Dolmetscher nicht mehr übersetzte, sondern einfach schwieg. Ich brach dann den Kondolenzbesuch ab und war froh, als ich wieder im Auto saß. Der General schwieg erschüttert, ich auch.
Mehrere Wochen später erhielt ich vom K-Leiter (Leiter der Kriminalpolizei) den Auftrag, an der Gerichtsverhandlung gegen die beiden sowjetischen Soldaten teilzunehmen. Die Kommandantur hatte eingeladen. Auch die Eltern des Opfers waren eingeladen, lehnten aber eine Teilnahme ab. Der Leiter der MUK und ich fuhren also zur Kommandantur, trafen dort den uns bekannten Dolmetscher und fuhren mit ihm zur sowjetischen Kaserne.
In einem großen Saal fand die Verhandlung vor dem obersten Militärtribunal der sowjetischen Streitkräfte statt. Im Saal saßen mehre hundert Soldaten und Offiziere. Der Täter wurde zum Tode verurteilt und der andere »Überflieger« zu fünf Jahren Aufenthalt in einem Straflager. Die Urteile wurden mit lautem Beifall quittiert. Sicher sollten sie auch zur Erziehung der anwesenden Soldaten beitragen.
Wir fuhren erschüttert nach Hause und dachten beide nicht daran, dass dies noch nicht der letzte Akt in diesem bösen Delikt war. Wieder einige Monate später wurde ich zum Chef der Bezirksbehörde Halle befohlen. Der MUK-Leiter war im Urlaub. Schweigend hielt der General mehrere Seiten Papier in der Hand und gab sie mir. Es war ein handschriftliches Schreiben in kyrillischer Schrift und eine gestempelte Übersetzung in deutscher Sprache. Ich las und war zutiefst erschüttert. Die Mutter des zum Tode verurteilten sowjetischen Soldaten hatte an den Obersten Sowjet geschrieben und gebeten, das Todesurteil gegen ihren Sohn nicht zu vollstrecken. Sie bat mehrmals um das Leben ihres Sohnes und schrieb, dass durch die Vollstreckung die deutsche Mutter ihren Sohn auch nicht wiedererhalten könne. Ich sah die Tränen in den Augen des Generals, mir ging es ebenso. Wir schwiegen einige Minuten. Dann meinte der General zu mir: »Fahren Sie zu der Familie des Opfers und fragen dort nach der Meinung der Eltern und der Freundin des Erstochenen. Egal wie die Meinung der drei ist, fertigen Sie dort ein Protokoll und lassen es unterschreiben.«
Mir war nicht wohl zumute. Ich war in einer schwierigen Situation, welche ich noch nie erlebt hatte. Ich fuhr ohne Anmeldung zu den Eltern und bat sie, auch die Freundin des Opfers zu holen. Ich erklärte allen das Schreiben der russischen Mutter des zum Tode verurteilten Soldaten. Wir weinten alle.
Dann sprach die Mutter unter Tränen, dass die russische Mutter ihren Sohn auch unter Schmerzen geboren habe, ihn erzogen habe und nie gewollte habe, dass ihr Sohn einen Menschen im Frieden tötet. Und fügte unter Schluchzen und Tränen hinzu, dass die Vollstreckung des Urteils ihren Jungen auch nicht wiederbringen könne. Ich war mehrere Stunden bei der Familie. Tief erschüttert fertigte ich ein handschriftliches Protokoll, worin die deutsche Mutter den Obersten Sowjet bat, das Urteil nicht zu vollstrecken, da das ihren Sohn auch nicht wieder zum Leben erwecken könne …
Dann fuhr ich zu meinem General und wurde auch sofort vorgelassen. Schweigend las er mein Protokoll und legte es auf seinen Schreibtisch. Dann musste ich ausführlich über mein Gespräch bei der Familie berichten. Er war vom Standpunkt der deutschen Mutter tief berührt und sagte, dass er es so erhofft habe, aber auch Verständnis für einen anderen Ausgang meines Gesprächs mit der Mutter gehabt hätte. Dann wurde ich mit Dank entlassen. Ich habe nie wieder etwas von dieser traurigen Geschichte gehört.
Beginn der Arbeit in der MUK / Vergewaltigung mit Bissspuren
Am ersten Tag in meiner neuen Dienststelle der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei Halle wurde ich in einer Dienstversammlung den anderen Offizieren der Abteilung Kriminalpolizei als neuer Mitarbeiter der Morduntersuchungskommission vorgestellt. Alle waren mir unbekannt.
Mein künftiger unmittelbarer Vorgesetzter war Hauptmann Helmut Grothe. Er war zwanzig Jahre älter als ich und hatte bereits viele Jahre bei der Kriminalpolizei verbracht.
Er erläuterte mir die Funktionsweise und die Aufgaben einer Morduntersuchungskommission und stellte mir auch den Kriminaltechniker Oberleutnant Hecht sowie den Kraftfahrer Hans Dehn vor. Zwischen uns beiden stimmte auf Anhieb die Chemie und das sollte auch die nächsten Jahre so bleiben. Wir hatten nie Probleme miteinander. In den nächsten Tagen fuhr er mit mir zum Direktor des Instituts für Gerichtliche Medizin Halle. Er stellte mich überall als neuen Mitarbeiter der MUK vor, und nach einer kleinen Gesprächsrunde wussten sie nun, dass ich »der Neue« im Personalstand der MUK Halle war. Diese Vorstellung hielt er für sehr wichtig, um vor einer erforderlichen Zusammenarbeit im konkreten Fall Vertrauen zueinander aufzubauen. Es dauerte nicht lange, da hatten wir einen Fall zu untersuchen, welcher ohne den Direktor der Zahnklinik Halle nicht zu lösen war.
Eine junge Studentin war offenbar im Zusammenhang mit einer Vergewaltigung durch Erwürgen zu Tode gekommen. Die Situation am Fundort der Leiche entsprach der einer »klassischen« Vergewaltigung. Das Opfer hatte sich kräftig gewehrt, dabei war ihre Oberbekleidung verrutscht und auf der nun freiliegenden Brust hatte der Täter einen kräftigen Abdruck der Zähne durch einen so genannten Lustbiss hinterlassen.
Zunächst hatten wir keinen Anhaltspunkt zum Täter, aber Hauptmann Grothe meldete uns beim Direktor der Zahnklinik Halle, Prof. Taats an. Obwohl Hauptmann Grothe keinen solchen Fall jemals davor zu untersuchen hatte, und ich gleich gar nicht, wollte mein Vorgesetzter wissen, ob ein Vergleich der stomatologischen Befunde eines Tatverdächtigen mit der Bissspur an der Leiche möglich sei. Er hatte zuvor ein Gespräch mit dem damaligen Leiter des Instituts für Gerichtliche Medizin anberaumt. Aber Oberarzt Simon kannte einen solchen Vergleich aus seiner Tätigkeit bis dahin nicht, sondern nur als Abbildung in wissenschaftlichen Lehrbüchern.
So fuhren wir also mit dem großflächigen Präparat der Bissspur zu Prof. Taats. Er hielt einen stomatologischen Vergleich zwischen dem Gebiss eines Tatverdächtigen und der Bissspur durchaus für möglich, betonte aber auch, über keine eigenen Erfahrungen zu verfügen. Zunächst schien ja alles graue Theorie zu sein. Aber warum sollte ein solcher Vergleich, welchen die Fachleute noch nie durchgeführt hatten, nicht möglich sein? Was war nicht schon alles durch Gutachter verglichen und als zueinander zugehörig befunden worden? Es eilte erst einmal nicht, wir hatten schließlich noch keinen Tatverdächtigen ermittelt.
Im VPKA Halle wurden die erforderlichen Maßnahmen zur Ergreifung des Täters oder wenigstens eines Tatverdächtigen unter unserer Leitung und Einbeziehung der Bevölkerung durchgeführt. Doch es vergingen mehrere Tage, ohne dass wir einen Hinweis ermitteln konnten. Doch dann ging alles sehr schnell. Aus der Bevölkerung war ein Hinweis auf einen jungen Mann gekommen, welcher frische Kratzspuren im Gesicht und an den Händen hätte. Nach einigen Tagen hatten wir ihn ermittelt und als Tatverdächtigen inhaftiert. Er bestritt eine Täterschaft und verhielt sich unzugänglich. Nun aber hatten wir eine Vergleichsmöglichkeit zwischen den Spuren des Täters an der Leiche und den stomatologischen Befunden des Verdächtigen.
So fuhren wir wieder zu Prof. Taats. Zunächst erklärte er uns wieder, keine eigenen Erfahrungen zu diesem schwierigen Gutachten zu haben, bemerkte jedoch: »Ich fliege in wenigen Tagen zu einer wissenschaftlichen stomatologischen Konferenz nach Schweden und könnte dort mit einem guten Freund das Problem bereden«. Als Hauptproblem hatte er stets die Veränderungen des biologischen Materials durch Austrocknung mit der damit einhergehenden Verkleinerung gesehen.
Seine Reise nach Schweden und die dort mögliche Besprechung unter Fachleuten wäre eine schöne Sache gewesen, wenn wir nicht dienstlicherseits ein totales Verbot für eine Zusammenarbeit mit ausländischen Wissenschaftlern und vor allem solchen aus dem kapitalistischen Ausland verordnet gehabt hätten.
Aber Hauptmann Grothe und ich hatten jetzt eine Spur aufgenommen. Sollten wir diese günstige Gelegenheit verstreichen lassen? Wir erklärten Prof. Taats unsere Bauchschmerzen und wurden mit ihm einig, dass er das Präparat der Bissspur und die stomatologischen Abdrücke unseres Tatverdächtigen nur unter der Bedingung mit nach Schweden nehmen konnte, dass er unser Problem nur mit einer einzigen Vertrauensperson besprechen würde.
Wir ließen in den nächsten Tagen durch den behandelnden Zahnarzt der Untersuchungshaftanstalt (UHA) Abdrücke vom Ober- und Unterkiefer des Verdächtigen anfertigen und übergaben beide Prof. Taats. Über mögliche disziplinarische Konsequenzen wegen unserer Kontaktaufnahme zu ausländischen Wissenschaftlern haben wir damals nicht nachgedacht. Zu dieser Zeit, 1963, war auch innerhalb der Kriminalpolizei die Angst vor einer Berührung mit dem »Klassenfeind« noch nicht so ausgeprägt, wie ich es später nach meinem Wechsel in das MfS kennenlernte.
Nach etwa einer Woche meldete sich Prof. Taats von seiner Reise zurück und wir fuhren sofort zu ihm. Nach der Schilderung seiner Reiseeindrücke kam er auf unser Problem zu sprechen. Nach Meinung seines schwedischen Kollegen bestand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Übereinstimmung zwischen der Täterspur und den angefertigten Abdrücken.
Wir waren hocherfreut und verließen Prof. Taats mit vielem Dank für seine Hilfe. Uns war aber bewusst, dass wir diese illegal gewonnenen Informationen in keiner Weise irgendwie verwenden konnten. Aber sie stützten unsere Bemühungen um die Ergreifung eines brutalen Mörders.
Als nächstes ließen wir unseren Tatverdächtigen mit einem anderen Häftling zusammenlegen. Dass dieser Häftling in unserem Auftrag als Zelleninformator (ZI) tätig war, blieb natürlich unser Geheimnis. Wir suchten dann auch mehrere Tage nach einem geeigneten ZI, denn dieser musste eine Grundbedingung erfüllen: er musste zum Zeitpunkt des Verbrechens schon in Haft gewesen sein und konnte somit, wenn überhaupt, jedwede Information über die Tat nur von unserem Verdächtigen bekommen. Wir schufen noch eine weitere Sicherung. Wir sperrten den Besucherverkehr unseres ZI mit seinen Verwandten. Wir waren überzeugt, alles getan zu haben, um die Wahrheitsfindung in unserem Fall voranzutreiben.
Gleichzeitig versuchten wir aber auch in mehreren Vernehmungen von unserem Tatverdächtigen ein Geständnis zu bekommen. Wir redeten dabei auch über die Spurenlage, um ihm zu zeigen, dass wir ihn für den Mörder der jungen Frau hielten. Dabei könnten wir aber etwas falsch gemacht haben und zu sehr auf den Zusammenhang zwischen seinem Gebiss und der Bissspur an der Leiche hingewiesen haben. Vielleicht hatte er aber auch begriffen, wie gefährlich diese Übereinstimmung für ihn war. Wir haben allerdings nicht mitbekommen, dass er sich über diesen Zusammenhang stundenlang eigene Gedanken gemacht hatte, um aus dieser gefährlichen Situation heraus zu kommen.
Der ZI konnte nichts Wertvolles berichten, außer der Tatsache, dass unser Tatverdächtiger stundenlang schweigend in der Zelle hin- und herlief. Er war immer zu seiner Freistunde auf den Hof gegangen, jedoch hatte sich kein intensives Gespräch zwischen beiden Männern ergeben.
Und dann nahm alles einen dramatischen Verlauf. Eines Tages, gleich zu Dienstbeginn gegen 8.00 Uhr, wurden wir durch den Bezirks-K-Leiter in Kenntnis gesetzt, dass die Leitung der Untersuchungshaftanstalt beim Operativen Diensthabenden in der Nacht angerufen hatte und um baldiges Erscheinen der Offiziere der MUK gebeten hatte. Ein Grund war nicht benannt worden. Wir fuhren sofort zur UHA. Was wir dort erfuhren, hatte selbst Hauptmann Grothe in seiner langen Dienstzeit bei der Kriminalpolizei und der MUK noch nie gehört: Unser Tatverdächtiger hatte sich in der Nacht mit einer Zange einen Zahn gezogen, der ZI hatte zwar Alarm geschlagen und an die Tür getrommelt, aber wie das eben nachts in einer mehrfach verschlossenen Haftanstalt so ist, war eine längere Zeit vergangen, bis das Personal die Trommelei an der Tür gehört und darauf reagiert hatte. Während wir die ersten Gespräche mit der Leitung der UHA führten, war unser Verdächtiger in zahnärztlicher Behandlung. Wie oft stellten wir uns die Frage, wie er in den Besitz einer Zange kommen konnte!
Später erfuhren wir von ihm selbst, dass er die Zange auf dem Weg durch endlose Korridore in die Freistunde irgendwo an einem Fenster habe liegen sehen. Er sei zu diesem Zeitpunkt bereits mit Möglichkeiten des Zahnziehens beschäftigt gewesen und habe sofort zugegriffen. Wahrscheinlich war, dass irgendein anderer Häftling aus einem Arbeitskommando die Zange dort hingelegt und vergessen hatte.
Damit hatte sich unsere mühevoll aufgebaute Beweismöglichkeit in Luft aufgelöst. Als wir später Prof. Taats von dieser vermaledeiten Geschichte erzählten, lachte er laut.
Hauptmann Grothe und ich reagierten sehr kleinlaut, hatten uns aber vorgenommen, bei der zu erwartenden Befragung durch den Bezirks-K-Leiter unsere Schwedenaktion zu verschweigen, da sie ja nun ohnehin für uns wertlos war.
Dank unseres ZI nahm letzten Endes doch alles noch einen guten Ausgang: Unser Häftling hatte sich in völliger Verkennung der Situation bei seinem Mitinsassen freudig darüber geäußert, dass nunmehr, wo dieser Zahn im Gebissschema fehlte, die Polizei ihm nichts mehr anhängen könne. Er war dann, nach den Aussagen des ZI und durch eine Reihe anderer Beweismittel, die wir gesammelt hatten, doch geständig. Er hatte die allein laufende Frau, die ihm weitläufig bekannt war, in der Nacht zufällig getroffen, dann vergewaltigt und erwürgt. Er wurde vom Bezirksgericht Halle zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Sachbearbeiter unnatürlicher Todesfälle / Straßenbahn nach Bad Dürrenberg
Nachdem ich 1962 in die MUK der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei (BdVP) Halle versetzt worden war, erläuterte mir der damalige Leiter der Morduntersuchungskommission Hauptmann Grothe die Funktionsweise der MUK und ihre Pflichten im Zusammenwirken mit den Abteilungen Kriminalpolizei der einzelnen Volkspolizei-Kreisämter (VPKA).
Damals gab es in jedem VPKA in der Abteilung Kriminalpolizei einen Sachbearbeiter für unnatürliche Todesfälle. Das war eine wirklich gute Einrichtung, denn jener Sachbearbeiter wurde immer dann tätig, wenn beispielsweise ein leichenschauender Arzt auf dem Totenschein die Todesart als ungeklärt angekreuzt hatte oder wenn aus einem Krankenhaus ein Todesfall »unter verdächtigen Umständen« gemeldet worden war. Er betrachtete auch bekannt gewordene Selbsttötungen aus kriminalpolizeilicher Sicht.
Diese Sachbearbeiter waren quasi ein Filter zwischen Gut und Böse und wichtige Leute innerhalb der Kriminalpolizei. Das Verhältnis dieser Sachbearbeiter zur Morduntersuchungskommission war wirklich von Bedeutung. Oft ergaben sich telefonische Nachfragen bei der Klärung von Sachverhalten. Diese Sachbearbeiter mussten jeden Abschlussbericht über durchgeführte Untersuchungen bei einem Todesfall an die MUK schicken. Wir übten dann die Kontrolle über die Qualität der Untersuchung aus und gaben möglicherweise Hinweise zur Nachermittlung.
Wegen der großen Entfernung zu diesen Sachbearbeitern – Quedlinburg etwa war einhundert Kilometer entfernt – hatten wir meist nur telefonische Kontakte, bei einem der eher seltenen Hilferufe fuhren wir natürlich zu ihm. Jährlich kamen mehrere hundert solcher Abschlussberichte zu uns zur Kontrolle.
Als zum Beispiel im VPKA Merseburg ein neuer Sachbearbeiter für die Untersuchung unnatürlicher Todesfälle eingesetzt wurde, bestellten wir ihn zu uns in die MUK. Das war insofern günstig, da zwischen Merseburg und Halle eine Straßenbahnverbindung bestand. Es war eigentlich keine richtige Straßenbahn. Sie fuhr zwar auf Gleisen des innerstädtischen Straßenbahnnetzes und auch mit auf dem Dach befindlichen Stromabnehmern, aber es war keine innerstädtische Bahn, sondern eine Verbindung zwischen Halle, Merseburg und Bad Dürrenberg. Ihre Waggons waren länger, kompakter, hatten größere Fensterscheiben und mit Leder überzogene, heizbare gepolsterte Sitze. Für die damalige Zeit war es ein wahrer Luxus. Diese Bahn, genannt Überlandbahn, fuhr vom Riebeckplatz in Halle mit Haltestellen weiter nach Ammendorf, Merseburg, Schkopau und Leuna und hatte den Endpunkt in Bad Dürrrenberg. Es war eine schnelle und eine günstige Verbindung zwischen den genannten Städten. Sie fuhr stündlich, von meines Wissens 4.00 Uhr früh bis abends 23.00 Uhr. Viele Beschäftigte der umliegenden Werke benutzten sie täglich.
So bestellten wir eines Tages, vermutlich 1963, den Leichensachbearbeiter von Merseburg zu uns nach Halle, wir wollten ihn persönlich kennenlernen. Dass er 1967, als ich in das MfS wechselte, mein Nachfolger werden würde, konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen.
So kam der Leichensachbearbeiter Siegfried Schwarz mit der Überlandbahn nach Halle. Damals ahnte auch niemand, dass er später mit der Aufklärung des Mordes an einem Knaben, dessen Leiche in einem Koffer mit Zeitungen mit ausgefüllten Kreuzworträtseln gefunden wurde, bekannt werden würde. Er ist in der Zwischenzeit auch ein erfolgreicher Autor von Büchern mit wahren Kriminalfällen: Mord nach Mittag und Der Makronenmord.
Bei uns eingetroffen, besprachen wir alles, was für seine künftigen Pflichten und für die Zusammenarbeit mit der MUK erforderlich war und wurden uns einig, nach so vielen trockenen Stunden gemeinsam nach Dienstschluss ein Bier zu trinken. Also fuhren wir abends mit der innerstädtischen Straßenbahn in ein Tanzlokal, ich glaube, es hieß »Café Rosengarten«. Wir redeten weiter über die Arbeit, über unsere Familien und debattierten über Gott und die Welt. Doch lief die Uhr wieder einmal viel zu schnell und wir kamen in Gefahr, die Betriebszeit der Straßenbahn, vor allem der Überlandbahn zu verpassen. Schwarz meinte dann: »Ich bestelle uns einen Wagen«, ging in das Büro des Geschäftsführers und verkündete nach der Rückkehr: »… in einer halben Stunde kommt der Wagen«. Wir tranken noch etwas, bezahlten und gingen vor die Tür. Vor dem Tanzlokal stand – ein Leichenwagen. Ein richtiger mit Palmzweig ausgewiesener Leichenwagen, welcher von mehreren Neugierigen umringt war. Am Auto stand ein schwarz gekleideter Mann, er hatte eine Mütze unter dem linken Arm geklemmt und Siegfried Schwarz begrüßte ihn. Dann sagte er zu mir: »Los, steig ein«. Der Fahrer öffnete die hintere Tür, ich stieg ein und los ging die Fahrt. Schwarz saß vorn beim Fahrer. Hinten war, wie es sich gehörte, ein Sarg platziert, aber keine Sitzgelegenheit. So saß ich notgedrungen auf dem Sarg und stützte mich in den Kurven mit den Händen an den Seitenwänden des Wagens ab. In der Nähe meiner Wohnung klopfte ich an die Scheibe und stieg aus. Ich war froh, so schnell und unkompliziert nach Hause zu kommen und ein Leichenwagen war auch für mich nichts Bedrohliches.
Diese »Dienstfahrt« habe ich auch bei einer »innerdienstlichen« Zusammenkunft der Offiziere der ehemaligen Morduntersuchungskommissionen aus den Bezirken der DDR zum Besten gegeben. Alle waren amüsiert. Seit vielen Jahren schon treffen wir uns auch heute noch einmal jährlich. An diesen Treffen nehmen außer uns Ex-Offizieren der MUK auch frühere Gutachter des Kriminalistischen Instituts der Volkspolizei, ehemalige Dozenten der Sektion Kriminalistik der Humboldt-Universität zu Berlin, Sachbuchautoren, die unserem Beruf zugetan sind und auch Ehefrauen teil. Und natürlich auch der ehemalige Leichensachbearbeiter Schwarz mit seiner Ehefrau. Er hat noch immer Kontakt zum damaligen Fahrer des Leichenwagens. Wir laden auch aktive Gerichtsmediziner ein und besprechen dann einen bereits gerichtlich abgeurteilten Fall der Neuzeit. Dann reden wir oft bis in die frühen Morgenstunden über die Vergangenheit, unsere aktuellen Lebensumstände und auch über die Zukunft.
Mord aus Leidenschaft im Schaustellermilieu
In der von Hauptmann Grothe und mir 1963 untersuchten Tragödie sehen wir die Kraft der Liebe und das dämonische Verlangen, welches aus der verratenen Liebe reift und mit der Tötung der verlorenen Geliebten enden kann. Wie treffend sind doch die Worte in Schillers Das Lied von der Glocke:
Oh dass sie ewig grünen bleibe,
die schöne Zeit der jungen Liebe!
Das Drama ereignete sich in Halle. Wir fuhren kurz nach Dienstschluss zur betreffenden Wohnung. An der Wohnungstür stand ein uniformierter Polizist und wies uns schweigend mit einer Handbewegung den Weg in die Wohnung. Wir kamen an einer Küche vorbei. Am Tisch saß eine weinende Frau, die sich offenbar in tiefem Schockzustand befand. Dann rechts ein Wohnzimmer und links der eigentliche Tatort im Schlafzimmer. Am Fenster stand ein jüngerer, weinender Mann. Er hielt sich mit beiden Händen an einer Stange am Fußende des Bettes fest.
Auf dem Bett lag mit dem Kopf zum Fußende eine bekleidete weibliche Leiche. Sie war geordnet bekleidet mit einer langen Hose und einer Bluse, welche im Brustbereich geöffnet war. Die Leiche lag ausgestreckt in Rückenlage. Um den Kopf, um die Schultern und herunter bis an die Hüften war die Leiche mit vielen roten Rosen umgeben. Die Situation glich der in einer Leichenhalle. Der Polizist am Fenster wies mit einer Handbewegung auf den weinenden Mann, als wollte er damit sagen, dass er der Täter sei.