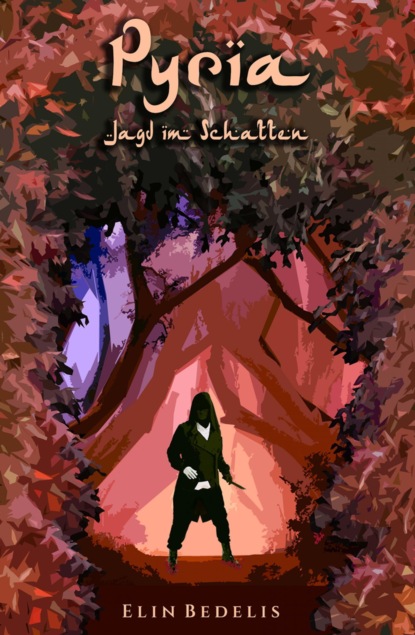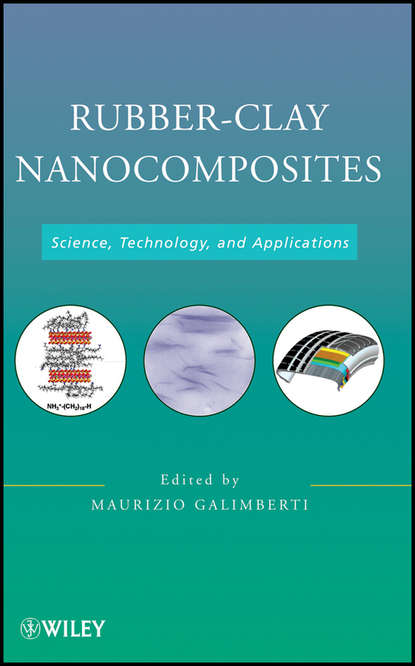- -
- 100%
- +
»Fall nicht um«, erwiderte Machairi nicht besonders hilfreich und trat auf die Felswand zu. Er schob einige Ranken zur Seite und bevor Leén fragen konnte, riss es sie von den Füßen.
Finsternis erhob sich über ihr wie eine Decke, drückte auf ihr Gemüt und engte sie ein. Ihr Kopf begann zu schwirren und es pfiff in ihren Ohren, während sie kaum mitbekam, dass sie auf den Boden sank. Drückend und kalt war das Schwarz, das über ihr schwebte, und wie von selbst stieg in ihr das Licht auf, um sich zu wehren. Vertraut war der Schein inzwischen und es wurde hell vor ihren Augen, obwohl sie sie geschlossen hatte. Ebenso plötzlich wie es gekommen war, hörte es auch wieder auf und Leén kauerte keuchend am Boden und versuchte, das taube Gefühl zu vertreiben, das zurückgeblieben war.
Machairi stand noch immer bei der Wand und musterte sie mit undurchdringlicher Miene. Vermutlich war er enttäuscht, aber er ließ es sich ebenso wenig anmerken wie irgendein anderes Gefühl. Es trug nicht dazu bei, dass Leén sich weniger schämte. »Du kontrollierst deine Magie. Nicht andersherum«, erinnerte er sie und musterte sie genau, als könnte er sie damit zwingen, sich geschickter anzustellen.
Kurz wollte sie ihm sagen, dass erst die Dunkelheit sie übermannte und dann erst das Licht kam, dass sie keine Kontrolle über die Dunkelheit hatte und dass sie nicht wusste, wie sie gegen etwas stehen konnte, worauf sie keinen Einfluss hatte. Doch sie nahm an, dass er wusste, wovon er sprach, und sie hatte keine Lust, wieder dumm zu sein. Deshalb schluckte sie, nickte und versuchte, sich besser zu wappnen, als er die Ranken ein zweites Mal zur Seite schob.
Wieder deckte sich die Finsternis über sie und verschleierte ihren Blick. Sie versuchte, die Augen geöffnet zu halten und sich an der Realität festzuhalten, aber ihr wurde buchstäblich schwarz vor Augen. Die Dunkelheit schien in ihren Kopf einzudringen, durch ihre Gedanken zu sickern und alles, was sie versuchen konnte, war das Licht zurückzuhalten, das in ihr aufsteigen und die Schwärze bekämpfen wollte. Ihre Bemühungen blieben fruchtlos. Zwar schaffte sie es eine ganze Weile, das Licht zu deckeln, aber die Dunkelheit wurde nur pressender und sie konnte nichts dagegen tun. Schließlich verlor sie den Kampf gegen das empordrückende Licht und was sich angefühlt hatte wie eine Viertelstunde, konnte kaum mehr als ein paar Sekunden gedauert haben. Sie gab ihren Widerstand auf und Helligkeit stieg auf, um die Dunkelheit fortzudrücken. Es half gegen die Benommenheit in ihrem Kopf, aber die unkontrollierte Magie hielt sie nun voll in ihren Fängen. Wie ein eigener lebendiger Organismus nahm es ihr die Selbstbestimmung und als die Dunkelheit endlich verflog, übergab sie sich ins saftige Gras der Wiese vor ihr.
Tief durchatmend stützte sie sich im Gras ab und fühlte sich plötzlich schrecklich müde. Krampfhaft hielt sie sich davon ab, zu dem Schatten zu sehen und spuckte noch einmal aus, um den widerlichen Geschmack loszuwerden. »Kann ich es nicht irgendwie davon abhalten, in erster Linie in meinen Kopf zu kommen?«, fragte sie zu wehleidig und setzte sich etwas zurück. Jetzt sah sie doch auf, aber nicht in die bohrenden schwarzen Augen, sondern auf die Ranken, die wieder über dem Stein hingen. »Was ist hinter diesen Ranken?«, wollte sie dann wissen. Was konnte da sein, das so düster war, sich aber von ein paar Ranken aufhalten ließ? Und woher hatte der Dämon gewusst, dass es hier war?
»Das musst du. Wenn deine Verteidigung ausgelöst wird, ist es längst zu spät.« Die zweite Frage beantwortete er nicht und irgendwie war sich das Mädchen nicht sicher, ob sie es überhaupt wissen wollte.
»Wie soll ich denn etwas aussperren, was ich weder kommen sehen noch physisch wahrnehmen kann?«, fragte sie etwas verzweifelt und wollte sich am liebsten irgendwo verkriechen. Warum war sie immer so unfähig? Nachdem sie nun schon zweimal der Dunkelheit erlegen war, schien die Verzweiflung greifbarer als zuvor. Es hatte sie ausgelaugt und müde gemacht und sie schämte sich für ihre Kindlichkeit.
»Was da ist, muss dich nicht überwältigen.« Er machte ein paar Schritte auf sie zu und hielt ihr die weiß behandschuhte Hand hin. »Es ist wie Angst.« War er sich bewusst, dass das nicht beruhigend war? Nur sehr zögerlich schob sie die Finger in das weiße Leder und ließ sich auf die Füße ziehen. Sie kannte Angst sehr gut. Seit er in ihrem Leben war, hatte sie eine Menge davon gehabt. Wenn die Angst einen überwältigte, konnte man entweder darin versinken und jeden Mut verlieren oder sie überwinden und sich ihr stellen. Das war zwar schön und gut, wirkte aber geradezu unmöglich.
»Was ist hinter diesen Ranken?«, fragte sie nochmal, musterte die Wand skeptisch und spannte sich unwillkürlich stärker an. Konnte es ein Monster sein? Eines wie das, was er aus den Tiefen des Meeres gelockt hatte, mit nichts als einem Messer?
»Finde es heraus«, antwortete er ruhig und sie schluckte. Leider hatte er recht. Sie konnte sich nicht weiterhin bei jedem kleinsten Kontakt mit dieser Dunkelheit aus ihrem Kopf verdrängen lassen – egal, ob sie nun in die Unterwelt ging oder nicht. Wenn es funktionierte wie Angst, dann war wohl der beste Weg, sich der Dunkelheit zu stellen. Ohne ein weiteres Wort hielt sie auf die Ranken zu. Sie spürte, wie die Augen des Schattens ihr folgten und er sie genau musterte, aber zur Abwechslung hatte sie vor ihm wesentlich weniger Angst als vor dem, was vor ihr lag. Leén atmete tief ein, streckte die zitternde Hand aus und schob sie in die Ranken. Jeden Moment erwartete sie, dass die Schwärze ihr entgegenschlagen würde und hielt für den Bruchteil einer Sekunde inne, bevor sie die Blätter beiseiteschob.
Hinter den weichen grünen Schlingen lagen die nackte Felswand und eine Höhle, kaum mehr als ein Spalt klaffte dahinter. Vermutlich war er gerade groß genug, dass sie sich hätte hineinquetschen können, ohne steckenzubleiben. Es war dunkel darin, aber es war eine andere Form von Dunkelheit als die, die es vermochte sie niederzudrücken. Das war wohl kaum der Eingang zur Unterwelt, oder? Nervös kaute das Mädchen auf der Unterlippe und fragte sich, warum nichts geschah. Die Tatsache, dass sie sich dem willentlich stellte, konnte doch nicht schon ausreichen, um den sonst so schwerwiegenden Effekt zu umgehen, oder? »Warum passiert nichts?«, fragte sie und drehte sich zu dem Schatten um.
Vielsagend erwiderte Machairi ihren Blick. Als ihr so gar kein Licht aufgehen wollte und er weiterhin nichts sagte, riss sie sich zusammen und steckte langsam einen Arm und ihren Kopf in den Spalt. Keine drückende Dunkelheit. Nur eine Felswand und ein sich immer weiter verjüngender Riss im Stein und etwas, was sich unangenehm nach einem Spinnennetz anfühlte. Dann schlug die Dunkelheit wieder ein. Sie drückte ihr in den Nacken und ließ sie fast im kleinen Spalt zusammensinken. Sie kam nicht aus diesem Riss. Sie kam von draußen.
Mit schwirrendem Kopf zog Leén sich wieder hinaus, versuchte nicht einzuknicken und so gut sie konnte gegen das Gefühl anzukämpfen. Ihr Blick verschleierte, aber sie versuchte, die Dunkelheit fortzudrücken, und ballte die Hände zu Fäusten. Heftig blinzelnd, in der Hoffnung, die Sicht wieder klären zu können, sah sie umher und versuchte zu bestimmen, wo die Dunkelheit herkam. Sie hörte das Rauschen des Wasserfalls und des kleinen Flüsschens, das sich mit dem Rauschen ihres Blutes vermischte. Sie fühlte warmes Sonnenlicht auf der Haut, das ihr half, die Finsternis zu bekämpfen, und sie sah die Lichtung vor sich. Saftiges Grün und blühendes Leben und einen Schatten, der wie von schwarzen Schwaden umgeben schien. Schwarze Augen stachen ihr entgegen und die Dunkelheit wurde so überwältigend, dass sie sich beinahe schon wieder übergeben hätte. Angst schnürte ihren Magen zu und sie stolperte zurück. Der Wasserfall sprühte ihr Tropfen in den Nacken, die sich auf ihren Kleidern und ihrem Haar niedersetzten und sie zitterte. »Du bist das!«, stieß sie hervor und endlich fügten sich die Puzzleteile zusammen.
In einem kurzen Augenblick flackerten all die Situationen vor ihrem inneren Auge wieder auf, in denen sie dieses grausige Gefühl gehabt hatte. Sie hatten eines gemeinsam: einen wütenden, bedrängten, unkontrollierten Machairi.
Ihre Gedanken überschlugen sich und sie konnte gar nicht genug Abstand zu dem Dämon vor ihr halten. Ekelhaft ruhig sah er sie an und die Dunkelheit kam zum Erliegen. »Besser«, befand er und sie verstand erst nach einem Augenblick, dass er ihre Leistung bewertet hatte, der Dunkelheit zu widerstehen. Wäre sie nicht sprachlos vor Fassungslosigkeit gewesen, hätte sie ihm entgegengeschrien, dass seine Meinung sie nicht interessierte. Was wollte er von ihr? Konnte es sein, dass er nur einen Vorwand brauchte, um sie hinab in die Unterwelt zu zerren, um dann die Vorteile ihrer Abstammung für sich oder Ebos zu nutzen? Sie hatte so etwas schon die ganze Zeit befürchtet, aber sie hatte es nicht glauben wollen. Schließlich waren auch Gwyn und die anderen überzeugt gewesen, dass er ein Mensch sei, aber eigentlich war sein Charakter sehr viel besser zu erklären, wenn man der Realität ins Auge blickte.
Sie sollte flüchten, aber wohin? Er war schnell, unmenschlich schnell, wie sie sich erinnerte, und selbst wenn nicht, konnte er blind ein Messer auf sie werfen, das sie aufhielt, ohne sie zu töten, und er hatte sie so weit vom Dorf weggeführt, dass sie keine Chance hatte, irgendjemanden dort zu alarmieren. Sie hätte heulen können. Auch weil sie gehofft hatte, dass er irgendwo doch einen guten Kern hatte, und weil sie vielleicht doch ganz leicht Schmetterlinge im Bauch gehabt hatte.
Das Einzige, was ihr einfiel, um vielleicht entkommen zu können, war, das Licht zu verwenden, das ihn vielleicht so abstieß wie seine Dunkelheit sie. Leider befürchtete sie, dass er wesentlich geübter als sie darin war, den Effekt zu umgehen, und erschwerend kam hinzu, dass sie sich nach wie vor nicht in der Lage sah, sich zu bewegen. Stocksteif stand Leén da, während es in ihrem Kopf ratterte und sie versuchte zu erfassen, was sie gerade herausgefunden hatte. Er unterbrach sie nicht dabei, hatte alle Zeit der Welt, um ihr dabei zuzusehen, wie sie mehr und mehr verzweifelte.
»Warum die Prinzessin?«, war dummerweise die erste Frage, die sie herausbrachte. Es war der Punkt, auf den sie sich am wenigsten einen Reim machen konnte. Sie konnte sich vorstellen, dass ein Dämon diese seltsame unmenschliche Perfektion haben konnte, auch wenn die manchmal bröckelte. Es war auch klar, dass er ein Schatten hatte werden können und dass er damit durchkam, sich jeder Form von Höflichkeiten zu entziehen, und sogar, weshalb er ein Seemonster kannte. Das Einzige, was sie nicht verstehen konnte, war, wozu er die Prinzessin brauchte. Der Herr der Unterwelt konnte es doch kaum nötig haben, Geiseln zu nehmen, oder? Außerdem hatte doch Koryphelia ihn um Hilfe gebeten und nicht umgekehrt.
Er sah ein wenig amüsiert aus. »Sie hat das Blut ihres Vaters«, antwortete er ruhig, als sei das ein ganz normaler Satz, der überhaupt nicht wahnsinnig klang. »Es ist gut möglich, dass wir es brauchen.« Das war eine sehr absonderliche, aber erstaunlich klare Antwort.
»Ist dir klar, wie wahnsinnig das klingt?«, fragte sie mit viel zu hoher Stimme und wich noch etwas weiter zurück, sodass sie Angst haben musste, in den Bach zu fallen. Was konnte sie nur tun? Was konnte sie nur tun?! Ihre Atmung hatte sich beschleunigt und sie versuchte, irgendwie einen kühlen Kopf zu bewahren, aber bis auf das kalte Wasser, das ihr in den Nacken sprühte, war nichts an dieser Situation abkühlend.
»Wir sprechen von einem Tropfen Blut, nicht vom Kehle durchschneiden«, stellte er klar und sah abermals belustigt aus, als sie fast ins Wasser fiel. Er machte auch keine Anstalten, sie anzugreifen. Nicht einmal ein Messer kreiste durch seine Finger, was schon fast unheimlich wirkte, weil es sonst so oft geschah.
Leén fand, dass sie eigentlich erstaunlich beherrscht war, dafür, dass sie gerade aus allen Wolken gefallen war. Vielleicht lag das auch daran, dass ihr Kopf noch nicht damit klarkam und dass sie das Gefühl hatte, ihr Todesurteil zu unterschreiben, wenn sie einen falschen Schritt tat. »Was machst du jetzt mit mir?«, fragte sie und ihre Stimme war kaum mehr als das Fiepsen eines verängstigten Tieres. Sie schämte sich kaum dafür – es war immerhin berechtigt. Die einzige Hoffnung, die noch in ihr keimte, war, dass er sie noch brauchte.
»Du solltest die Zeit bis morgen nutzen, um zu üben.« Sein Blick glitt zu seinem Messer an ihrem Gürtel und sie dachte kurz an die seltsame Trainingsstunde in der Wüste. Die ergab tatsächlich keinen Sinn, genauso wenig wie das Geld, das er ihr gegeben hatte, um sich im Zweifelsfall in Sicherheit bringen zu können. Überhaupt hatte er sich erstaunlich viel Mühe gegeben, wenn er sie einfach nur entführen wollte.
»Ich will nicht in die Unterwelt«, wisperte sie und ihre zitternden Hände gruben sich in den Stein unter dem Wasserfall, in dem sie inzwischen so weit drinstand, dass er ihr auf den Kopf prasselte und sie kaum noch verstand, was der Dämon sagte. »Schon gar nicht mit einem Dämon.« Warum schluchzte sie? Warum musste sie nun doch weinen, wo sie doch zuvor so überraschend gut Haltung bewahrt hatte? Leén wünschte sich, mit dem Wasser zu verschmelzen, dachte sogar darüber nach, ganz in den Wasserlauf zu springen und sich von der hoffentlich seichten Strömung forttragen zu lassen … falls er tief genug war. Vielleicht führte der Lauf ja sogar zu dem Bach, der hinter dem Dorf verlief. Dann konnte sie sich vielleicht doch in Sicherheit bringen.
Machairi hob eine Augenbraue und musterte das Harethimädchen, das immer weiter in den kleinen Wasserfall zurückwich. »Voreilige Schlussfolgerungen sind die größte Fehlerquelle menschlichen Denkens.« Das klang wie ein typischer Satz von Machairi: irgendwie einleuchtend und trotzdem seltsam kryptisch. Es erinnerte sie an die Nacht, in der sie zu ihm geflüchtet war, wie sie sich sicher gewesen war, einen Dämon in ihrem Zimmer stehen zu sehen. Ob er das gewesen war? Was wollte er ihr damit sagen? Überhaupt fragte sie sich, wie viel von seinen Worten gelogen gewesen waren und ob er wirklich dieses blöde Orakel suchte. Es klang mehr wie ein Vorwand, aber sie konnte auch nicht wissen, ob der Dämon nicht vielleicht doch irgendeine wichtige Frage hatte. Und was war mit Ila? Schließlich schien die Frau den Schatten recht gut zu kennen. Wenn er der Unterwelt entsprang, konnte das immerhin erklären, wie sie sich vielleicht getroffen haben konnten, trotz des horrenden Altersunterschieds. Zunächst hatte sie gedacht, dass jetzt alles klar sei, aber leider waren die Dinge doch nicht so eindeutig, wie sie zunächst gedacht hatte.
Machairi seufzte. »Was genau denkst du, was ich dir jetzt hier tun könnte, was ich nicht schon längst hätte tun können?« Etwas genervt wirkte er allmählich schon und das vertraute Messer tanzte wieder durch den Handschuh. Es war fast beruhigend. Außerdem hatte er recht. Einen Fluchtweg gab es nicht und wenn er sie morgen – ob sie wollte oder nicht – in die Unterwelt hinabzerren würde, konnte es nicht schaden sich vorzubereiten.
Leén schluckte und riss sich zusammen. Vorsichtig kam sie wieder vor, hinaus aus dem Wasserfall, und trat etwas steif auf die Wiese. Er hatte sich nicht von der Stelle bewegt, stand noch immer ganz ruhig dort, wo er sie auf die Füße gezogen hatte, und das Messer war wieder verschwunden. Ganz genau beobachteten die schwarzen Augen sie und sie stellte die einzige Frage, die für sie wirklich entscheidend war. Wenn er die nicht beantwortete, würde sie sich so querstellen, wie sie konnte, bevor sie sich in die Unterwelt hinabbringen ließ. »Wozu brauchst du mich?«, fragte sie und sah ihn direkt an, auch wenn sie noch immer gerne vor ihm davongelaufen wäre. Sie hatte beschlossen mutig zu sein.
Einen Moment lang war es still auf der Lichtung. Dann ließ sich Machairi mal einmal dazu herab, seine melodische Stimme zu benutzen, um eine Antwort zu geben, die er eigentlich für sich behalten wollte. »Du bist unser Weg zurück. Ich habe hier noch zu viel zu tun, um zu riskieren, dort festzusitzen.« Es klang ehrlich. Ehrlicher als das meiste, was er je gesagt hatte. Einzig seine Meinung über den Schwertkampf hatte einst das gleiche Maß an Ehrlichkeit gehabt. Es war für einen kurzen Moment, als würde man durch die schwarzen Augen durch ein Fenster sehen, wo sonst nur undurchdringliche Mauern aufragten. Es war ein Funke Menschlichkeit, der den Dämon weniger furchteinflößend wirken ließ. Sie glaubte ihm. Das konnte sie nicht verhindern und es drückte ihre Angst zurück.
»Na gut«, sagte sie, auch wenn sie sich selbst nicht verstand. Sie konnte sich nicht wehren, wenn seine Entscheidung feststand, und trotz allem spürte sie, dass sich ein Teil von ihr daran festhalten wollte, dass sie den falschen Schluss gezogen haben konnte. Also blieb sie stehen, dachte nicht länger an Flucht und fügte sich untypisch mutig in seine Pläne. Sie musste ihre Beherrschung verbessern. »Dann hilf mir trainieren.«
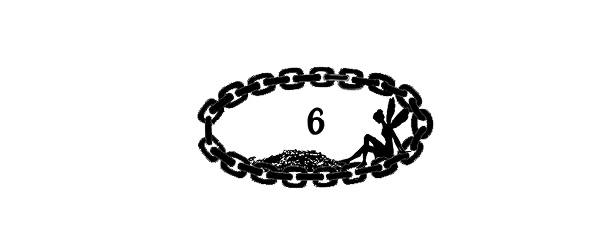
Rennen
Gwyn konnte sich nicht entscheiden, ob er sich heimisch oder fremd fühlte an diesem Ort. Er war noch nie in einem reinen Zhakidorf gewesen und er wurde als einziger mit Ehrlichkeit willkommen geheißen. Das seltsam dumpfe Gefühl in seiner Brust war dadurch nicht gewichen. Es war noch immer so stark wie auf dem Schiff und die Anwesenheit der anderen machte es eher noch schwieriger zu ertragen. Sie führten ihm immer wieder vor Augen, dass irgendetwas in ihm nicht mehr so funktionierte, wie es sollte. Auf der einen Seite blieb das Gefühl, dass er es verdient hatte, sich schlecht zu fühlen. Auf der anderen Seite wurde es noch schlimmer dadurch, dass er wusste, dass er nicht funktionierte.
Er hatte sich einen müden Dank abgerungen, als Katyre ihm sein Zimmer gezeigt hatte. Seither saß er nun also in der Ecke und lauschte seinem Gedankenchaos, das ihn beinahe in den Wahnsinn trieb.
Dann war da noch das Endziel der Reise und die Tatsache, dass niemand ihn erwähnt hatte, auch wenn Mico deutlich dazu angesetzt hatte. Er fragte sich, ob Machairi ihn wohl mitgenommen hätte, wenn er nicht so versagt hätte. In dem Zusammenhang fragte er sich auch, ob er das wollte. Jeder bei Verstand würde ihm sagen, dass er sich freuen sollte, dem Schicksal entgangen zu sein, aber ein seltsamer Teil von ihm wünschte sich, mitkommen zu dürfen. Es war schließlich eine ganz besondere Form von Vertrauen, auf eine solch gefährliche Mission mitgenommen zu werden, und er war mehr als einmal versucht gewesen zu sagen, dass er sogar als Köder, Opfergabe oder Zahlungsmittel mitgekommen wäre. Eigentlich gab es nur eine Sache, die er wirklich wollte, die sein verzweifelter Kopf nicht verzerrt hatte. Gwyn wollte, dass Machairi ihm verzieh. Wenn ihn das sein Leben kostete, war es ihm das wert.
Es war ein waghalsiger, wahnsinniger und geradezu dummer Gedanke und irgendwo in seinem Inneren beschwerte sich seine Vernunft, dass krankhafter Todeswunsch zwar eine gute Voraussetzung für Jobzufriedenheit bei Machairi war, aber trotzdem viel zu oft im Sterben endete.
Gwyn blickte durch das helle Zimmer, in dem ein Bett, ein Schrank und ein kleiner Tisch standen. Es sah aus wie ein Zimmer in einer gemütlichen Gaststätte: nett, aber austauschbar. Das Holzhaus, in dem sie einquartiert worden waren, kam einem Gästehaus gleich, dabei hätte er nicht gedacht, dass sich irgendjemand hierher verirrte, schließlich gab es nicht einmal einen Hafen.
Wenn er ehrlich war, wusste Gwyn selbst nicht so recht, weshalb er sich am liebsten von allen fernhalten wollte. Schließlich hatte ihm keiner der anderen etwas getan und er hatte keinen echten Grund, um sich auch zurückzuhalten, wenn Machairi nicht dabei war. Trotzdem fühlte es sich an, als würde er irgendein Verbot brechen, sobald er den Mund aufmachte, und dann wurde plötzlich alles noch schwieriger auszuhalten. Er war zu viel für sich selbst und sobald er sich nach außen präsentieren musste, drohte das fragile Gebilde, das er seine Psyche nannte, zusammenzubrechen. Kaum hatte er den Gedanken beendet, fühlte er sich nur noch schlechter. Gwyn schämte sich. Er schämte sich für alles, was er tat, dachte und getan hatte. Nichts schien er richtig machen zu können. Nicht vor sich selbst und nicht vor anderen und diese Tatsache wollte ihn schier in den Wahnsinn treiben. Wie konnte man sich nur selbst so sehr im Wege stehen? Manchmal war es ihm, als stünde sein altes Ich belustigt über ihm, um ihm zu sagen, dass er sich mal zusammenreißen sollte. Doch dann erinnerte er sich wieder, dass sein altes Ich mehrere sehr dumme Entscheidungen auf einmal getroffen hatte und es für notwendig gehalten hatte, hunderte Menschen zu verbrennen, und der Kreislauf begann von vorne.
Stöhnend vergrub er das Gesicht in den Armen, während die Vögel vor dem Fenster zwitscherten und die zauberhafte Andersartigkeit dieses Ortes durch das Fenster hereingetragen wurde. Aus einem sicherlich völlig bescheuerten Grund machte dieser perfekte Ort seine Melancholie noch etwas schlimmer. Hauptsächlich, weil er wusste, dass er sich hier unter normalen Umständen unheimlich wohl gefühlt hätte, unter Zhaki und an einem Ort, der vor Magie nur so zu vibrieren schien. Die ganze Zeit wollte er sagen, dass er sich leer fühlte, aber eigentlich fühlte er sich nicht leer – eher im Gegenteil. Er schien geradezu zu platzen vor Gefühlen, die er nicht zu fassen bekommen konnte und die ihn nur noch wahnsinniger machten. Das Chaos war so vollkommen, dass er dem nicht standhalten konnte.
Drückende Kopfschmerzen zogen dem Feuerspucker durch den Schädel und er ließ die Stirn auf seine Arme sinken. Zusammengekauert saß er mit geschlossenen Augen da und versuchte, wie schon in den Tagen zuvor die Kraft zu finden, sich gegen das Chaos aufzulehnen. Hätte es doch nur einen Weg gegeben, alles wiedergutzumachen, wenigstens das verwirkte Vertrauen zurückzuerhalten. Er wusste, dass er sich falsch entschieden hatte in Om’falo. Eigentlich hatte er es schon in dem Moment gewusst, in dem er die Entscheidung gefällt hatte. Es war schließlich nicht so, als hätte er Kendra nicht dort lassen können. Es war nicht Gwyns Verantwortung gewesen; die Leben seiner Freunde dagegen hatte er willentlich aufs Spiel gesetzt. Also musste er entweder Machairis Vertrauen zurückgewinnen, oder er konnte sich bei nächster Gelegenheit irgendwo runterstürzen. Man konnte also quasi sagen, dass er nichts zu verlieren hatte. Was wäre eine bessere Voraussetzung, um sich auf eine Todesmission zu begeben?
Je länger er den Gedanken im Kopf drehte, desto sicherer wurde er, dass sich ihm hier eine Chance bot, die er gerne nutzen wollte. Das Problem daran war nur, dass er Machairi davon überzeugen musste.
Eine der hervorstechendsten Eigenschaften von Machairi war, dass er sich nicht bequatschen ließ. Ihn zu überreden war nie von Erfolg gekrönt. Allerdings hätte Gwyn sich vorstellen können, dass Rish es vielleicht schaffen konnte. Sie hatte einen seltsamen Einfluss auf den Schatten und für einen kurzen Moment spielte er mit dem Gedanken, sie um Hilfe zu bitten. Er wusste allerdings, was sie von der Idee halten würde und dass sie sich noch immer vor Machairi fürchtete und dass seine Chancen vermutlich nicht besser standen, wenn er jemand anderen vorschickte, und so verwarf er den Gedanken wieder.
Lange saß Gwyn in seinem Zimmer und versuchte, einen Plan auszuhecken, während seine Gedanken sich überschlugen und das Tageslicht der Dämmerung wich. Lange Schatten warf das sterbende Tageslicht nun in den Raum und der Feuerspucker spürte, wie es noch enger in seiner Brust wurde. Mit der Nacht und der Dunkelheit wurden die Selbstvorwürfe stärker und hätte er nicht bereits zu einem kleinen Paket gerollt in der Ecke gekauert, hätte er sich noch weiter zusammengezogen. So konnte es nicht weitergehen. Er war müde. Müde vom Traurigsein und dem grausamen Gefühl in seinem Inneren. Es machte ihn wahnsinnig – schon wieder, oder vielmehr immer noch.
So konnte es nicht bleiben. Bevor er wirklich wusste, was er tat, war er auf den Beinen. Wenn es etwas gab, was ihn aus diesem Grauen befreien konnte, das sein Herz und seinen Kopf einfing, dann war er bereit, alles dafür zu tun.