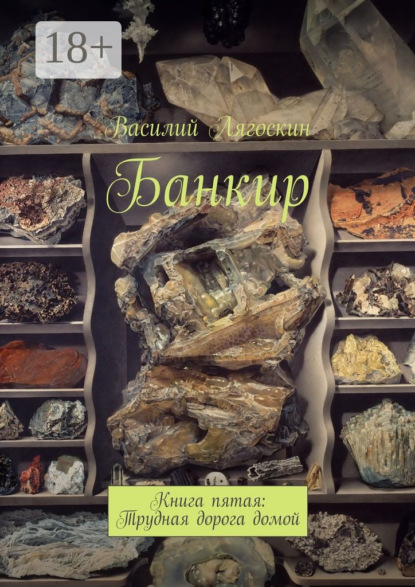- -
- 100%
- +
Sanders runzelt die Stirn. Sudresh weiß nicht, wie er auf Maggie reagieren soll. Seine Hilflosigkeit aktiviert Sanders’ Wachhund. »Ich glaube, Sie sollten wieder in Ihren Arbeitsmodus wechseln«, sagt der kühl. »Bevor Ihr guter Ruf Schaden nimmt.« Damit hat der Wachhund genug Laut gegeben, er zieht sich in den Hintergrund zurück, während sich Sudresh wieder zur Tür dreht, die ID-Card vor den Sensor hält und in seinem Labor verschwindet. Die Tür schließt sich mit dem gleichen leisen hydraulischen Seufzen, wie es beinahe allen Türen in dem Gebäude gemein ist.
Maggie Finch wechselt das Standbein, tut so, als ob sie sich den kurzen blonden Bob richten würde, und legt dabei dezent den Schalter hinter ihrem Ohr herum. Dann dreht sie sich abrupt um und geht den Flur hinunter, zu ihrem eigenen Büro. Die Ablehnung ist drei Meter weiter schon vergessen, jetzt hat sie sich um Zeitpläne, Berichte und Sicherheitsstufen zu kümmern.
Als Douglas am Abend wieder in die U-Bahn einsteigt, hat er den guten Vorsatz, sein Socket überprüfen zu lassen, wieder vergessen. Sue hatte ihn aus seinen Überlegungen gerissen, hatte ihm ein Extraprojekt zusätzlich zum Reporting aufgehalst.
Jetzt ist er müde und erschöpft. Die Augen schmerzen von der Bildschirmarbeit, der Kopf ist leer. Womit wird er sich die Zeit vertreiben, wenn er zu Hause ankommt? Er weiß es nicht. Vielleicht etwas lesen, vielleicht etwas zocken. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass er mit einem Bier vor der Videowall einschlafen wird, nur um mitten in der Nacht aufzuwachen und ins Bett zu gehen.
Douglas hat keine Freunde. Im Höchstfall sind es Bekannte, im Regelfall Typen, die er auf seinen eingefahrenen Wegen immer wieder sieht. Sei es der Besitzer des Imbissstandes, der Wachmann seines Blocks oder die Putzfrau in der Firma. Man grüßt sich, wünscht sich einen guten Tag, das war es aber auch schon. Die Sozialpersönlichkeiten sind allesamt mit einer Grundfreundlichkeit ausgestattet, ansonsten aber auch mit einer gehörigen Portion Distanz zum Gegenüber.
Jetzt ist allerdings Feierabend. Die Distanz schwindet, die Menschen drängen sich in der Bahn, die Stimmung ist heiter oder gereizt. Douglas hat seine Hand in eine der Halteschlaufen gehängt und die Augen geschlossen. Er will sie nicht sehen, die anderen. Da wird er angerempelt.
»Hey, Mann, mach Platz. Die Lady muss zur Tür durch.«
Douglas macht einen Schritt zur Seite, die Augen sind noch immer geschlossen. Er will gar nicht wissen, wer da was von ihm fordert. Das ist seine Form des Protestes.
Ein Mensch presst sich an ihm vorbei, und nein, was Douglas da fühlt, ist nicht weiblich. Für einen Moment kotzt ihn die Welt an, in der er lebt. »Lady!« Er schnaubt verächtlich.
Douglas hat Glück, der Wachhund des fetten Typs hat es nicht gehört. Beschwingt verlässt der die Bahn und wendet sich dem Ausgang zu. Mit einem verruchten Lächeln auf den wulstigen Lippen fährt der Fremde auf dem Rollband der Oberfläche entgegen. Die Lady ist ein Vamp.
Douglas steigt eine Station später aus. Die Mauern des Gettos kann man von hier aus nicht mehr sehen, aber sie sind dennoch nahe und manchmal, wenn der Wind von Süden kommt, kann man es riechen. Es ist Douglas immer eine Mahnung, noch härter zu arbeiten, damit er niemals wieder dort landen wird. Denn es ist wahr – er wurde dort geboren.
Douglas wischt sich über die Augen. Er will nicht an das Getto denken. Er will vor allem nicht an seine Eltern denken. Ohne ihren Tod wäre er vielleicht niemals in Suburbia gelandet. Müsste jeden Morgen um den streng reglementierten Einlass in die City kämpfen, um irgendeinen Job zu machen. Douglas sperrt diese Gedanken endgültig aus.
Er schließt die Tür auf, tritt in das Halbdunkel seiner halbwegs komfortablen Einraumvierzonenwohnung. Es geht eine Stufe hinunter, schon steht er im Wohnzimmer, eine Couch, ein Sessel, ein Tisch auf einem verschlissenen Läufer. Sechs Schritte geradeaus ist er am Arbeitsplatz vorbei in der Küche angelangt. Diese besteht aus einer Spüle, einem halbhohen Schrank, auf dem zwei Induktionskochplatten und ein kleiner Ofen stehen, sowie einigen Regalen, mit Lebensmitteln gefüllt. Rechter Hand liegt die Schlafnische mit Bett und Kleiderschrank, mit einem halbhohen Bücherregal vom Rest der Wohnung abgetrennt. Von dort aus geht es ins angrenzende, schlauchförmige Badezimmer.
Douglas hat seine Tasche auf dem Schreibtischstuhl abgelegt, seine Jacke auf das Bett gepfeffert und wäscht sich nun im Badezimmer das Gesicht mit kaltem Wasser ab.
Wie soll es weitergehen? Er würde gerne reden. Aber mit wem? Wer wird zuhören wollen, wenn er von Programmen erzählt, die Zahlen und Informationen verwalten?
Er trocknet sich ab, geht zum Arbeitsplatz. Er nimmt sein Smartphone aus dem Office-Bag und steckt es in die Dockingstation. Mit einem Brummen erwacht es zum Leben. Der gläserne tischbreite Monitor schnurrt in die Höhe, bis er mit einem leisen Klacken in der Endposition einrastet. Einen Moment später erscheint die Benutzeroberfläche auf der Scheibe. Douglas greift hinter sich und öffnet den Kühlschrank. Tastet im Türregal herum, erwischt einen kalten Flaschenhals, zieht das Bier heraus und tritt mit dem linken Fuß hinter sich. Die Kühlschranktür ist wieder geschlossen.
Auf dem Bildschirm tummeln sich Werbung und eine KI-generierte Übersicht über Themen, die Douglas interessieren könnten. Heute jedoch will er nicht einem einzigen Link folgen. Mechanisch öffnet er sein Bier und nimmt den ersten Schluck. Setzt die Flasche ab und lauscht in sich hinein. Noch ist alles still. Zu still.
2.
Der Sturm treibt mich vor sich her, ich taumle durch die Dunkelheit. Ein Brausen umgibt mich, es tost, es rauscht. Der Atem wird mir von den Lippen gerissen. Ich schnappe nach Luft, laufe, renne. Reiße die Augen auf, doch es bringt nichts. Um mich herum ist alles tintenschwarz. Irgendwann verliere ich die Schuhe, erst den linken, ein paar Stolperer später den rechten. Festgebackener Sand scheuert an den nackten Sohlen. Ich bleibe stehen, stemme mich gegen den Wind. Schmerz schießt mir ins rechte Knie und ich schreie ihn in den Sturm hinaus.
Als beides vergangen ist, Schmerz und Schrei, weggefegt von einer Böe, verändert sich die Geräuschkulisse. Der Sturm nimmt ab, dafür höre ich jetzt Wellen, die donnernd an den Strand schlagen. Salz legt sich auf die trockenen Lippen, verkrustet dort. Alles wird klamm und kalt, ich zittere. Meeresschaum und Sand fegen über den Boden und brechen sich nass und körnig an meinen Knöcheln.
Dieses Aufatmen währt nicht allzu lange, schon gewinnt der Wind wieder an Stärke und schiebt mich über den Strand. Der Sand wird feuchter, die Brandung klingt näher. Wenn ich mich nicht endlich aufbäume, werde ich ins Meer gejagt. Werde zum Spielball der Wellen, die mich über den nassen rauen Sand schleifen, solange bis nichts mehr von mir übrig bleibt. Zerrieben, zerstört, vernichtet.
Inmitten des Tohuwabohus erklingt ein Lachen. Ein hämisches, keckerndes Lachen.
Ich erkenne es wieder und frage mich für einen Moment, auf welchem Weg es an diesen verfluchten Ort gefunden hat.
Sollte es nicht in mir eingesperrt sein?
Der Wind flaut ab. Die Wellen ziehen sich zurück. Die Dunkelheit reißt auf und gibt den Blick auf einen einsamen Strand frei. Das Lachen springt über Muschelschalen und angelandetes Treibgut. Es flieht einen schmalen Pfad hinauf, der sich über Felsen windet und bis zum Scheitelpunkt der Steilklippen hinaufführt. Dort verliere ich es aus den Ohren.
Ein Hauch von Lavendel weht mir um die Nase und ich weiß, dass ich den gleichen Weg werde nehmen müssen. Wer weiß schon, was mich hinter den Klippen erwartet …
Als Douglas am Morgen in die Bahn steigt, ist er unruhig. Noch immer spürt er den Sand an den Knöcheln, ein Mitbringsel des verwirrenden Traumes der letzten Nacht. Das Lachen beunruhigt ihn. Es hat sich fortgestohlen, ist verschwunden. Er weiß nicht, was er davon halten soll, ob er sich befreit fühlen darf oder ob er besorgt sein soll. Was wird es ohne ihn anstellen. Wird er Dinge tun, an die er sich nicht erinnern kann? Hat er die Kontrolle verloren?
Abwesend starrt er aus dem Fenster. Die Bahn taucht in die Tiefe ab, rast an den inzwischen verwaisten Stationen vorbei, mit denen das Getto einst an die Strecke angeschlossen war. Die Namen sind ausradiert worden, jetzt sind es nur noch römische Ziffern, die die Abfolge kennzeichnen. Bei VI schreckt Douglas auf. Sie befinden sich unter dem Herzen des Gettos. Seine Eltern haben hier gelebt, genau hier. Mommy? Douglas beißt die Zähne zusammen. Er will sich nicht an sie erinnern. Das hat noch nie gutgetan.
Schon will er die Augen verschließen vor den ungewollten Bildern, als ihm jäh bewusst wird, dass dies zwar ein probates Mittel ist, um der Außenwelt zu entfliehen, den Erinnerungen aber Tür und Tor öffnet. Also zieht er die Augenbrauen hoch, damit die Lider nur ja nicht zueinanderfinden und ihn in der Dunkelheit mit sich selbst allein lassen. Übelkeit überfällt ihn. Die Regung, einfach auszusteigen, um die nächste Bahn zurück zu nehmen, wird schier übermächtig.
Aber die Bahn rast weiter durch die Dunkelheit, vorbei an den vernagelten Stationen. Ein simples Umsteigen ist hier schon lange nicht mehr möglich. Er wird diesen Druck aushalten müssen, bis zum bitteren Ende. Seine Hand verkrampft sich um den Haltegriff, er schaukelt mit der Bahn, die sich in die Kurve legt. Irgendjemand hat weiter vorne das Fenster aufgemacht, Fahrtwind springt ins Abteil, zieht mit kalten Geisterfingern über Dougs Gesicht. Er wird diese Berührung den ganzen Tag spüren.
Kaynee liebt ihr Bett, an freien Tagen sogar mehr als üblich, denn niemand zwingt sie aus den Federn. Das ist ihr ganz persönlicher Luxus in den Zeiten, in denen sie keinen Besucher zu betreuen hat. Heute ist Freitag – und es fühlt sich an wie Sonntag. Kaynee blinzelt aus den Federn in die helle Sonne und lächelt.
Nach Santanas Abschied gestern hat ihr die Professorin noch keinen neuen Menschen an die Seite gestellt. Professorin Paulson ist es wichtig, dass man die Seelen, die sich hier einfinden, niemals als Nummer oder als Fall sieht. Sie betont immer, dass es sich hier um Menschen handelt – Menschen mit Wünschen, Sorgen, Nöten.
Für Kaynee war das eine Umgewöhnung gewesen. Bevor sie nach Zenith gekommen war, hatte sie für ein kleineres städtisches CADIAS gearbeitet, in dem sie kaum eine Minute für sich gefunden hatte. Dort musste sie bisweilen drei Fälle gleichzeitig betreuen. Irgendwann hatte Karen gestreikt und Kora die Kündigung schreiben lassen. Als Kaynee sich unverhofft auf der Straße wiedergefunden hatte, war ihr dann die Anzeige von Zenith in die Hände gefallen. Was hatte sie schon zu verlieren gehabt? Nichts. Also war sie mit ihrem Koffer hierhergekommen, bereit, alles auf eine Karte zu setzen.
Kaynee schiebt den Arm unter das Kissen, dreht sich auf die Seite und schließt die Augen. Ihre Gedanken kehren wieder in die Vergangenheit zurück.
Als sie damals dem Taxi entstiegen war, das sie von der Bahn hierher ins Nirgendwo gebracht hatte, stolperte sie förmlich über einen Bär von Mann, der sich in blanker Wut gegen die gläserne Eingangstür warf. Kaynee konnte es sich selbst jetzt, drei Jahre später nicht erklären, warum ihre Meute so gehandelt hatte, aber letztlich hatte Katy, die jüngste unter ihnen, den Hünen an der Hand genommen und war mit ihm losgegangen. Sie umkreisten einmal den gesamten Komplex und Max, der Bär, redete, schwieg. Redete wieder. Katy hörte zu oder machte Witze. Max entspannte sich zusehends in ihrer Gegenwart. Sie funktionierten gut miteinander, und als sie wieder am Haupteingang eintrafen, wartete Professorin Paulson bereits auf das ungleiche Paar. Sie nickte Kaynee kurz zu, deutete an, dass sie doch bitte im Entree warten solle und verschwand an Max’ Seite in den Tiefen von Zenith.
Kaynee lächelt, als sie sich an Max erinnert. Das erste Patenkind in einem neuen Zentrum vergisst man nie, heißt es, und da ist was Wahres dran.
Da geht ein Zucken durch Kaynees Geist, es ist, als ob sich da jemand anderes in den Vordergrund schieben will.
»Er war ein toller Kerl«, raunt es in ihrem Kopf. »So stark und so willig.« Ein dunkles Lachen folgt.
»Oh nein«, murmelt Kaynee. »Halt dich zurück. Mach mir nicht den Morgen kaputt.«
Ein missbilligendes Schnalzen klingt in ihr wider.
Kaynee beschließt, es zu ignorieren. Schon seit einiger Zeit muss sie immer wieder zu diesem Trick greifen. Es ist, als ob Nachbilder ihrer verschiedenen Anteile durch ihren Geist ziehen oder, was schlimmer wäre, ein Eigenleben entwickeln.
Sie streckt sich ausgiebig. Ein paar Tage Freizeit würden ihr und der Meute sicherlich guttun, einfach mal unbeschwert vor sich hinleben und sich dabei nur um sich selbst kümmern. Das wär’s!
Kaynee schüttelt ihre Haare zurück. Die Sonne steht inzwischen kurz vor dem Zenit und ein lauer Wind lässt die Markise leise knattern. Es ist ein heißer Tag, ein trockener Tag, so wie der Tag zuvor und so wie wohl auch der nächste Tag sich zu werden anschickt. Tage, die das Leben ausdorren.
Kaynee wirft sich wieder ins Kissen zurück, dreht sich auf den Bauch und greift sich hinter das Ohr. »Kora«, denkt sie kurz, dann switcht ihr Bewusstsein bereits in das der allgegenwärtigen Organisatorin.
Die besieht sich die Werte, die durch die ständige Übermittlung an die Basisstation auf dem Nachttisch weitergeleitet werden. Nach der Beendigung der Analyse kommt Kora zu einem Schluss: Alles in allem ist ihre Entität eine gesunde junge Frau, die nur an einem, allerdings verzeihlichen Übel leidet. Faulheit. In milder Form, aber präsent genug, um einen Motivationsschub zu vertragen. Kurzum, Kora holt Luft, um Kaynee so richtig den Marsch zu blasen, doch da schaltet sich Karen ein und verordnet eine Runde Yoga für den allgemeinen Frieden.
Während Kaynee nun doch die Beine aus dem Bett schwingt und sich sogar auf den Morgengruß freut, hört sie mit einem Mal ein wildes Gezischel.
»Warum macht sie das denn jetzt?«
»Sie will’s doch gar nicht. Sie will viel lieber an ihrem freien Tag rumgammeln und wieso auch nicht?«
»Ist doch eh viel zu heiß für Sport!«
Kaynee fährt erschrocken herum. »Was?«, ruft sie in den leeren Raum hinein.
Alles ist still. Nach einem Moment des Zögerns, der angestrengten Wachsamkeit, entspannt sie sich wieder und geht zu ihrem Kleiderschrank hinüber. Sie will sich gerade die weit geschnittene Yogahose und das passende Top aus dem oberen Fach nehmen, da wird ihr schwarz vor Augen. Sie schwankt leicht, greift sich mit der einen Hand an die Stirn, mit der anderen stützt sie sich am Schrank ab, die Hose fällt dabei zu Boden. Sie schließt die Augen und zählt bis drei.
Als sie die Augen wieder öffnet, findet sie sich auf dem Balkon wieder, der zu ihrem kleinen Apartment gehört. Sie trägt ein durchsichtiges Babydoll, keinen Slip und liegt wie hingegossen auf dem Liegestuhl. Halb im Schatten, sommerlich träge, wie eine Katze, die sich in der Sonne rekelt.
»Scheiße«, entfährt es ihr leise. Wie viel Zeit ist ihr verloren gegangen? Und wer hat Kandy überhaupt auf den Plan gerufen?
»Kora!«, denkt Kaynee, »Kora, bitte übernimm. Schaff Ordnung!«
»Nein, Süße!« Eine dunkle Frauenstimme erklingt in Kaynees Kopf. »So schnell lasse ich mich nicht wieder einsperren.« Und anstatt wieder ins Zimmer zurückzukehren, rekelt sich Kandy, die nun vollends die Kontrolle über die Entität an sich genommen hat, tiefer in das Polster des Liegestuhls.
Als Douglas sich abends wieder in die Menge der Heimkehrer einpasst und sich die Treppen zum Gleis hinunterschieben lässt, wischt er sich über das Gesicht, als ob ihn dies wieder zur Besinnung bringen könnte. Tut es nicht. Hat es den ganzen Tag über nicht getan. Die Menschen um ihn herum sind heiterer als während des Restes der Woche. Das freie Wochenende verleitet zu gepflegtem Übermut und angepasster Vorfreude im Rahmen der sozial verträglichen Normen.
Douglas sieht sich um. Was den anderen so viel Spaß verspricht, macht ihn unsicher. Als er sich einen Sitzplatz gesucht hat, fängt er an, einen Achtundvierzigstundenplan zu entwerfen. Den Abend wird er so herumbekommen wie an jedem anderen Wochentag auch, da macht er keinen besonderen Unterschied. Er wird sich also vor seine Videowall setzen, ein Bier aufmachen und bis zur Besinnungslosigkeit Reiseberichte auf dem Traveller Guide oder Dokumentationen auf dem Science Channel sehen. Oder natürlich zocken. Alles andere ist ihm zu lästig, zu laut, zu aufdringlich. Am Samstag wird er früh aufstehen. Und dann? Douglas überlegt.
Letzte Woche ist er im städtischen Freibad seines Quadranten abgetaucht. Diese Woche könnte er eine Radtour zum Grüngürtel machen. Wobei der Teil des Grüngürtels, den er von seiner Wohnung aus am schnellsten erreichen kann, seinem Namen zurzeit wenig Ehre macht. Da wellt sich nichts Grünes bis zum Horizont, da ist alles graubraun verdorrt. Der Boden ist nach intensiver Bewirtschaftung ausgelaugt und wird neu aufbereitet. Die saftigen Weidegründe wandern währenddessen gegen den Uhrzeigersinn um City, Getto und Suburbia herum.
Im Augenblick befinden sie sich im zweiten Quadranten, im tiefen Südwesten. Er lebt im Nordwesten. Wenn er also wirklich Grün sehen will, dann hat er einen langen Weg vor sich. Oder er macht es sich einfach, schnappt sein Fahrrad, steigt wieder in die U-Bahn Richtung Süden und kürzt die Strecke auf diese Weise ab. Aber wer nimmt sein Rad schon mit in die Bahn? Das fällt doch nur unnötig auf.
Douglas beschließt, hart zu sich zu sein. Das ist leichter, als sich den leeren Stationen und seinem leeren Leben zu stellen. Also nimmt er sich vor, während er auf seinem genormten Hartplastiksitz über die Schwellen und Weichen der U-Bahn hinwegrattert, am Samstagmorgen in den Westen zu fahren und von dort aus am Rand von Suburbia südwärts zu radeln, solange bis ihm die Puste ausgeht. Irgendwann wird er danach wieder zu Hause ankommen, halb tot zwischen die Laken kriechen und traumlos bis in den Sonntagvormittag hineinschlafen. Nach einer langen Dusche wird er sich an den Rechner setzen und die Arbeit der letzten Woche überprüfen, während die Wäsche in der Trommel rotiert. Vielleicht wird er hinterher noch einen Spaziergang durch sein Viertel machen. Vielleicht aber auch nur putzen.
Douglas kraust die Stirn. Es sind ihm eindeutig zu viele »Vielleicht« in seinem Plan, aber der Tag war lang, er mag sich nicht mehr konzentrieren, er sehnt sich auf die Couch.
Als er eineinhalb Stunden später dort liegt, ist er für einen langen Augenblick glücklich. Vier Flaschen Stout tragen dazu bei. Auf dem Bildschirm laufen Musikvideos ohne Ton. Douglas nickt dazu in dem Rhythmus, den ihm sein Pulsschlag vorgibt. Jetzt muss er es nur noch in sein Bett schaffen und einschlafen, bevor das allgegenwärtige Grübeln einsetzt.
Bedächtig schwingt er die Beine über die Sofakante und setzt die bloßen Füße nebeneinander auf den kühlen Fließestrich. Nach drei Atemzügen erhebt er sich mit einem Ruck. Ein kurzer Schwindel erfasst ihn. Dann schleppt er sich ohne Umweg über das Badezimmer zu seinem Bett und fällt mit dem Gesicht voran in die Kissen. Schon glaubt er, gewonnen zu haben, da blitzt ein Bild vor seinem inneren Auge auf.
Mommy!
Douglas ist wieder Kind, ist wieder zweieinhalb Jahre alt. Er ist in den Kleiderschrank gekrabbelt, den Mommy aufgelassen hat. Poppa ist nicht da, das kennt Douglas bereits. Poppa kommt erst spät nach Hause, wenn Douglas schon im Schlafanzug in seinem Bettchen steht. Douglas wartet auf Poppa, kann erst dann schlafen, wenn der Vater nach ihm gesehen hat. Mommy ist deswegen wütend, immer wieder wird es laut hinter der Tür, die Poppa nach dem Gutenachtkuss hastig hinter sich schließt.
Wenn Mommy alleine ist, dann ist sie ganz anders. Sie nennt Douglas ihren kleinen Prinzen. Er weiß nicht, was das bedeutet, aber sie klingt warm und weich, wenn sie das sagt, also muss es etwas Gutes sein. Douglas ist vergnügt, als er in den Schrank krabbelt. Es ist dunkel hier und alles riecht nach Mommy. Er greift mit beiden Händen in die Kleider, sodass die Bügel aneinander klicken. Seine Finger sind vom synthetischen Honig verklebt. Das erste Kleid rutscht vom Bügel, dann das zweite. Douglas verschwindet unter einem Haufen Tüll und Chiffon. Es wird stickig. Douglas beginnt zu greinen.
»Was in Teufels Namen?« Mommy ist plötzlich da. Sie brüllt, das Gesicht ist wutverzerrt. »Satansbraten! Wie oft habe ich dir gesagt, dass du hier drinnen nichts zu suchen hast?« Sie holt Luft. Der rechte Mundwinkel krampft spastisch. Sie fällt in sich zusammen.
»Das sind meine Sachen. Alles, alles meine Sachen.« Mommy brüllt nicht mehr, Mommy quengelt. Mit einem Ruck zerrt sie ihm den Chiffonalbtraum vom Kopf. Douglas sieht, wie sich ihre schlanke Silhouette gegen das helle Rechteck der geöffneten Schranktüren abhebt. Mit dem Licht kehren auch die Farben zurück. Mommy fällt auf die Knie und birgt das Gesicht in dem hellblauen Stoff.
Sie holt tief Luft, hebt wieder den Kopf und lächelt auf das Kleid hinunter. Da krampft es erneut in ihrem Gesicht. Der rechte Mundwinkel verzerrt sich.
Mommy dreht und wendet das Kleid in den Händen. »Wann habe ich das gekauft? Wo habe ich es gekauft? Und warum?« Auf ihrem Gesicht spiegelt sich Erstaunen wider. Verwunderung. Schließlich Ekel. »Das trägt doch nur eine Nutte. Eine billige Nutte, die sich als reiche Frau tarnt. Aber letztlich geht es immer nur um das eine. Beine breitmachen.«
Douglas ist längst vergessen. Mommy steht auf, zerrt den Stoff hinter sich her ins Badezimmer und stopft ihn in die Badewanne. Aus dem Waschbeckenunterschrank greift sie sich das Waschbenzin, kippt es über die Chiffonfederwolke. Douglas ist ihr gefolgt. Mit großen Augen steht er im Türrahmen und sieht, wie sie ein Zündholz anreißt und in die Wanne fallen lässt. Die Flammen schlagen hoch. Es riecht nach geschmolzenem Plastik. Mit einem Ausdruck katzenhafter Zufriedenheit steht Mommy daneben.
Da. Der Mundwinkel zuckt spastisch.
»Nein, nein, nein!« Wieder das kleinkindhafte Greinen. »Meine Sachen, meine wunderschönen Sachen!« Mommy wirft sich auf die Knie. Versucht, die Flammen mit der bloßen Hand auszuschlagen.
Da hält sie für einen Moment inne. Holt Luft. Spastischer Krampf. Mundwinkel außer Kontrolle.
»Verdammt noch mal. Wer hat diese Sauerei angestellt?« Mommy ist wieder auf die Füße gesprungen und dreht den Wasserhahn auf. Die Flammen ersaufen unter dem sprudelnden Strahl. Sie lässt sich schwer atmend auf den Toilettendeckel sinken. Birgt das Gesicht in den Händen. Wischt sich über die Augen. »Scheiße«, murmelt sie. »Was ist nur passiert?«
Douglas verliert den Halt und plumpst auf den Hosenboden. Schon will er losgreinen, doch er verschluckt sich an der ersten ungeheulten Träne.
Mommy sieht unwirsch zu ihm hinüber, als wüsste sie nicht, was sie nun auch noch mit ihm anstellen soll. Hat sie nicht genug Sorgen? Sie holt tief Luft, muss sich sortieren. Da zuckt es erneut um ihren Mundwinkel. Sie springt von ihrem Sitz auf, den Blick auf Douglas geheftet, warm jetzt und liebevoll.
Sie klaubt ihn vom Boden auf und wiegt ihn in ihren Armen. »Shhh, mein Prinzchen. Alles ist gut. Alles ist gut.«
Douglas windet sich in ihrem Griff. Er hat Angst vor ihr.
Douglas presst sich die geballten Fäuste auf die Augen. Der Gegendruck vertreibt normalerweise diese Nachbilder. So auch heute. Aber das Gefühl der Unsicherheit bleibt. Douglas ist, als ob der Boden schwanken würde, als ob er weich und nachgiebig wäre. Das Stout, verordnet er sich selber eine Erklärung. Das war eine Flasche zu viel, definitiv.
Er dreht sich auf den Rücken. Schon kehrt die Übelkeit zurück. Wellenförmig drängt es ihm die Kehle hinauf. Er schluckt ein paar Mal trocken und säuerlich, fragt sich derweil, ob er den Weg zur Nasszelle schaffen würde, und entscheidet sich dagegen. Also aushalten. Immer aushalten. Er wird nicht kotzen, wenn er es nicht zulässt.
Er schwingt ein Bein aus dem Bett und presst die Fußsohle auf den Boden. Und tatsächlich, die Welt beruhigt sich um ihn herum, das Bett kreist immer langsamer. Nach ein paar Minuten zieht er sein Bein wieder ins Bett, dreht sich herum und schläft ein, ohne vorher vom Sozial-Ich in den privaten Modus zu wechseln.