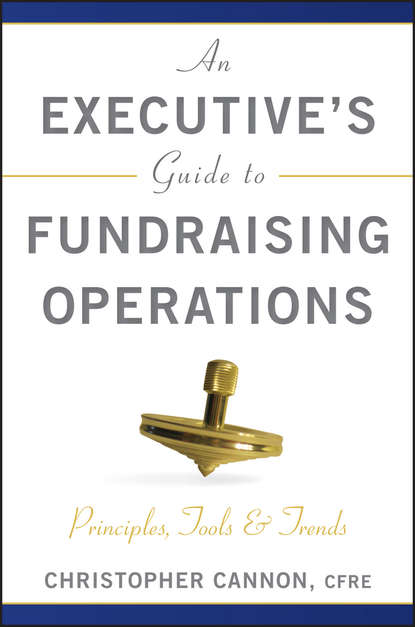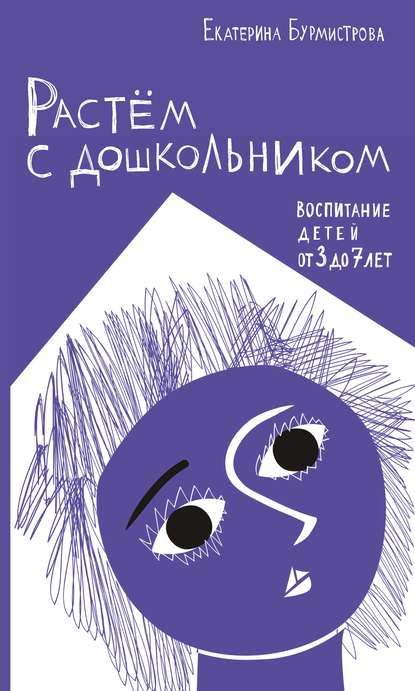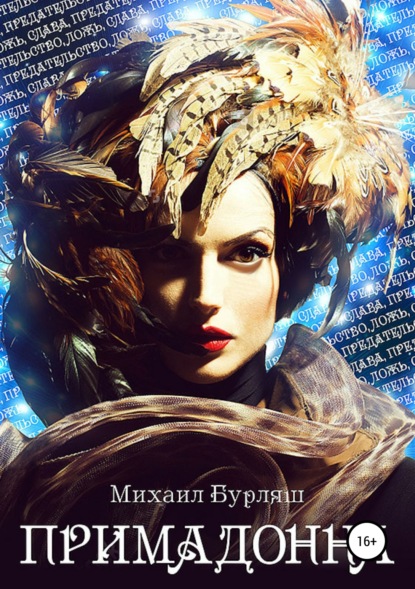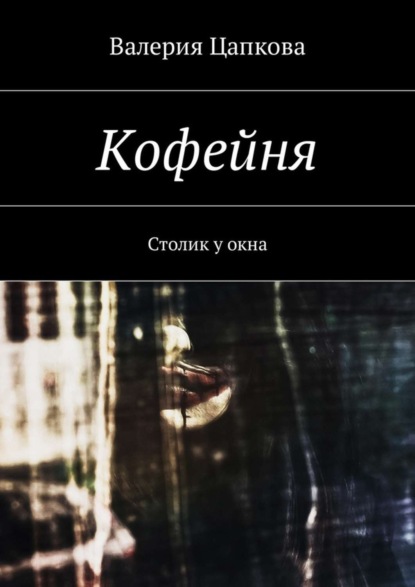Extra Krimi Paket Sommer 2021
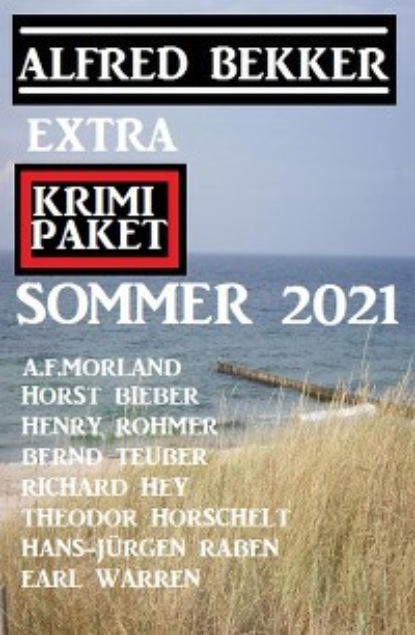
- -
- 100%
- +
»Ich freue mich, dass es Ihnen bei uns gefällt«, antwortete sie herzlich. »Das Zimmer ist frei.«
Die Bewölkung hatte sich verzogen, aber die Sonne wärmte nicht mehr so wie in der Vorwoche. Rogge verließ sich wieder einmal auf seine Wanderkarte. Allein zu laufen störte ihn nicht, er ordnete dabei seine Gedanken und fühlte sich frei, wenn er auf niemanden Rücksicht nehmen und keine Fragen beantworten musste.
Bis jetzt hatte er sich nicht mit Ruhm bekleckert. Dank Gertrud hatte Rogge zwar viel erfahren, und bevor er abreiste, musste er noch herausfinden, warum sie so schnell Vertrauen zu ihm gefasst hatte. Aber seine Anwesenheit hatte niemanden wirklich aufgescheucht, obwohl er sicher war, dass Gertrud eifrig im Dorf verbreitet hatte, welchen Beruf er ausübte.
Auf der anderen Seite - die beiden Männer vor Schönborns Villa. Mit einem gefälschten Autokennzeichen und bewaffnet. Und die beiden Schüsse. Irgendeinem Menschen war er schmerzhaft auf die Füße getreten, aber Rogge hatte keine Ahnung, wem und wann. Zuletzt Simons Geheimniskrämerei. Also wohl doch kein Fall einfacher Amnesie. Schönborn würde nach der Samstagepisode schon dafür sorgen, dass Inge Weber geschützt wurde, um die Sicherheit der Dunkelblonden musste Rogge sich nicht den Kopf zerbrechen. Wenn - und das stand leider gar nicht fest - die beiden geflüchteten Knaben wirklich an der Person Inge Weber interessiert waren und nicht doch einen Bruch ausspioniert hatten.
Über Mittag stand Rogge in einer Schmiede und schaute zu, wie zwei Reitpferde beschlagen wurden. In der Volksschule hatten sie ein Lesebuch benutzt, in dem der Schmied noch schmiedete, der Müller mahlte und der Bauer hinter seinen Rössern fröhlich pfeifend schritt. Du meine Güte, wo war das alles geblieben! Die sentimentale Anwandlung gestand er auch dem jungen Meister, der ihn auslachte: »Es kommt alles wieder. Ich hab gut zu tun, wenn Sie Richtung Weltersmühle laufen, sehen Sie gleich zwei Reiterhöfe. Und drüben in Sickenbach wird ein Golfhotel gebaut.«
In Sickenbach kam Rogge mit einer alten Frau ins Gespräch, die im Heimatmuseum Spitzen klöppelte. »Nein, leben könnte ich davon nicht, aber die Rente besseres schon auf!« Bei den Preisen der ausgestellten Stücke schluckte Rogge trocken,
Der Rückweg führte ihn durch die Halterer Berge, hier wurde Wein angebaut und er kaufte sich für zwei Mark ein Faltblatt für den Weinlehrpfad. Dass der Tourismus eine Industrie war, wusste er, aber womit man den Besuchern Geld aus der Tasche zu ziehen vermochte, erregte seine widerwillige Bewunderung.
Im Bären war nichts los. Gertrud hatte ihr Stimmungstief überwunden und brauste im gewohnten Tempo zwischen Tischen und Tresen hin und her. Olli stützte sich mit einer Hand ab, strich sich über den Kopf und war mit den Gedanken weit weg. Die Krakeeler-Bank blieb leer. Doch gegen halb zehn kam Andrea Wirksen in die Gaststube und setzte sich an einen Tisch, Rogge konnte sie im Profil mühelos beobachten.
Sie bestellte ein Bier und einen Klaren und schüttelte sich, nachdem sie den Schnaps gekippt hatte, ihre mürrischverkniffene Miene hellte sich auf, als habe sie etwas heruntergespült, was sie bedrückt hatte. Sobald sie bei Gertrud bezahlt hatte, ging sie zum Tresen und redete auf Olli ein, der sie von oben herab unbewegt musterte und verächtlich die Nase rümpfte, als sie hüfteschwenkend den Bären verließ. Eine Viertelstunde später hinkte Benno Brockes in den Raum, unterhielt sich kurz mit Olli und verließ sofort wieder die Gaststube. Seine hohen Gummistiefel wirkten durch Lehm und Dreck wie gepanzert.
Gertrud lächelte grimmig, ihr entging nicht viel.
»Wo wohnt diese Andrea eigentlich?«
»In der Hauptstraße.« Eine Sekunde zögerte Gertrud, aber die Boshaftigkeit siegte über ihre Diskretion: »Da wird sie heute aber nicht schlafen.«
»Sondern wo?«
»Bei Benno.«
»Wo liegt denn diese alte Schäferhütte?«
»Halbwegs Herlingen. An der Straße zum Deneckerhof.«
In der Nacht blieb alles ruhig.
Mittwoch, 20. September
Den Tag vertrödelte Rogge in Herlingen. Zum ersten Mal langweilte er sich, hockte in einem Café und studierte den Stockerboten von der ersten bis zur letzten Zeile, stöberte in der Buchhandlung und besichtigte die Kirche, die außer einem ehrwürdigen Altar und fragwürdigen Renovierungen künstlerisch nichts zu bieten hatte.
Um die Zeit totzuschlagen, lief Rogge auf der Landstraße zurück, ärgerte sich über die vielen Autos und bog dann in eine schmale Seitenstraße ein, die laut Hinweisschild zum Deneckerhof führte. Die Steigung war beachtlich, doch auf der Kuppe wurde man mit einem schönen Blick in ein Seitental belohnt, an dessen Ende Rogge hinter hohen Bäumen gerade noch einen Fachwerkbau erkennen konnte. Rechts lag die Schäferhütte, wie der Hauptkommissar vermutete, obwohl der Ausdruck Hütte nicht zutraf. Zwar gab es ein kleines Fachwerkhäuschen, aber auch zwei scheunengroße Gebäude, bis zur halben Höhe gemauert, darüber aus Holz gebaut. Die früheren Ställe? Das ganze Anwesen machte einen verlotterten, verlassenen Eindruck. Gemütlich schlenderte Rogge daran vorbei. Es passte zu Benno.
Auf dem Rückweg bemerkte er, dass die Dachfirste der Hütte und der Ställe etwas tiefer lagen als die Kuppe der Anhöhe. Also wind- und sichtgeschützt.
Mittlerweile kannte Rogge viele Gäste vom Sehen und um den einzigen Unbekannten, einen jungen Mann zweite Hälfte zwanzig, kümmerte sich Gertrud so angelegentlich, dass er grinsen musste. Ihre roten Ohren verrieten alles.
»Wie heißt er denn, Gertrud?«, flüsterte Rogge und sie seufzte: »Michael.«
Da hatte der Blitz gezündet, es brannte lichterloh.
Bis zum Einbruch der Dunkelheit verbargen sie sich in dem Dorf. Es schien ausgestorben zu sein, nur in zwei Häusern war Licht, die anderen halb eingestürzten Gebäude lagen im Dunkel, die Straßenlaternen funktionierten wohl schon lange nicht mehr. Kein Hund bellte, keine Katze miaute. Es roch nach Verfall, als ob hier nie Menschen gelebt hätten. Nach dem letzten großen Oder-Hochwasser waren viele weggezogen.
Ellwein schauderte und der Grenzschutzoffizier betrachtete ihn herablassend. An die Einsamkeit hatten sie sich gewöhnt, auch an diese merkwürdige Stille, in der alle Geräusche auf Kilometer deutlich zu vernehmen waren. Nicht einmal die Blätter raschelten und das Oderwasser floss lautlos.
Auch so ein Schreibtischstratege, der längst von der Realität abgehoben hatte. Warum Ellwein sich seinem Trupp angeschlossen hatte, wusste der Offizier nicht so genau, das BGS-Gebietskommando hatte einen Besucher vom Bundesnachrichtendienst angekündigt und den dienstlichen Befehl übermittelt, ihm alle technischen Geräte im Einsatz vorzuführen, falls nötig und möglich. An welchem Fall der Mann arbeitete, wollte man dem Grenzschützer nicht verraten; das war ungewöhnlich, aber hier an der deutsch-polnischen Grenze würde noch viel Wasser die Oder hinunterfließen, bis man von normalen Verhältnissen ausgehen konnte.
Hinter der Scheune stand ein Unimog. Die Mannschaft hatte auf der Ladefläche einen Mast hochgeklappt, der an der Spitze eine riesige Halbkugel aus festem Kunststoff trug, die Öffnung zur Oder gerichtet, die knapp einen Kilometer entfernt lag. In der Mitte der Halbkugel war eine kleinere Halbkugel montiert, bestückt mit zwei empfindlichen Mikrofonen. Kabel verbanden sie mit einem anderen Unimog, auf dem sich die batteriegespeisten Verstärker mit den vielen elektronischen Störfiltern befanden. Während der Fahrt hatte der Oberleutnant mit lässigem Stolz erklärt, dass sie mit diesen Fernmikrofonen hören konnten, wenn auf der anderen Seite des Flusses Ruder in das Wasser tauchten, vorausgesetzt natürlich, Wind und Wellen spielten ihnen keinen akustischen Streich.
»Falls doch - was tun Sie dann?«
Ach du meine Güte, ein Anfänger. Es gab Restlichtverstärker. Infrarotnachtsichtgeräte. Transportable Radargeräte. An einigen Stellen, die von den Schleusern bevorzugt wurden, hatten sie auf dem Flussgrund Kabel verlegt, die jede Veränderung des Magnetfeldes, etwa durch ein darüber fahrendes Boot, registrierten. Ja, sie maßen so genau, dass sie inzwischen Vorhersagen konnten, was sich da näherte, ein Holz- oder Metallboot, groß oder klein. Und wenn die Polen mitspielen und ihnen eines Tages erlauben würden, die Kabel auch auf der polnischen Hälfte zu installieren ... Na ja, man durfte ja wohl noch träumen. Mit dem Schleusen wurde viel Geld verdient, wahrscheinlich schon mehr als durch Drogenhandel und -transport.
»Ernie, es geht los!« Der Mann mit den Kopfhörern hatte in normaler Lautstärke gesprochen, trotzdem schrak Ellwein zusammen, als sei eine Bombe explodiert.
»Und wo?«
Auf dem Mast bewegte sich die Halbkugel ganz langsam.
»Planquadrat 11-26.«
»Die alten Buhnen. Auf geht’s!«
Die Männer bewegten sich geschickt und sicher durch die Dunkelheit. Dunkle Uniformen, dunkle Sportschuhe, die Gesichter geschwärzt.
»Kein Geräusch!«, mahnte der Oberleutnant. »Bleiben Sie dicht hinter mir!« Er steckte sich den Knopfhörer ins Ohr und schaltete das Funkgerät ein.
Die nächste Viertelstunde wuchs sich zu einem Albtraum aus. Ellwein hätte nie geglaubt, dass es so finster sein könnte, dass man wortwörtlich seine eigene Hand vor den Augen nicht sah. Und in dieser schwarzen Hölle hasteten die Männer, als trainierten sie Langstreckenlauf. Den Grund für die Eile hatte ihm der Oberleutnant voller Erstaunen über so viel Naivität dargelegt: »Ja, was denken Sie denn? Die beobachten seit heute Mittag unser Ufer. Eine ungewöhnliche Aktivität, ein Mensch, den sie nicht kennen, und das Übersetzen wird um 24 Stunden verschoben. Oder an einen anderen Ort verlegt.«
Natürlich, das hätte Ellwein sich selbst sagen können, aber das tröstete nicht über die Bäume und Sträucher, den unebenen Boden, die Löcher und Rinnen hinweg. Erst aufwärts, das musste der Deich sein, dann abwärts. Nach drei Minuten stachen Ellweins Lungen, er keuchte wie ein Blasebalg und der Oberleutnant drehte sich ungehalten nach ihm um, sagte dann aber doch nichts. Dabei schleppten die anderen Männer noch jeder ein Ausrüstungsstück, Scheinwerfer, Akkus, Handschellen, Fotoapparate, Stricke, Netze. Und natürlich ihre Waffen, mit denen sie die illegalen Einwanderer, die viel Geld für diese Reise in das gelobte Land zusammengekratzt hatten, einschüchtern konnten. Oder gegen die Schlepper benutzten, die sich mehr als einmal den Weg zurück über die sichere Grenze freigeschossen hatten; schließlich wussten diese Leute sehr genau, was auf dem Spiel stand.
Kein Laut, nur das dumpfe Poltern der Sohlen; dann schimmerte ein hellerer Streifen auf, der Fluss, die Männer schwärmten aus, Befehle brauchten sie nicht, das war alles oft geübt. Der Oberleutnant warf sich zu Boden, hielt das Glas mit dem Restlichtverstärker vor die Augen und pfiff kaum hörbar vor sich hin.
»Da, schauen Sie mal!«, triumphierte er.
Auf dem flachen Glas leuchteten grünliche Konturen auf. Tatsächlich, ein Boot, nicht leicht zu erkennen vor dem unruhigen Hintergrund. Ellwein gab das Gerät zurück, sein Begleiter summte entspannt, hielt dann plötzlich etwas vor den Mund: »Trupp zwei auf die Buhne. Links halten, ducken.«
Es war nicht zu glauben, er brummte den Gefangenenchor aus Nabucco, brach plötzlich ab: »Licht!«
Keine zwei Sekunden später flammten zwei Scheinwerfer auf und tauchten die Szene in grelles Licht. Ein Boot hatte an der Buhne angelegt, ein Mann kniete auf den Steinen und hielt den Bug fest, während andere Männer eilig an Land sprangen, jetzt plötzlich innehielten, als sei ein Film gerissen.
»Na prima!«, lobte der Oberleutnant laut. »Das hat ja hingehauen.«
Die Truppe zwei erschien wie aus dem Wasser gestiegen an der Heckseite des Bootes, die Maschinenpistolen im Anschlag. Zehn Sekunden rührte sich niemand.
»Wir haben sie. Platt machen und Abmarsch zum Einsammeln.« Unendlich weit entfernt sprangen Motoren an, es war fast beängstigend, wie weit die Nacht den Schall trug. Plötzlich schnellte unten ein Mann hoch, raste in Zickzacksprüngen auf das Wasser zu, eine Maschinenpistole belferte einen kurzen Stoß, dann verschwand der Mann im Fluss.
»Los! Platt machen!«, brüllte der Offizier in sein Mikrofon und mit diesem Befehl brach die Hölle los.
Von allen Seiten stürmten dunkle Gestalten auf die immer noch Versteinerten zu, zwei oder drei versuchten dann doch zu fliehen, aber sie hatten keine Chance, wurden zu Boden gerissen und gefesselt. Die meisten wehrten sich nicht, wie gelähmt durch diese Explosion von Härte und Rücksichtslosigkeit.
Eine Minute später war alles vorbei.
»Ich hab zweiundzwanzig gezählt«, sagte der Oberleutnant gleichmütig. »Nummer 23 haben wir leider verpasst, aber der wird uns keinen Ärger mehr machen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Zurück schafft er es nicht mehr. Die Oder hat hier eine stärkere Strömung, als es aussieht. Na, da sind ja unsere Erntewagen.«
In dem verlassenen Dorf tranken sie Kaffee aus Thermoskannen und Ellwein ließ sein Zigarettenpäckchen herumwandern. Der Oberleutnant musterte ihn immer noch wie einen schrägen Vogel, trotz seiner Jugend versprühte er viel Zynismus und seine Leute spurten, wenn er lässig einen Befehl hinwarf. Ein Landsertyp, nicht unbedingt Vertrauen erweckend, aber sicher tüchtig, und von seinen Männern verlangte er nur, was er selbst leistete.
Beim ersten Morgengrauen brachen sie auf.
Bevor Ellwein in Berlin losgefahren war, hatte er ein kurzes und unangenehmes Gespräch mit einem furztrockenen Juristen geführt, der beim Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt arbeitete und das Wort Kooperation noch nie gehört hatte, sogar ausfällig wurde, als Ellwein seine Kenntnisse ausbreitete: »Es gibt ein loses Spitzelnetz in Polen, über das der Grenzschutz gelegentlich erfährt, wann und wo eingeschleust werden soll.«
»Wer hat Ihnen das erzählt?«
»Unwichtig.«
»Von wegen. Wer?«
»Vergessen Sie’s, ich hab den Informanten auch schon vergessen.«
»O nein, so geht das nicht, das werden Sie ...«
»Genau so und nicht anders geht das.«
»Sie hören noch von mir! Sie Bond-Verschnitt!«
»Ich wusste gar nicht, dass man seine Eier abliefern muss, sobald man das Kanzleramt betritt.«
Das Netz existierte, sein Informant hatte ihn nicht betrogen und der forsche Oberleutnant hatte nicht nachgefragt, warum man ihn in dieser Nacht gerade an diesen Flussabschnitt kommandiert hatte. Aber das Netz konnte nicht auf Polen beschränkt sein, es musste weit nach Weißrussland und die Ukraine hineinreichen, wenn solche Meldungen bis zu achtundvierzig Stunden vor dem Schleusungsversuch eintrafen. Denn in Polen mussten sich die illegalen Einwanderer verborgen halten, weil sonst ihr Aufenthalt in einem so genannten sicheren Drittland aktenkundig wurde, oder anders: Sie mussten Polen so rasch wie möglich durchqueren, damit sie nicht - zufällig oder gezielt - entdeckt oder aufgehalten wurden. Dass diese Schleuserei trotz des Risikos ein grandioses Geschäft für die Schlepperbanden war, stand fest. Und wenn so eine Organisation erst einmal funktionierte, musste man sich nicht auf hilflose Menschen beschränken. Es gab Waren, Informationen, Gelder, Personen, die unbemerkt nach Deutschland zu schaffen waren - was äußerst generös bezahlt wurde. Oder aus Deutschland heraus.
Aber als Ellwein seine Idee vorgetragen hatte, den Grenzschutz einzuweihen, erstarrten die Gesichter vor ihm. Um Gottes willen! Das Netz aufrollen, dem man so viele Zugriffe auf illegale Einwanderer und falsche Asylbewerber verdankte? Und das zu einer Zeit, in der man jeden Tag im Zusammenhang mit der Zuwanderungsregelung eine neue Asylrechtsdebatte erwarten musste? War er denn von allen guten Geistern verlassen?
»Die Spionage ist nicht gestorben, nur weil die Sowjetunion nicht mehr existiert«, hatte Ellwein sie beschworen. »Das Geschäft ist sozusagen privatisiert worden, Patente sind jetzt wichtiger und lukrativer als Panzerzahlen und Raketenpläne und die Agenten schmuggeln nicht nur Menschen oder Zigaretten. Unsere alten KGB-Freunde arbeiten inzwischen auf eigene Rechnung, sie sind nicht weniger gefährlich, nur weil sie nicht mehr vom Obersten Sowjet entlohnt werden.«
Ellwein hatte gegen eine Wand gesprochen und zu den mildesten Beleidigungen gehörte noch die süffisante Frage, ob er für den BND händeringend neue Aufgaben suche, um seine Auflösung zu verhindern. Den schmerzhaftesten Schlag versetzte ihm ein Kollege, der ganz diskret murmelte: »Ich hatte doch läuten hören, dass Sie hinter einem rechten Ding her sind?!«
Dass er in ein Wespennest gestochen hatte, begriff Ellwein erst tags darauf: strikter Befehl, jede Kontaktaufnahme mit dem Grenzschutz war verboten. Wenn sein nächtlicher Ausflug bekannt werden würde, musste er mit einem Disziplinarverfahren rechnen. Aber Ellwein hatte nicht kneifen wollen, es gab Grenzen der Selbstachtung, die man nicht verletzen durfte, wenn man sich noch im Spiegel anschauen wollte, und von Gönter und Weinert hatte er die Schnauze gestrichen voll. Das war doch Kinderkram, herumzusitzen und Däumchen zu drehen, nichts zu tun und auf ein Wunder zu hoffen, während das Objekt sich über sie lustig machte. Okay, es gab Phasen, in denen man sich tot stellen musste, aber doch nur, um die Zeit abzuwarten, zu der man selbst aktiv werden konnte. Weinert würde das nie kapieren, und Gönter traute Ellwein nicht mehr hundertprozentig.
Sein Bekannter bedauerte am Telefon: »Die Sendung ist angekommen, aber dein Paket war nicht dabei.«
»Ein Päckchen ist ins Wasser gefallen.«
»Ja, hab ich auch gehört. Wahrscheinlich ist es jetzt ruiniert.«
Und wenn er nicht ertrunken war, würde der Mann diesen Weg nach Deutschland nicht mehr riskieren. Einmal pro Jahr reiste er ein und brachte Rohdiamanten mit, die ein Mitglied der Organisation unauffällig verkaufte. Der Erlös diente dazu, hiesige Agenten zu bezahlen oder Wissenschaftler zu bestechen, Patente zu erwerben oder Industriespionage zu finanzieren. Manche Regierungen zogen es vor, ihre Bestellungen auf diese Weise zu bezahlen, um keine Spuren bei den Banken zu hinterlassen.
Dem ersten, ungewöhnlich präzisen Tipp hatten sie nicht getraut, aber alle Einzelheiten trafen zu. Bei der letzten Kontrolle im Zug nach Wien musste etwas das Misstrauen des Kuriers so erregt haben, dass er sich nicht mehr auf seinen gefälschten Pass verlassen wollte. Zu der Zeit kannten sie schon seinen Tarnnamen und staunten nicht schlecht, als der Computer ihn bei der Auswertung einer Agentenmeldung identifizierte. Der Mann musste geahnt haben, wer das Boot aufgriff, und hatte lieber sein Leben als eine Festnahme riskiert. Also durften sie auch dieses Kapitel schließen.
Donnerstag, 21. September
Über Nacht war es kalt geworden, Rogge kehrte vor dem Gästehaus um und zog sich einen Pullover an. Die Sonne verbarg sich hinter einem grauen Schleier und auf seinem Marsch zum Beltenstein rüttelten ihn scheußlich kühle Böen durch. Sein letzter Wandertag, und wenn er Simon nicht erklärt hätte, er werde bis Freitag wegbleiben, wäre er heute schon abgefahren.
Von der ehemaligen Burg auf dem Beltenstein existierten nur noch wenige Mauern, der Eichenwald war bis zum Gipfel heraufgewachsen und nur durch eine kleine Schneise glitzerte wie ein heller Strich am Fuß des Berges die Bundesstraße, die hier auf der Trasse einer uralten Handelsstraße aus dem Böhmischen Richtung Rhein verlief.
Auf dem Parkplatz hätte Rogge sich am liebsten die Ohren zugehalten. Aus einem Bus stolperten, stürzten, drängten und purzelten Kinder heraus, die ihrem aufgestauten Bewegungsdrang durch Schreien, Toben und Rangeln erst einmal Luft machen mussten, bevor sie bereit waren, sich um eine energische Frau zu scharen.
Rogge schnitt eine Grimasse, blieb aber unwillkürlich stehen und hörte zu, nachdem sich ein Kreis um die Frau gebildet hatte. An die dreißig Kinder, zwölf, dreizehn Jahre alt, wie er schätzte, die meisten Jungen noch richtige Rüpelbolzen mit zu viel Kraft, einige Mädchen aber schon zurückhaltend, kleine gezierte Damen, die für solche Kindereien überhaupt kein Verständnis mehr besaßen. Ein Klassenausflug, Wandertag. Und die Frau mit den kurzen sandfarbenen Haaren und dem entschlossenen Kinn war die arme Lehrerin. Der Bus entfernte sich.
»So, jetzt schaut ihr alle mal runter ins Tal. Was seht ihr da?«
»Eine Straße.« - »Autos.« - »Luft.« Schrilles Lachen, ach Gott, was war man witzig.
»Richtig. Eine Straße. Und eine Straße, allerdings nicht so breit und glatt und asphaltiert, gab es hier schon vor über fünfhundert Jahren.«
Langsam schob sich Rogge näher heran und buchte ihr in Gedanken einen Pluspunkt gut. Laut anfangen, unmerklich leiser werden, der Lärm verstummte, alle mussten die Klappe halten und die Ohren spitzen, um sie verstehen zu können, den Trick lernten die Polizisten in der psychologischen Schulung beim Kapitel Umgang mit Demonstranten.
Schon damals herrschte auf der Straße viel Verkehr und hier oben auf der Burg saß der Beltensteiner, ein gefürchteter Raubritter, der immer wieder mit seinen Leuten den Berg hinunterstürmte und die Wagen überfiel, ausraubte oder von den Kutschern ein Wegegeld erpresste. Manchmal wehrten sich die Fuhrleute, es gab Tote, der Beltensteiner war nicht zimperlich und hinter den dicken Mauern trotzte er seinen Gegnern. Bis sich die Nürnberger und der Mainzer Erzbischof verständigten und mit einem richtigen Heer anrückten, um die Reichsacht an dem Beltensteiner zu vollstrecken.
Rogge grinste breit, an seine Schulzeit hatte er nicht die besten Erinnerungen, aber Geschichte von dieser Lehrerin gefiel ihm.
Sie warf ihm einen gereizten Blick zu, Rogge verbeugte sich knapp und sie fuhr fort. Fünf Minuten, dann brach sie ab: »So, den Rest erzähle ich euch oben auf der Burg.«
Prompt entwickelte sich ein mittleres Chaos. Dann bemerkte Rogge zwei Jungen, die sich strategisch geschickt in die Büsche abzusetzen versuchten,
»Vergesst es!«, rief er ihnen laut nach, schuldbewusst drehten sie die Köpfe zu ihm und er wies mit der Hand auf den Pfad: »Da geht’s rauf!«
Ihre Flüche las er nur von ihren Lippen ab und die wütenden Blicke ließen ihn kalt. Mit sich zufrieden kletterte Rogge den schmalen, steilen Weg hoch. Bei der nächsten Erklärung der Lehrerin mischte er sich schon unter die Schüler.
»Okay, in einer Viertelstunde geht’s weiter.« Die Bande stob wie ein aufgescheuchter Hühnerschwarm auseinander, Rogge fing wieder einen Blick auf und stellte sich vor: »Jens Rogge. Ich hoffe, ich störe Sie nicht.«
»Sibylle Wagner. Nein, Sie stören nicht, und wenn Sie sich nützlich machen wollen, dürfen Sie die Nachhut bilden.«
»Alles klar. Einige Herrschaften gieren nach einer Zigarette, wie ich vermute.«
Sie lachte, was sie ausgesprochen sympathisch wirken ließ: »Schlimmer noch. Ich kann nicht alle Saftflaschen und -behälter kontrollieren.«
Den Rest des Tages war Rogge als Aushilfswächter engagiert, sie stellte ihn den Kindern vor und damit war für seine Unterhaltung gesorgt. Die jungen Damen siezten ihn ausnahmslos, die meisten Jungen duzten ihn und nur in zwei Fällen hatte er das Gefühl, dass darin aggressive Verachtung mitschwang. Von der Burg liefen sie ins Tal hinunter. Rogge musste alle seine Kenntnisse zusammenklauben, um zu erklären, wie Holzkohle gebrannt wurde, und die Lehrerin machte den Kindern klar, welchen Wert in früheren Zeiten Holz besaß, als Baumaterial und für das Heizen im Winter. Rogge räusperte sich und erklärte, dass Fleisch teuer und selten war, dass aus Hunger regelmäßig gejagt wurde, aber nicht jeder einfach schießen durfte. Es gab Wald- und Jagdrechte, außerdem Fischrechte, und weil Wald so wertvoll war, durfte auch nicht jeder Bäume schlagen, wie er wollte. Bei seinem Vortrag zerkaute die Lehrerin ein Lächeln und fragte hinterher halblaut: »Sind Sie Jurist?«
»Nein, Polizist.«
»Hervorragend, dann weiß ich ja, wie ich meine Terroristen notfalls einschüchtern kann.«
In der Kochenbachmühle war für Rogge und die Lehrerin gedeckt und sie unterhielten sich wie alte Bekannte. Zwei Mädchen setzten sich zu ihnen und begannen, ihm ein Loch in den Bauch zu fragen. Nein, er war kein Lehrer. Ja, er hatte auch Kinder. Nein, die gingen nicht mehr zur Schule. Ja, er war schon Großvater. Nein, er machte Urlaub. Ja, er lief gerne. Nein, er kannte Frau Wagner nicht von früher. Ja, er würde gerne noch bei ihnen bleiben.