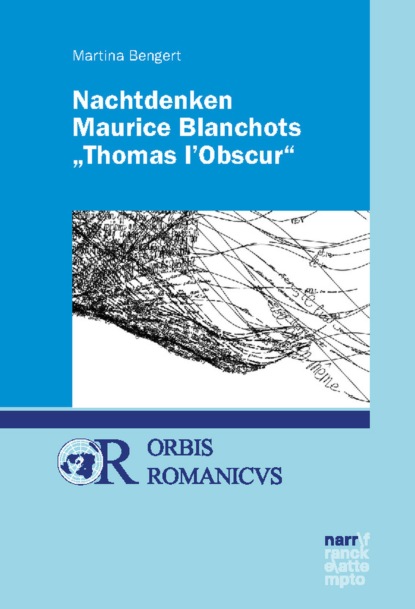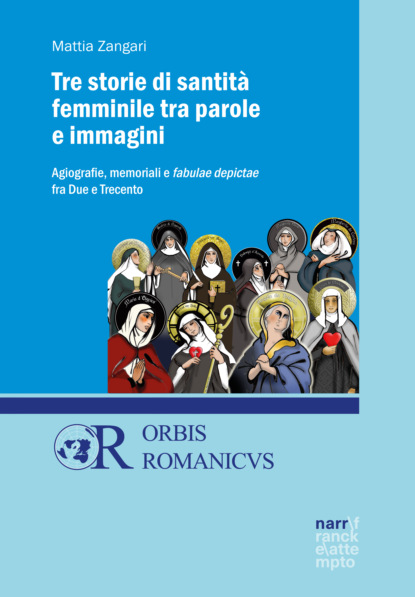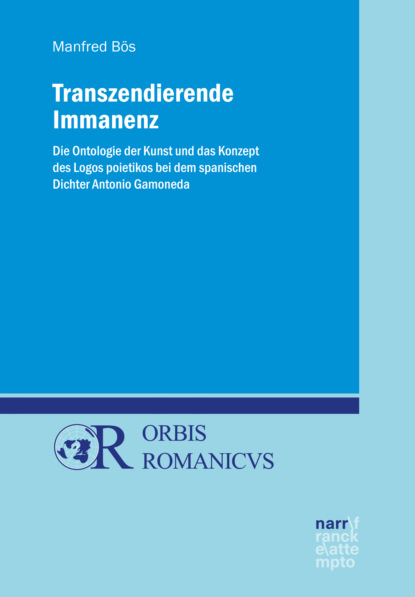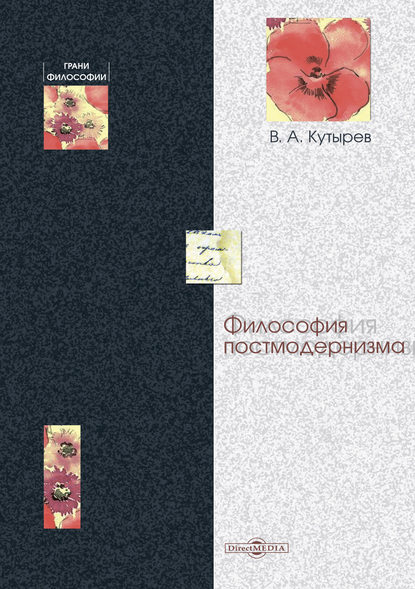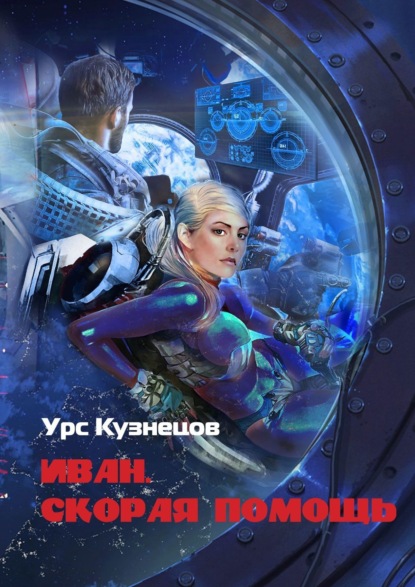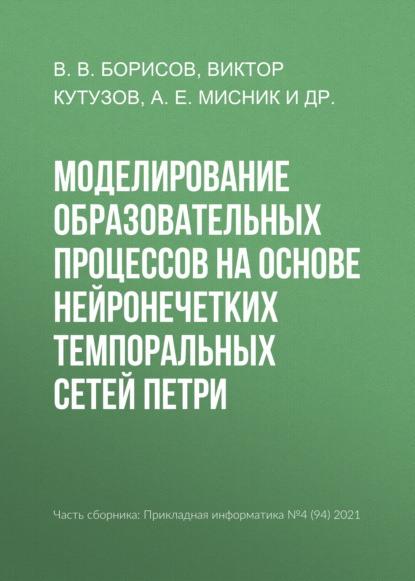- -
- 100%
- +

Martina Bengert
Nachtdenken
Maurice Blanchots
„Thomas l’Obscur“
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
[bad img format]
© 2017 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
www.francke.de • info@francke.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-8233-0039-7
[bad img format]
Für meine Mutter – Le pas au-delà
Mit dem 2008 erschienenen Buch Tiefer als der Tag gedacht – Eine Kulturgeschichte der Nacht der Anglistin Elisabeth Bronfen1 sowie dem 2011 publizierten Buch Die Ästhetik der Nacht – Eine Kulturgeschichte2 von Heinz-Gerhard Friese liegen zwei umfangreiche aktuelle Studien vor, die einen kenntnisreichen Einblick in zahlreiche Stationen der Nacht von der Antike bis in die Moderne geben.3 Obwohl Bronfen sich in ihren Nachtbetrachtungen stark auf die englischsprachige Literatur fokussiert, umfasst ihre Kulturgeschichte auch die Bereiche des Kinos (film noir) und der europäischen Malerei. Frieses Nachtwerk widmet sich auf der Basis von Hesiods Theogonie ausgiebig den Nachtkonzepten im alten Griechenland, um sich sodann dem „Nachtleib“ und seinen Inszenierungen, z.B. in Form von Monstern und dem Motiv des literarischen Nachtmahls, zuzuwenden.
Das vorliegende Buch ist keine weitere Kulturgeschichte der Nacht, sondern konzentriert sich im Gegensatz zu motivgeschichtlichen Nachtbüchern auf die philosophisch-literarische Denkfigur der anderen Nacht in Maurice Blanchots Thomas l’Obscur. Eine solche Konzentration entspricht dem, was Blanchot in der Verschränkung von philosophischem und literarischem Schreiben als Gegenentwurf zu einem Denken über die Nacht in Gestalt eines Denkens der Nacht entwickelt. Durch die Entfaltung dieses Nachtdenkens wird Blanchots Versuch, den Tod zu schreiben, in Form eines Textkommentars nachgezeichnet.
Dunkle Nacht
Kein anderer hat wohl wie der Mystiker Johannes vom Kreuz (1542–1591) den Topos der noche oscura in der spanischen, aber auch der europäischen Literatur geprägt. Ist in einem literarischen Werk von der dunklen Nacht die Rede, verweisen die Kommentatoren bis heute zumeist auf sein Bild der noche oscura.1 Die Rezeption seiner Schriften war unter den französischen Intellektuellen Mitte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet. Blanchot weist in seinem Briefwechsel mit Pierre Madaule darauf hin, dass er von den Gedichten des Heiligen Johannes vom Kreuz (San Juan de la Cruz im Spanischen) sogar eigene Übersetzungen angefertigt habe.2 Aber auch Jacques Lacan zählt zu den Lesern San Juans, wenn er in seinem séminaire die noche oscura eine nennt, „que tout le monde lit et personne ne comprend.“3 Dieses Nicht-Verstehen-Können begründet sich ganz wesentlich in San Juans Versuch, das Unsagbare zu umkreisen und damit in einen Raum der (mystischen) Erfahrung vorzudringen, der sich dem logischen Erkennen entzieht. Auf Basis einer solchen grundlegenden Unmöglichkeit des Begreifens wird sich meine Arbeit in die dunkle Nacht und mit dieser in die andere Nacht wagen.
Dabei gäbe es scheinbar einen einfacheren und geführten Zugang zum Dunklen: In Dante Alighieris Divina Commedia findet sich der Ich-Erzähler zu Beginn des 1. Gesangs inmitten eines dunklen Waldes (selva oscura) wieder.4 Diese Metapher wurde meist als Beschreibung eines Krisenzustandes geistiger und intellektueller Dunkelheit und Orientierungslosigkeit interpretiert. Der Protagonist steht am Anfang eines Läuterungsweges, der ihn durch die verschiedenen Kreise der Hölle, des Fegefeuers bis hin ins Empyreum führen wird.
Anders als bei Dante, doch auch mit einem Läuterungsweg verbunden, verhält es sich mit der Thematik der noche oscura des heiligen Johannes vom Kreuz. In dem gleichnamigen Gedicht, vor allem in den von Johannes vom Kreuz selbst verfassten Prosakommentaren,5 ist der Weg eine Flucht, die in Überschreitung etlicher literarischer wie gesellschaftlicher Konventionen von einem weiblichen, sehnsuchtsvoll liebenden Subjekt ausgeführt wird. Die selva oscura wird ersetzt durch eine noche oscura, welche gleich mehrmals (im Sinne einer Umnachtung der Sinne und des Geistes) durchschritten werden muss, um zur Vereinigung mit dem Geliebten zu finden. Bemerkenswert vor dem Hintergrund der abendländischen Theologie und Philosophie ist die Anerkennung der Nacht als Erkenntnisgrund bzw. Erkenntnismöglichkeit, die sich gerade aus ihrem Negations- und Subversionscharakter ergibt. Aus diesem Grund scheint es angebracht, mit Bezug auf die noche oscura von einer „Nachterfahrung sui generis“ zu sprechen.6 Wie schon beispielsweise Teresa de Ávila oder Fray Luis de León vor ihm, stellt Johannes vom Kreuz den Weg hin zu Gott und die Vereinigung mit Gott als einen Stufenweg dar, der von jedem Menschen allein bewältigt werden muss und der vor allem aus einem schmerzhaften Entwerden des Ichs besteht. Doch deutlicher als bei allen anderen vor ihm und nach ihm steht die Nacht explizit im Zentrum dieses Weges.7
Das Gedicht „Noche oscura“, 1577 während einer neunmonatigen Kerkerhaft in Toledo verfasst, ist die Beschreibung eines Hinaustretens der Gott suchenden Seele in vollkommene Dunkelheit, Unwissenheit und Verlorenheit. Es schildert die Überwindung einer ersten, ‚gewöhnlichen‘ Nacht, die Johannes vom Kreuz in der Subida del Monte Carmelo, einem Prosakommentar zum Gedicht, als Finsternis identifiziert, in der die weltlichen Dingen verhaftete menschliche Seele lebt.
Das Durchleben der zweiten Nacht hingegen, der dunklen Nacht, bildet eine weitaus extremere Nachterfahrung der Seele, die einem Gefühl der vollkommenen Geworfenheit und Einsamkeit entspricht. Sie ist nicht als romantisch zu verstehen, d.h. nicht als erstrebter Einsamkeitszustand, der Erhabenes verspricht, sondern als (dreifache) absolute Negation der Sinne und des Geistes, die in ihrer Gewaltigkeit und Präsenz den erlebenden Menschen mit Angst erfüllt. Das weitere Durchschreiten dieser Negation bis zu ihrem Höhepunkt in der absoluten Leere, führt in ein Oxymoron: zur Erfahrung von Präsenz Gottes gerade in der absoluten Abwesenheit.
Als eine mögliche Spur einer unbeschreiblichen göttlichen Präsenz könnte die unerklärte plötzliche Wunde der Sprecherin des Gedichts betrachtet werden, die ihr paradoxerweise ein Windhauch zufügt und all ihre Sinne suspendiert.8 In der Kulmination des Gedichts klafft sie unvermittelt am Hals des lyrischen Ichs und manifestiert sich als Spur eines Geschehens, das selbst nicht dargestellt wird. Der Text zeigt hierin möglicherweise – in Anlehnung an Paul de Mans Auslegung der Allegorie als ein selbstreferentielles Zeichen, das auf das Scheitern jeglicher sprachlicher Ausdrucksform verweist – seine eigene Verletzlichkeit, nämlich die der Uneinholbarkeit des Sinns durch die (Nachträglichkeit und Begrenztheit der) Sprache.
Johannes vom Kreuz hat als erster spanischer Schriftsteller und Philosoph den grundlegend allegorischen Charakter der Nacht (und der Schrift) quasi als Vordenker der (Post)moderne literarisch umgesetzt, indem er in der Rede seines Gedichtes „Noche oscura“ durch mystisches Sprachspiel, wie auch in Korrelation mit dem Textkommentar, mannigfaltige Allegorien auf eine unsichtbare und unbegreifliche Nacht kreiert. Die dunkle Nacht des Johannes vom Kreuz scheint in Martin Heideggers Begriff des Existenzials wiederzukehren. Er beschreibt die Erfahrung des In-der-Welt-Seins als eine Erfahrung des „Hineingehaltenseins der Existenz in die Nacht“,9 die, so meine These, in der französischen Rezeption Heideggers und ganz besonders in Blanchots Thomas l’Obscur umgedeutet wird in ein Hinausgehaltensein der Existenz in die Nacht. In der Betonung der Nacht als gänzlich andere, jenseits einer möglichen Innerlichkeit und oppositionellen Beziehung zum Tag, denkt Maurice Blanchot die andere Nacht.
Die andere Nacht
Wie eingangs erwähnt, kannte Blanchot die Texte des Heiligen Johannes vom Kreuz. Die Tatsache, dass er San Juans Gedichte sogar selbst übersetzte, lässt sich nicht nur als Nachweis seiner profunden Textkenntnisse lesen, sondern als Zeichen größter Anerkennung:
Aminadab m’a été donné par saint Jean de la Croix que j’ai beaucoup lu jadis, traduisant même ses admirables poèmes. Aminadab est comme le gardien de l’énigme de la ‚Nuit obscure‘. J’en dirais plus, si les écrits de St Jean étaient ici pour réveiller ma mémoire. Mais tous mes livres sont dispersés comme mes textes du reste.1
Der Verweis auf Aminadab zu Beginn des oben zitierten Briefausschnitts deutet in zwei Richtungen, zum einen auf Blanchots 1942 veröffentlichten Roman Aminadab, zum anderen auf die Herkunft dieses Titels als Effekt der Lektüren mystischer Texte San Juans – Aminadab tritt als Figur in der letzten Strophe des Cántico espiritual auf. Wer er ist und ob er überhaupt eine wesenhafte Erscheinung bezeichnet, ist nicht mit Eindeutigkeit festzumachen. Wie Bernhard Teuber in seiner Auslegung des Lexems ‚Aminadab‘ zeigt, bewegen sich die Deutungsmöglichkeiten vom „Wagenlenker“ der Braut des biblischen Hohelieds, über „Satan“ und „Christus“ bis hin zu Zergliederung der Signifikanten in „a mí nada“2. Wenn Blanchot in seinem Brief an Pierre Madaule schreibt, dass Aminadab ihm von San Juan de la Cruz „gegeben“ wurde, dessen Werk er darüber hinaus aufgrund eigener Übersetzungen der – von Blanchot mit dem Adjektiv „admirables“ bewerteten – Gedichte bestens zu kennen betont, dann verdeutlicht er damit auch, dass er sich der Vielschichtigkeit dieses Namens und seiner Einbettung in eine besondere Form der christlichen Mystik bewusst ist. Dabei handelt es sich um eine Mystik, die sich sehr affirmativ der Nacht zuwendet und sie insbesondere im Gedicht „Noche oscura“ – von Blanchot in der französischen Form „Nuit obscure“ erwähnt – als Erkenntnisgrund setzt. In Aminadab sieht Blanchot den Türhüter dieser „Dunklen Nacht“ des Heiligen Johannes vom Kreuz, wobei auch an dieser Stelle die Trennung zwischen Blanchots Aminadab und der im Cántico espiritual vorkommenden Lautkette ‚Aminadab‘ nicht streng vollzogen, ja vielmehr gerade als Dopplung und Ambiguität sehr deutlich offen gelassen wird. Blanchots Verweis auf seine intensive Auseinandersetzung mit San Juan ist zudem zu entnehmen, dass sie in der Vergangenheit liegt. Da der Brief zeitlich entweder dem 30.12.1985 (Blanchots eigene Datierung auf dem Brief) oder dem 30.12.1989 (Poststempel) zuzuordnen ist3 und der Roman Aminadab 1942 ein Jahr nach der Erstfassung von Thomas l’Obscur erschien, lässt sich folgern, dass Blanchot sich schon in den Jahren vor 1942 intensiv mit der Denkfigur der noche oscura beschäftigt hat und seine denkerische Leidenschaft für die Nacht in Thomas l’Obscur, ebenso wie in Aminadab und insbesondere den frühen literaturkritischen Essays ihren Ausgang von der frühneuzeitlichen spanischen Mystik nimmt. Blanchots Denken bekennt sich zur Nacht, nicht jedoch zu Gott. In der dunklen, gottlosen Nacht aber, aus der es kein Entkommen gibt, die fasziniert ohne zu bergen, findet Blanchot eine Denkfigur, die sein Werk bis in die späten Texte durchzieht.
Denn der Tag ist für Blanchot verbunden mit Ordnung, Licht und Rationalität, mit gesetzten Aussagen und allzu festen Strukturen, wohingegen die Literatur, und insbesondere die Dichtung, ihren Ort in der Nacht als Raum des Unkontrollierbaren und Kreativen hat. Der Tag bricht an, die Nacht bricht ein. Jedoch läuft die Nacht Gefahr, gebändigt und als dichotomisches Gegenstück des Tages gedacht zu werden: sei es als ein Zustand der zu überwindenden Orientierungslosigkeit, Passivität oder Ausgesetztheit, sei es als romantischer Zufluchtsort des nach Verschmelzung mit sich und dem Universum strebenden Ichs. Eine weitere Möglichkeit der Abschwächung besteht darin, die Nacht mit Gespenstern, Monstern, Gewalt und Verdammnis zu bevölkern und dadurch ihre Leere anhand von abschreckenden Gestalten zu überdecken.
All diese Aspekte versucht Blanchot zu überschreiten, indem er die Nacht, die er auch als première nuit, als erste Nacht, bezeichnet, von einer radikaleren und absoluteren Nacht, der ‚autre‘ nuit, abgrenzt. Die andere Nacht Blanchots bezeichnet damit explizit nicht, wie etwa bei Gérard Genette4, das Andere des Tages, sondern vielmehr das Andere der Nacht.5 Die ‚autre‘ nuit ist folglich als eine Nacht aufzufassen, die keine Opposition im Sinne einer Dialektik zulässt und somit als radikales Außen und radikales Anderes (der Schrift oder auch des Erkennens), das kein Innen determiniert, zu verstehen ist.
Nur das Tagesdenken maßt sich an, die andere Nacht, die man sich gerade nicht aneignen kann, vereinnahmen zu wollen. Das Nachtdenken hingegen weiß um dieses Unbegreifliche und Uneinholbare der anderen Nacht.
Quand on oppose la nuit et le jour et les mouvements qui s’accomplissent, c’est encore à la nuit du jour qu’il est fait allusion, cette nuit qui est sa nuit […]. Mais l’autre nuit est toujours autre. C’est dans le jour seulement qu’on croit l’entendre, la saisir. […] Mais, dans la nuit, elle est ce avec quoi l’on ne s’unit pas, la répétition qui n’en finit pas […] la scintillation de ce qui est sans fondement et sans profondeur.6
In L’espace littéraire benennt Blanchot das, was jede Bewegung überschreitet bzw. fundiert, mit der ‚autre‘ nuit. Er setzt das ‚autre‘ durchgängig kursiv und verweist derart von der Ebene der Signifikanten auf eine Metaebene, die die andere Nacht als infinite Verschiebung ausmacht.7 Die andere Nacht ist immer anders als alles, was bezeichnet werden kann, und referiert als Aufflackern des Ungrunds auf ein sich stets entziehendes und verschiebendes A/anderes.
Diese radikale Negativität und Alterität rückt Blanchots Konzeption der anderen Nacht in deutliche Nähe zu jenen Formen der Annäherung an Gott, wie sie in der Tradition der negativen Theologie seit Proklos’ Deutung der ersten Hypothese des platonischen Parmenides, über den dreistufigen Weg der Negation des Dionysius Areopagita und insbesondere seit Nikolaus von Kues bekannt sind.8 San Juans noche oscura und vor allem die von ihm in ihrer gesteigerten Nächtlichkeit noch einmal gegen die „Nacht der Sinne“ abgegrenzte „Nacht des Geistes“ steht nicht nur in dieser Tradition, sondern scheint mir auch den zentralen Nexus zu Blanchots ‚autre‘ nuit herzustellen:
Es [der zweite, tiefere Teil des Glaubens bzw. der Nacht bzw. das dritte Durchschreiten der Nacht; Anm. der Verfasserin] también más oscura que la primera, porque ésta pertenece a la parte inferior del hombre, que es la sensitiva y, por consiguiente, más exterior; y esta segunda de la fe pertence a la parte superior del hombre, que es la racional, y por el consiguiente, más interior y más oscura […]. Y así, es bien comparada a la media noche, que es lo más adentro y más oscuro de la noche.
Pues esta segunda parte de la fe habemos ahora de probar cómo es noche para el espíritu, así como la primera lo es para el sentido.9
Die zweite Nacht ist dunkler und verstörender als die erste. Von ihr wird wesentlich das weiter innen und damit im Dunkleren liegende Denken des Menschen erfasst. Sofern sie als Nacht der Nacht verstanden wird und damit die Dunkelheit als Abwesenheit des Lichts verdoppelt, bezeichnet die noche oscura jene existenzielle Entzogenheit und Differenz, die im 20. Jahrhundert in der ‚autre‘ nuit unter anderen Vorzeichen wiederkehrt. Die andere Nacht ist das radikal A/andere, das für einen die Innerlichkeit invadierenden Prozess steht. Statt einer Letztbegründungsebene setzt Blanchot die Denkfigur der ‚autre‘ nuit, die weniger Gott, als dem Tod zugewandt ist. Während der Gang durch die dunkle Nacht ein notwendiger Prozess des Ich-Sterbens hin zu Gott ist, wird die andere Nacht Blanchots zur Fährte, den Tod zu schreiben, zu lesen und als Grenze auswegslos zu erfahren.
Nachtdenken
Wo bist du, Nachdenkliches! das immer muß
Zur Seite gehn, zu Zeiten, wo bist du, Licht?
Wohl ist das Herz wach, doch mir zürnt, mich
Hemmt die erstaunende Nacht nun immer. 1
Friedrich Hölderlin
Das Nachtdenken ist ein Nachdenken über die Nacht, ein Die-Nacht-Denken und Denken der Nacht. Letzteres sucht in der Nacht eine eigene Form der Logik, die anders funktioniert als die binäre Logik und bis zu einem gewissen Grad mit der Traumlogik vergleichbar ist. Nachtdenken heißt die Welt zerdenken. Das Nachtdenken Blanchots ist ein Denken, das die andere Nacht als Unvordenkliches umkreist und ihrer Differenz zur (ersten) Nacht Rechnung trägt. Nachtdenken ist ein Denken, das vom Tod herrührt und zum Tod führt. So wie die ‚autre‘ nuit Tag und Nacht bedingt, bedingt der Tod das Leben als dessen einzige Sicherheit.
Man darf jenseits jeglicher Religiosität davon ausgehen, dass das Leben mit Sicherheit in den Tod mündet. Der Weg vom Tod ins Leben oder in einen anderen Zustand obliegt dagegen nicht mehr der rationalen Erkenntnis, sondern ist Sache des Glaubens. Blanchots Verschränkung der ‚autre‘ nuit mit dem Tod ist die Verschränkung einer absoluten Unbegreifbarkeit mit einer gewissen Erfahrbarkeit. Beide können aus Sicht der Lebenden nicht unmittelbar, sondern nur über hinterlassene Spuren erfahren werden. Eine solche Spur ist beispielsweise der Tod anderer Menschen, der Affekte wie Schmerz, Verlorenheit, Leere und Trauer bei den Angehörigen verursacht. Man kann der anderen Nacht im Sinne einer Nachträglichkeit immer nur nachdenken. Wenn Blanchot über Rilke sagt: „Lorsque Rilke médite sur le suicide du jeune comte Wolf Kalckreuth, méditation qui prend la forme d’un poème […]“, dann ist Blanchots Nach(t)denken eines, das in Thomas l’Obscur seine literarisch-philosophische Form sucht.2 Ein zentraler Aspekt dieser Form ist die Perspektivlosigkeit bzw. Überperspektiviertheit, welche Emmanuel Levinas als Effekt der Erfahrung des nächtlichen Raumes bezeichnet:
[L]es points de l’espace nocturne ne se réfèrent pas les uns aux autres, comme dans l’espace éclairé; il n’y a pas de perspective, ils ne sont pas situés. C’est un grouillement de points. […] L’absence de perspective n’est pas purement négative. Elle devient insécurité. […] L’insécurité ne vient pas des choses du monde diurne que la nuit recèle, elle tient précisément au fait que rien n’approche, que rien ne vient, que rien ne menace; ce silence, cette tranquillité, ce néant de sensations constituent une sourde menace indéterminée, absolument.3
Das Nachtdenken in Thomas l’Obscur versucht nicht, dieses „Punktegewimmel“ zu bändigen, sondern es als widersprüchliches Kraftfeld zu erschreiben und die Verunsicherung auf allen Ebenen der Sprache gegenwärtig werden zu lassen. In der Folge soll nachgezeichnet werden, wie die Dynamik der Sprache in Thomas l’Obscur in ein Nachtdenken mündet. Die Schärfung der Konturen seines Nachtdenkens soll über unterschiedliche Ähnlichkeitsbeziehungen zu anderen Formen der Annäherung an Undenkbares – oder zumindest schwer Denkbares – geschehen.
A. 2 Vorgehen, Methode, Forschungsziel
Eine Studie zu Blanchot, insbesondere aber eine über Thomas l’Obscur, wird sich aufgrund der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes immer auf der Grenze zur Unverständlichkeit bewegen müssen. Dabei selbst ins Unverständliche abzugleiten, stellt keine geringe Problematik dar. Der Anspruch des vorliegenden Buches liegt nicht zuletzt darin, sich dem Unverständlichen über eine Dynamik von Verständlichem und Komplexem zu nähern, die das Nachtpotential von Blanchots Text(en) in seinen Paradoxien und logischen Abgründen zumindest in einigen Facetten nachvollziehbar wiederzugeben vermag. Die Grenze zwischen Komplexem und Unverständlichem ist dünn und die zwischen Verständlichem und Unverständlichem ebenso. Vielleicht könnte man dieses Verhältnis sogar so denken, dass die Komplexität eine Grenze zwischen Verständlichem und Unverständlichem bildet. Verständliches ist in Thomas l’Obscur eine Rarität, auch weil es immer eine Reduktion bedeutet: vom Virtuellen des Unverständlichen in die Aktualisierung des Verständlichen, des Realisierten, des Ausgesagten. In anderen Worten formuliert, ist die Verständlichmachung des Unverständlichen eine Reduktion des Nachtdenkens auf ein Tagdenken. Dieses Nachtdenken nachzuzeichnen, ohne von ihm schreibend gänzlich ergriffen zu werden, aber auch ohne der analytischen Ordnung des Tages zu verfallen, wird bedeuten, immer an der Grenze zwischen den beiden Logiken zu arbeiten. Der Leser dieser Arbeit wird selbst entscheiden müssen, wo sich meine Ausführungen über das Nachtdenken bewegen. Im Idealfall sind sie in regelmäßigen Abständen klare und pointierte Gedanken zu bisweilen doch recht anspruchsvollen theoretischen und literarischen Figurationen, wie z.B. der Höhle, des Abgrunds, der Wiederkehr vom Tod oder der Nacht. Meine Studie stellt dabei keine Motivgeschichte der Nacht dar, sondern vielmehr eine Lektüre von Thomas l’Obscur, die unter dem Stern der Nacht steht. Dies bewirkt unter anderem, dass in manchen Kapiteln Textstellen analysiert werden, in denen es vordergründig gar nicht um die Nacht geht, wohl aber um ihre Spuren und Konsequenzen.
Mit dem Nachtdenken sollen Prozesse und Bewegungen des Textes umfasst werden, die dem Begreifen stets vorhalten, dass die erkannte Bedeutung oder der gefolgerte Zusammenhang nur relativ ist und immer eine metonymische, metaphorische, analogische (die Reihe könnte um einige weitere Adjektive angereichert werden) Dimension dahinter liegt, die den Wahrheitsgehalt des Gelesenen ins Wanken bringt.
Wenn Literaturwissenschaft bedeutet – wie ich schon in meinen romanistischen Studienjahren gelernt habe – nicht nur festzustellen, dass ein Text bestimmte Effekte beim Leser erzeugt, sondern nach den Operationen des Textes zu forschen, die diese Effekte hervorbringen, so soll die vorliegende Arbeit über die Hinzunahme verschiedener philosophischer, psychoanalytischer und kultursemiotischer Konzepte genau eine solche Lektüre versuchen.
Meinen Textzugang kann man als philologisch-philosophischen Ansatz bezeichnen, der unter dem Zeichen eines Close Readings steht und strukturell die Form eines Textkommentars hat. Er ist eine Verbindung von Philologie und Philosophie, die der Tatsache Rechnung trägt, dass die Trennung zwischen philosophischem Denken und literarischem Schreiben bei Blanchot nicht leichtfertig zu machen ist. Beide sind über eine Erfahrung der Sprache verbunden, die Jacques Derrida wie folgt beschreibt: „Faire l’expérience, c’est avancer en naviguant, marcher en traversant. Et en traversant par conséquent une limite ou une frontière. L’expérience de la langue devrait être une expérience comme à la poésie et à la philosophie, à la littérature et à la philosophie.“1 Derridas Wunsch, Philosophie und Literatur zu vereinen, ist in Thomas l’Obscur realisiert über eine Erfahrung der Sprache, die eine Erfahrung der anderen Nacht darstellt.
Sofern es mir weniger um Blanchot-Exegese, als vielmehr um den Versuch geht, Blanchots mikropoetischer Sprache in Thomas l’Obscur zu folgen, rücke ich meine Methodik ganz bewusst in eine dekonstruktive Praxis des Kommentars als eine Praxis des Ränder-Vollschreibens. Hans Ulrich Gumbrecht, der in seinem 2003 ins Deutsche übersetzten Werk Die Macht der Philologie die Dekonstruktion als „philosophische Verkörperung des textuellen Prinzips des Kommentars“2 bezeichnet, betont dort auch: