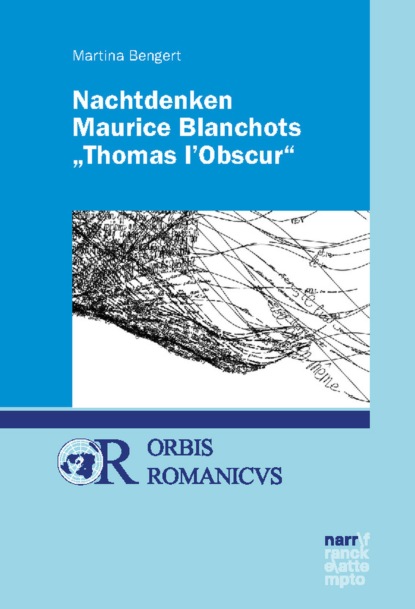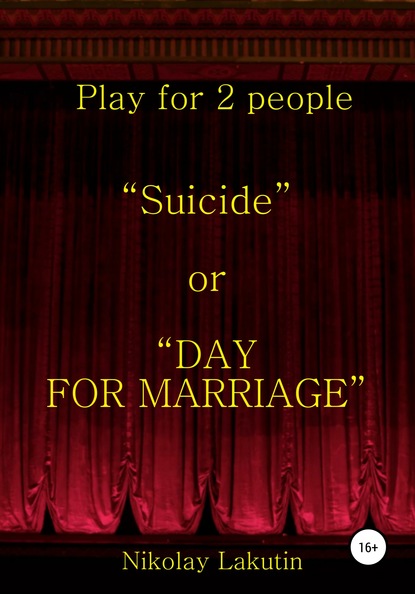- -
- 100%
- +
Der Eintritt ins Offene zeigt sich unter anderem an der veränderten Blicksituation: Während Thomas am Ufer seinen Blick trotz des Nebels auf die Schwimmer im Wasser richten kann, verdeckt der Nebel von der anderen Seite aus betrachtet das begrenzende Ufer und Thomas’ Blicke (ses regards), nun im Plural, finden keine Haftung mehr.
La brume cachait le rivage. […] La certitude que l’eau manquait, imposait même à son effort pour nager le caractère d’un exercice frivole dont il ne retirait que du découragement. Peut-être lui eût-il suffi de se maîtriser pour chasser de telles pensées, mais ses regards ne pouvant s’accrocher à rien, il lui semblait qu’il contemplait le vide dans l’intention d’y trouver quelque secours.4
An dieser Stelle wird anhand des fehlenden Wassers, in dem Thomas schwimmt, das inhaltlich fixierbare äußere Geschehen endgültig überführt in ein Wahr-nehmungsgeschehen, das zwar noch in einem subjektgebundenen Bewusstsein verankerbar scheint, in dem sich jedoch bereits erste Risse andeuten. Die Selbstbeherrschung oder die Subjektsouveränität ist durch die fehlende äußere Blickbegrenzung destabilisiert.
Im Folgenden häuft sich die Isotopie der Bewegung und Dissoziation, die durch ein Deiktikum als unmittelbare Erfahrung präsentiert wird. War das Wasser eben noch abwesend, zeigt es sich nun aus dieser Abwesenheit umso bedrohlicher: „C’est alors que la mer, soulevée par le vent, se déchaîna. La tempête la troublait, la dispersait dans des régions inaccessibles, les rafales bouleversaient le ciel et, en même temps, il y avait un silence et un calme qui laissent penser que tout déjà était détruit.“5
Dagegen stehen gleichzeitig das Schweigen und die Ruhe, welche jedoch keinen beruhigenden Gegenpol bilden, sondern eher die gefährliche Ahnung des Ursprungs der tosenden Bewegung ankündigen. Im weiteren Textverlauf wird Thomas’ Kampf mit dem Wasser geschildert, das in ihn eindringt und den Prozess des Selbstverlustes und Selbstentfremdung vorantreibt. Mit zunehmender Kälte scheint er das Gefühl für seine Körperglieder und seine orientierenden Sinneswahrnehmungen zu verlieren, sodass mit der steigenden Gewalt und Fremdheit des Wassers sich die Grenze zwischen innerer oder gedanklicher Bewegung und äußerem Kampf gegen das Ertrinken zu verwischen beginnt. Somatisches und Gedachtes gehen reziprok und unkontrollierbar ineinander über. Die Grenze zwischen Thomas und dem Meer, zwischen Subjekt und Objekt, scheint auf der Basis eines traumähnlichen Zustandes zur Vereinigung mit dem Meer zu führen: „Il poursuivait, en nageant, une sorte de rêverie dans laquelle il se confondait avec la mer. L’ivresse de sortir de soi, de glisser dans le vide, de se disperser dans la pensée de l’eau, lui faisait oublier tout malaise.“6
Dieses Sich-Vermengen mit dem Meer ist sprachlich ebenfalls performativ artikuliert über eine Verunklarung der Bezüge von innen und außen, in denen sich die inhaltlich ausgedrückte Auflösungsmetaphorik wiederholt. Denn „se disperser dans la pensée de l’eau“ lässt das vom Subjektstandpunkt ausgehende Denken an das Wasser zu einem Denken des Wassers werden – einem Denken, das vom Wasser ausgeht und auf das Thomas sich in einer stetigen Transformation einlässt. Es ist nicht mehr eindeutig zu entscheiden, wer aktiv oder wer passiv handelt, von wem überhaupt eine Handlung ihren Ausgang nimmt.7 Darüber hinaus scheint in der „pensée de l’eau“ das Verhältnis von Medium und Ausgesagtem ineinander zu kippen. Der Wunsch nach Ekstase ist in der zitierten Textstelle gekoppelt an ein Gleiten in die Leere und schließt in der Wiederholung des „glisser“ an die Anfangsbewegung des Gleitens vom Ufer ins Wasser an. Die Bewegung der Transgression wird erneut vollzogen: nun als eine intensivierte Selbstaufgabe oder auch Hingabe an das weibliche Wasserelement, in das Thomas sich zerstreuen will. Konsequenz seiner Hingabe ist eine sich immer weiter beschleunigende Oszillation des discours zwischen den Kategorien ‚Realität‘ und ‚Vorstellung‘, sodass er in einem Satz erst zunehmend zum „mer idéale“ wird, welches wiederum abermals von der Idealität zurückkippt ins Materielle bzw. „vraie mer“, das ihn wie einen leblosen Körper in sich trägt.8 Dargestellte Realität und Vorstellung sind nicht mehr zu unterscheiden. Sie erweisen sich in ihrer gegenseitigen Durchdringung als unbrauchbare Kategorien – nicht nur für Thomas, sondern auch für den Leser von Thomas l’Obscur. Sofern Thomas glaubt, in der Unentscheidbarkeit von innerer Vorstellung und äußerer Realität einen „Schlüssel der Situation“ gefunden zu haben und daraus die Erkenntnis einer doppelten Abwesenheit abzuleiten gedenkt, muss er diese samt des Schlüssels als Illusion analog zum Leser in die Tiefe der dunklen Meeresgrundes fallen lassen.9
Alle Fragen nach einem Ausweg aus der Situation scheitern an Thomas’ unbestimmten Willen fortzuschreiten und weiter in die Tiefe zu dringen. Starobinski interpretiert dies als „refus qu’oppose Blanchot à toute tentation de trouver l’apaisement dans une rêverie participante, dans une fusion sensible ou spirituelle où l’homme ne ferait plus qu’un avec la réalité environnante, qu’elle soit plénitude d’être ou vide, présence ou nullité universelles.“10 Er verbindet diese Gedanken einer unmöglichen dauerhaften Vereinigung mit allgemeinen Gedanken zu Blanchots kritischem Werk, das dazu einlädt, denkerisch stets einen Schritt über das Mögliche hinauszugehen. Ich möchte dem lediglich hinzufügen, dass sich dies mit den Vorstellungen Batailles zur inneren Erfahrung als unabschließbare Transgression deckt, und dass diese den Leser mit einschließt.
Unter dem Mikroskop
In den Text wird nun in Form einer mikroskopischen Vergrößerung eine neue Perspektive eingeführt, so als ob es nicht schon komplex genug wäre, den ständigen Metamorphosen zu folgen. Als weiteres Bild für die fortschreitende Ent-Selbstung oder Ent-Menschlichung verwandelt sich Thomas in ein Ungeheuer. Unter dem anonymen Blick durch ein „microscope géant“ stellt er sich als „amas entreprenant de cils et de vibrations“ dar.1 Die Fokussierung durch das riesige Mikroskop bedingt oder bezeugt seine monströse Entfremdung.
Es folgt die dritte Bewegung des „glisser“ weiter in die Tiefe, an eine Art heiligen Ort, der als solcher das religiös semantisierte Ziel der Initiation markiert. Während das erste Gleiten sich vom Ufer ins Meer vollzog und das zweite Gleiten in die Leere führte, ereignet sich das dritte als eines durch den mikroskopischen Blickwinkel „vom Wassertropfen weg“ an einen Ort der Indifferenz.
[L]orsque de la goutte d’eau il chercha à se glisser dans une région vague et pourtant infiniment précise, quelque chose comme un lieu sacré, à lui-même si bien approprié qu’il lui suffisait d’être là, pour être; c’était comme un creux imaginaire où il s’enfonçait parce qu’avant qu’il y fût, son empreinte y était déjà marquée. […] il se confondait avec soi en s’installant dans ce lieu où nul autre ne pouvait pénétrer.2
Dieser Ort lässt sich nur über Paradoxien und vergleichende Annäherungen in Worte umkreisen, ohne dabei erfasst werden zu können. Als „creux imaginaire“ wiederholt er das „centre imaginaire“ des Paratextes als a-zentrisches Zentrum. Die Selbstfindung ist nur qua zerfasertes und depersonalisiertes Materialgemisch möglich und verschließt sich als exklusiver Raum dem Nachvollzug einer Außeninstanz. Dieser markiert einen Endpunkt des Kampfes und der Suche und bildet eine Region der Begegnung von Thomas mit sich selbst am äußersten Punkt der Selbstentfremdung. Doch auch wenn an diesem Ort nicht verweilt werden kann, markiert er als Zone der Grenzerfahrung eine Grenze, sofern es im Text am Ende der Passage heißt: „Finalement il dût revenir.“ Thomas ist an einer inneren wie äußeren Grenze angekommen, jedoch nicht am Ende. Seine Ankunft wird vielmehr den Beginn der nächsten Wiederholung des Ähnlichen als Ausdruck der Entfremdung bilden, wie ich es nach meinen Überlegungen zum 1. Kapitel in den weiteren Kapiteln herauszuarbeiten gedenke.
Rückkehr (hinter dem Mikroskop)
Mit Blick auf den Begriff der Initiation kann man von einer immanenten Transzendenzerfahrung sprechen.1 Denn Thomas überschreitet oder übersteigt sich zwar im Medium des Meeres, doch durch die reziproke Durchdringung seiner selbst und des Wassers, ebenso wie von Vorstellung und Materialität, ereignet sich die Überschreitung als Immersion sowohl in ihn hinein als auch aus ihm heraus. Er überschreitet sich und es überschreitet ihn, so dass die Erfahrung der Transzendenz zur Erfahrung der Alterität in Form einer, ich zitiere erneut Gerhard Poppenberg, „immanenten Transgression“ wird.2 Der so erreichte ‚Einheitszustand‘ ist folglich keine Begegnung mit der göttlichen Fülle, sondern mit einer anonymen Leere jenseits der Bedeutung. Nicht weiter überschreitbar, kann aus ihm nur zurückkehrt werden. Dies tut Thomas, gerade noch im Todeskampf, scheinbar mühelos und gelangt zurück ans Ufer. Seine Rückkehr führt ihn indessen nicht an den Ausgangsort seines Gleitens ins Wasser. Während der Eintritt in die Initiationserfahrung ein transgressiver Akt des Gleitens war, wird der Austritt nicht beschrieben. Er wird lediglich rückblickend als notwendige Tatsache konstatiert, als wäre er qua Erfahrung der Erinnerung entzogen.
Thomas’ Grenzerfahrung hat Spuren in seinem Hören (nämlich Summen), vor allem aber in seinem Blick hinterlassen: Die Augen brennen, seine Sicht ist vernebelt, die Fähigkeit, Dinge voneinander zu unterscheiden ist unsicher geworden. Der zu Beginn des Kapitels auf dem Wasser gewesene Nebel ist nun in seiner Sicht, ist als Erfahrung Teil von ihm. In der Folge kann der Nebel erkenntnistheoretisch nicht mehr exkludiert werden: Thomas’ Sicht auf die Welt hat sich verändert: „À force d’épier, il découvrit un homme qui nageait très loin […]“.3 Dass er diesen Mann sieht, ist direkt bedingt durch seine Wahrnehmung. Thomas verfolgt den Schwimmer mit seinem Blick, an all seinen Zuständen teilhabend. Der Blick als Berührung auf Distanz ermöglicht ihm eine Nähe, die „n’aurait pu l’être davantage par aucun autre contact“.4
Ich folge hier mit meinen Überlegungen weiter der Interpretation Jean Starobinskis, der Thomas am Ende des Kapitels perspektivisch nun auf der anderen Seite des „microscope géant“ verortet.5 So gesehen betrachtet er sich selbst im Meer schwimmend und ist folglich Beobachter wie Beobachteter. Das Bild des Doppelgängers stellt sich ein, zumal diese Verdopplungsstruktur nur eine von vielen ist, die in den weiteren Kapiteln folgen werden. Der Doppelgänger, der Übergang vom Ich zum Er, hier sogar vom Er zum Er, kennzeichnet bei Blanchot auch immer den Vorgang des Schreibens. Diesbezüglich bemerkt Gerhard Poppenberg:
Das Schreiben als Übergang vom Ich zum Er ist ein Grenzgang, ein Gang aber nicht so sehr an die Grenze und auch nicht ganz über sie hinaus, sondern ein Gang an der Grenze, deren Artikulation die Bewegung zwischen Ich und Er ist, den Gestalten des Innen und Außen. […] Der Übergang vom Ich zum Er ist zunächst Bruch mit dem Ich, Befreiung vom Ich, Eingang in das, was Kafka ‚die andere Welt‘ nennt und was Blanchot […] die Welt der Freiheit nennt.6
Am Ende des 1. Kapitels von Thomas l’Obscur ist von solch einer, durch den Bruch mit inneren und äußeren Bindungen bedingten, Befreiung die Rede: „Il y avait dans cette contemplation quelque chose de douloureux qui était comme la manifestation d’une liberté trop grande, d’une liberté obtenue par la rupture de tous les liens.“7 Diese zu große Freiheit ist Resultat der Loslösung von allen Bindungen. Sie ist der Preis der Transgressionserfahrung im Meer, die Thomas’ Subjekthaftigkeit als unkontrollierbare Überschreitung von Körper und Gedanken, aber auch die repräsentierende Sprache an sich untergraben hat. Die andere Seite der Freiheit ist eine fortan unhintergehbare Einsamkeit, die Thomas’ Rückkehr in die Welt verhindert.
Kreisschluss
Die Ausgangsthese war, dass im 1. Kapitel von TO2 ein Initiationsprozess stattfindet, der sich in drei Stufen gliedert. Thomas befindet sich am Anfang und am Ende am Meeresufer sitzend und betrachtet das Wasser. Dies entspricht dem, was ich Kontemplation I und Kontemplation II genannt habe. Dazwischen findet ein topologisch markierter Wechsel des Denk-und Erfahrungsmediums von der Erde ins Wasser statt, in dem sich die eigentliche Initiation in einem ebenfalls dreistufigen Gleiten bis hin zum „lieu sacré“ als innere Erfahrung im Bataillschen Sinne vollzieht.
Die strukturelle Initiation wird ermöglicht durch verschiedene Transgressionen: das Überschreiten der Grenze zwischen Ufer und Meer (gleitende Bewegung nach unten), das Überschreiten der Grenze zwischen dem Wasser und dem „lieu sacré“, das Überschreiten der Grenzen des eigenen Körpers sowie der Grenze von Subjekt und Objekt und der Grenze von Körper und Geist. Richtet man den Blick durch das „microscope géant“ auf die Ebene der sprachlichen Darstellung, finden sich diese Transgressionen des Textes auch auf der Wort-und Satzebene des Textes. Thomas l’Obscur ist folglich, wie Rainer Stillers in Anlehnung an Jean Pfeifer formuliert, neben einer „langage de l’expérience“ auch eine „expérience du langage“, die den Leser erfasst und von ihm eine aktive Teilhabe einfordert.1 Exemplarisch habe ich versucht, dies am Beispiel der „pensée de l’eau“ zu zeigen. Die Selbsttransgressionen der Sprache ereignen sich jedoch auch in Oxymora, diversen Entkopplungen von Zusammenhängen, einander überlagernden Isotopien sowie der Zirkularität der Sprache. Diese transgressiven Bewegungen bedingen die Initiation von Thomas und ermöglichen ihm am Ende des 1. Kapitels einen anderen Zustand. Sie unterlaufen aber auch das Konzept der Initiation als singuläres Ereignis, das normalerweise von Priestern begleitet und von Ritualen gerahmt ist.
Im 2. Kapitel von TO2 wird Thomas in einen höhlenartigen Ort im Wald hinabsteigen, im 4. Kapitel in die Wörter eines Buches, sodann in die Nacht selbst und dergleichen mehr. Am Ende des Textes wird er wieder auf das Meer blicken und sich schließlich abermals hineinstürzen. Das letzte Kapitel schließt an den Beginn des 1. Kapitels und das Bild des auf das Meer blickenden Thomas an, beschließt den Text mit diesem Bild und öffnet ihn gleichzeitig, denn es gibt keine Entwicklung Thomas’ im Sinne eines Entwicklungsromans, keine einfache Reifung oder gehobene Erkenntnis. Das Ende tritt wiederholend an den Anfang: Der Anfang wird damit rückwirkend seiner Originalität beraubt und in Serie geschaltet. Auf die Differenz in der Wiederholung wird das 12. Kapitel meiner Arbeit eingehen. Während Georges Bataille, wie ich zu Beginn des Kapitels ausgeführt habe, im Wesentlichen das 2. Kapitel von Thomas l’Obscur als literarische Ausformung des il y a versteht, möchte ich es im Folgenden als Erfahrung der ‚autre‘ nuit lesen, welche wiederum als Denkfigur des Unbegreiflichen eine große Nähe zum il y a aufweist.
2. Kryptologie – Der Weg in den Ungrund
„Dans la nuit, tout a disparu. C’est la première nuit. Là s’approche l’absence, le silence, le repos, la nuit. […] Mais quand tout a disparu dans la nuit, ‚tout a disparu‘ apparaît. C’est l’autre nuit. La nuit est apparition du ‚tout a disparu‘.“1 Nacht – Absenz – Verschwinden – andere Nacht – Erscheinen des Abwesenden: In diesem kurzen, dem Kapitel „Le dehors, la nuit“ entstammenden, Zitat aus L’espace littéraire unterscheidet Blanchot zwischen einer ersten Nacht (première nuit) und einer anderen Nacht (‚autre‘ nuit). Die andere Nacht ist als andere ernst zu nehmen, denn sie bildet nicht einfach das polare Gegenstück zum Tag, sondern ist derart anders, dass sie eigentlich nicht beschreibbar wäre, hinterließe sie nicht in der ersten Nacht ihre Spuren. Sie stellt demnach ein Ereignis dar, welches Spuren hinterlässt. Diese Spuren soll der nun folgende Gang durch das 2. Kapitel von TO2 nachzeichnen.
Wesentliche Struktur in diesem Kapitel ist eine Abstiegsbewegung Thomas’ vom Waldgrund in den Ungrund eines höhlenartigen Raums. Dieser Abstieg in die tiefe Dunkelheit vollzieht sich jedoch nicht nur als äußere Bewegung, sondern vielmehr als ein Zerschreiben der Möglichkeit, einen stabilen (denkerischen oder epistemologischen) Grund zu finden. Daher möchte ich zunächst einige Überlegungen zum Grund anstellen bevor mit der Lektüre des Kapitels begonnen wird. Um die Raumbewegungen des Textes zu spiegeln, wird in der Lektüre das psychoanalytische Konzept der Krypta, wie Nicolas Abraham und Maria Torok bzw. Jacques Derrida es formulieren, ins Zentrum gerückt. Die Krypta lese ich als eine Möglichkeit, die unmögliche Erscheinung der nicht repräsentierbaren anderen Nacht zu denken. Denn die andere Nacht kann sich nur als Spur, als Erscheinen des Verschwindens, um erneut mein Eingangszitat Blanchots aufzugreifen, manifestieren.2 Die Krypta wäre sodann eine zeitliche, aber besonders auch räumliche Figuration eines Ungrundes, der im Verbergen seines Verbergens nur mehr eine Spur hinterlässt.
2.1 Überlegungen zum Grund (Aushöhlungen)
In diesem Buche findet man einen „Unterirdischen“ an der Arbeit, einen Bohrenden, Grabenden, Untergrabenden. Man sieht ihn, vorausgesetzt, dass man Augen für solche Arbeit der Tiefe hat –, wie er langsam, besonnen, mit sanfter Unerbittlichkeit vorwärts kommt, ohne dass die Noth sich allzusehr verriehthe, welche jede lange Entbehrung von Licht und Luft mit sich bringt; man könnte ihn selbst bei seiner dunklen Arbeit zufrieden nennen. Scheint es nicht, dass irgend ein Glaube ihn führt, ein Trost entschädigt? Dass er vielleicht seine eigne lange Finsterniss haben will, sein Unverständliches, Verborgenes, Räthselhaftes, weil er weiss, was er haben wird: seinen eignen Morgen, seine eigne Erlösung, seine eigne Morgenröthe? …
Gewiss, er wird zurückkehren: fragt ihn nicht, was er da unten will, er wird es Euch selbst schon sagen, dieser scheinbare Trophonios und Unterirdische, wenn er erst wieder „Mensch geworden“ ist. 1
Friedrich Nietzsche
„La littérature s’édifie sur ses ruines“, schreibt Maurice Blanchot in seinem berühmten Essay „La littérature et le droit à la mort“ (1948/1949).2 Das Fundament der Literatur oder ihre Entstehungsbedingungen sind demnach unweigerlich verbunden mit einer Zerstörung ihrer Herkunft, ihres Bodens, ihrer Vergangenheit. Dies kann sowohl andere Literatur(en) meinen als auch möglicherweise die Ersetzung und Zerstörung von Welt durch den Eintritt in die Zeichenstruktur. Damit etwas Neues wachsen kann, muss zuerst Altes zerstört werden. Das Neue schafft sich seinen Platz und dieser Vorgang ist mit Gewalt verbunden, denn die alten Formen weichen nicht freiwillig von der Stelle. Das Neue braucht aber auch das Alte, um sich an ihm abzuarbeiten, um es wegzuarbeiten, es dem Erdboden gleich zu machen, um es zum Fundament zu machen. Bleibt die Frage, wie stabil ein Fundament ist, welches auf Zerstörung beruht, ob nicht die Entstehungsbedingungen eingeschrieben sind in das darauf Errichtete und ob sie nicht irgendwann von unten das darüber Liegende angreifen werden. Im Falle Blanchots würde ich sagen, ist genau dieser Nexus ein fruchtbarer und ein gewollter, denn er verhindert die Erstarrung und die Herausbildung von pseudosoliden Etablissements (frz. établissement = Gründung, Bau, Errichtung).
Die Literatur findet am Übergang zwischen Alt und Neu statt. Sie bildet diesen Übergang, der letztlich bedeutet, dass es nie etwas gänzlich Neues gibt, nur Überschreibungen. So muss jeder Bruch mit dem Alten ebenso als Fortsetzung gedacht werden. Wenn die Literatur sich auf ihren Ruinen errichtet, dann eröffnet dies zwei Fragedimensionen des Grundes, sowohl die nach dem Grund der Worte oder des Denkens als auch die nach dem materiellen Boden. Der Grund der Worte ist bei Blanchot alles andere als beständig. Er ist glitschig, voller Löcher, Abgründe und Irrwege. Auf ihm kann man sich allenfalls in einem Gleiten fortbewegen. Dieses Gleiten bedeutet, dass die Relation zwischen den Worten und den Dingen unzählige Möglichkeiten birgt. Gleiten bedeutet darüber hinaus, dass die Verbindung von Wort und Ding nicht stabil ist. Dies beinhaltet die Potentialität des Übergangs der Materialität des Dings in die Immaterialität der Versprachlichung, ebenso wie umgekehrt der Entblößung des Wortes in seiner Materialität.
Aushöhlungen des Grundes
Historisch wurde die Frage des Grundes, der Erkenntnisbedingungen und der Wahrheitsfähigkeit der Erkenntnis bezeichnenderweise immer wieder über eine Figur der Aushöhlung des Grundes gestellt: die Höhlengleichnisse.
Die den Grund untergrabende Höhle schafft einen von außen unsichtbaren Hohlraum der Geschlossenheit und Dunkelheit, der dem Unverborgenen und Offenen des Sichtbaren eine andere Ordnung entgegensetzt – sei es als Antiraum der Selbsterkenntnis, wie bei Platon, oder als Aufbewahrungsort für Phantasmen in Form des psychoanalytischen Kryptakonzeptes. Obwohl es allein sieben berühmte Höhlengleichnisse in der Geschichte der abendländischen Kultur gibt1, hat sich in der Rezeptionsgeschichte bis heute vor allem das platonische Höhlengleichnis gehalten, welches man aus diesem Grund durchaus als „europäische[…] Fundamentalmetapher“2 bezeichnen darf oder als dunklen Gründungsort des abendländischen Wahrheitsbegriffes.3 Lokalisiert ist es im siebten Buch von Platons Politeia4, wo es nach dem Sonnengleichnis und dem Liniengleichnis, die im sechsten Buch beschrieben werden, die Dreiheit der Gleichnisse vollendet. Als wesentliches Strukturmoment lässt sich auch innerhalb des Höhlengleichnisses ein dreistufiger Aufbau beschreiben: die Schilderung des Höhleninnenraums, der Aufstieg und die Ereignisse außerhalb der Höhle, sowie die Rückkehr in die Höhle bis zum Tod dessen, der die Wahrheit und das Licht geschaut hat.5 Der Schwerpunkt meiner Lektüre des Höhlengleichnisses soll vor allem auf der Topik der Höhle liegen. Insbesondere die Wände, der Boden sowie der Ein- und Ausgang der Höhle stehen dabei im Vordergrund der Betrachtungen. Des Weiteren wird es um die Verbindung der Topik mit entsprechenden Wahrheitssetzungen und Wahrnehmungsmöglichkeiten gehen. Denn die Grundannahme des platonischen Höhlengleichnisses ist eine Gegenüberstellung von Wahrnehmung und Dialektik hinsichtlich ihrer Wahrheitsfähigkeit. Während die Wahrnehmung als trügerisch angesehen wird, weil sie verfälscht sein kann, verspricht die Dialektik hingegen die einzige Möglichkeit wahrer Erkenntnis. Daraus ergibt sich ein Erkenntnisweg, der vom Tiefsten und Dunkelsten (Boden der Höhle, Blick auf die Höhlenwand), über die Überwindung der in Gestalt von Schatten vermittelten Wahrnehmung schließlich hinaus und nach oben (draußen) ans Licht führt, d.h. vom Schein und den Erscheinungen der Höhle ins Sonnenlicht der Wahrheit.
Einer der wenigen Versuche der bildlichen Darstellung des platonischen Höhlengleichnisses ist das „Antrum Platonicum“ aus dem Jahr 1604, ein Stich des niederländischen Druckgrafikers Jan Saenredam nach einem Ölgemälde von Cornelius von Haarlem.

Jan Saenredam / Cornelius von Haarlem: Antrum Platonicum (1604) (Abb. 1)
Erstaunlich an diesem Stich ist, dass die Höhlenwand eher einer Hauswand gleicht und eine sehr gute Einsicht in die Höhle besteht. Das Geschehen wirkt durch sein Menschengetümmel wie auf einem Marktplatz. Darüber hinaus handelt es sich bei der Lichtquelle um eine künstliche Beleuchtung von oben in Gestalt einer Lampe. Während Platon die Gefangenen als an den Schenkeln und am Nacken gefesselt beschreibt, haben die Menschen in dieser Darstellung sehr viel mehr Bewegungsfreiheit. Was die Mauer betrifft, so stimmt sie jedoch durchaus überein mit Platons Bild: „Zwischen dem Feuer und den Gefangenen geht obenher ein Weg, längs diesem sieh eine Mauer aufgeführt wie die Schranken, welche die Gaukler vor den Zuschauern sich erbauen, über welche herüber sie ihre Kunststücke zeigen.“6 Die Parallelisierung der Nicht-Gefangenen mit Gauklern, die etwas inszenieren, und den Gefangenen mit Zuschauern, die dem Spektakel folgen, verdeutlicht den Charakter einer Versuchsanordnung, die Platon hier im Zentrum der Politeia einfügt. Man sollte bezüglich des Stichs des „Antrum Platonicum“ weniger von einer Höhle sprechen, sondern eher von einem Raum mit einem Ein-, und Ausgang auf der linken hinteren Bildhälfte und einer Trennwand, die vom rechten Bildrand in die Bildmitte ragt. Die Konstruktion der höhleninternen Wahrheit erfolgt sodann auf Grundlage der Deutung der Schatten, die durch die Lichtquelle, welche auf die vorbeigetragenen Gegenstände hinter der Trennwand fällt, auf der Höhlenwand entstehen. Damit kommt der Höhlenwand der ontologische Status einer trügerischen Projektionsfläche zu.