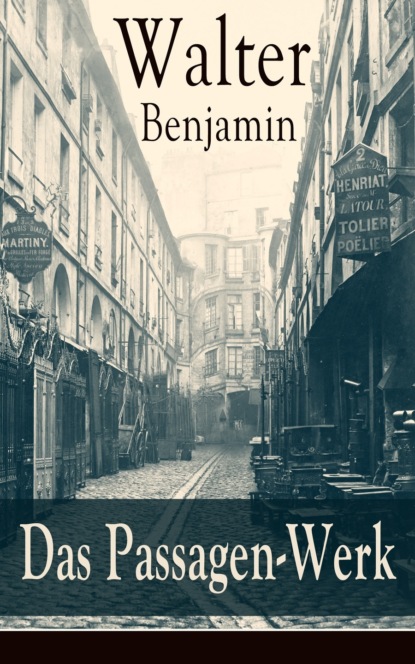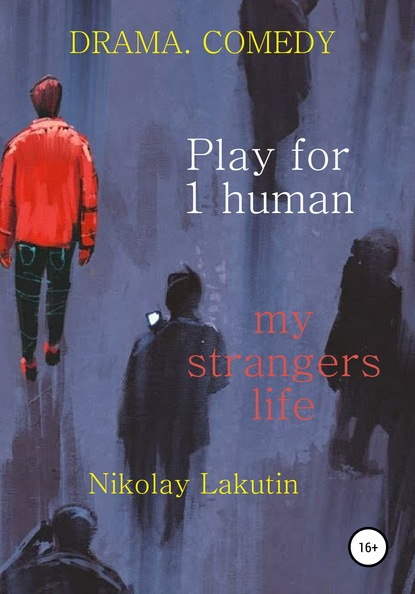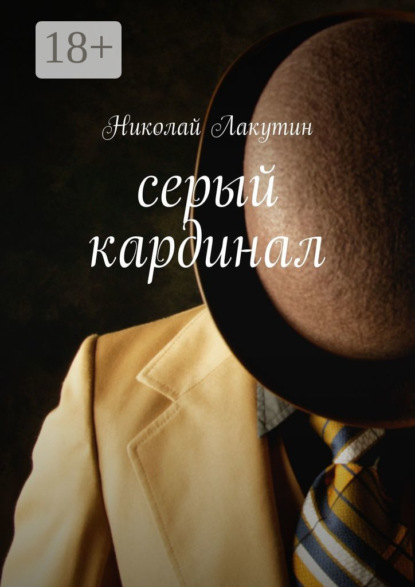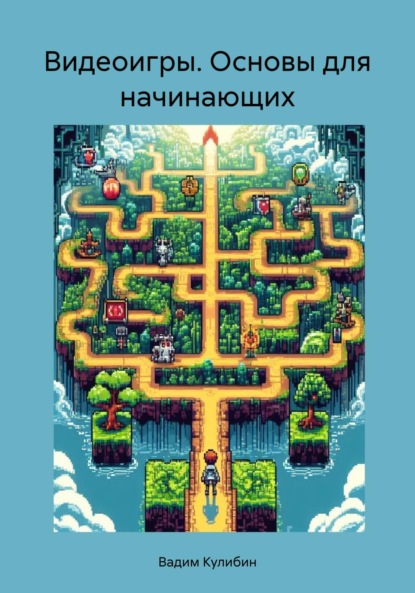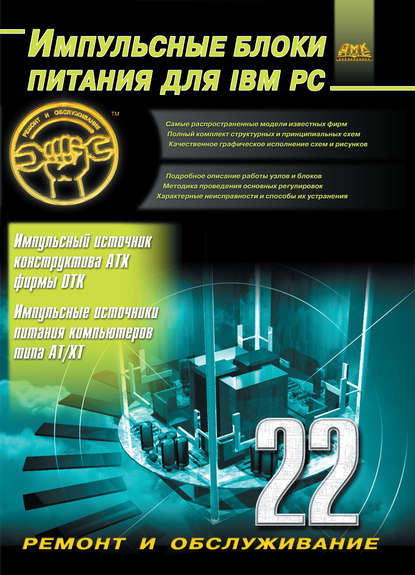- -
- 100%
- +
Eisenkonstruktion
»Chaque époque rêve la suivante.«
Michelet: Avenir! Avenir! (Europe 73 p-6)Dialektische Ableitung der Eisenkonstruktion; sie wird gegen den griechischen Steinbau (Balkendecke) und den mittelalterlichen (Bogendecke) abgehoben. »Eine andere Kunst, in der ein anderes statisches Prinzip den Grundton angibt, der noch viel herrlicher klingt, denn der jener beiden, wird sich aus dem Schoße der Zeit losringen und Leben gewinnen … Ein neues, noch nicht dagewesenes Deckensystem, das natürlich auch sogleich ein neues Reich der Kunstformen nach sich ziehen wird, kann … nur in die Erscheinung treten, sobald ein bis dahin nicht sowohl ungekanntes, als vielmehr nur für eine solche Anwendung noch nicht als leitendes Prinzip genutztes Material beginnt Aufnahme zu finden … Ein solches Material aber ist … das Eisen, mit dessen Nutzung in diesem Sinne unser Jahrhundert bereits begonnen hat. Es ist das Eisen bestimmt, mit der steigenden Prüfung und Erkenntnis seiner statischen Eigenschaften in der Bauweise der kommenden Zeit als Grundlage des Deckensystemes zu dienen und dasselbe, statisch gefaßt, einmal so weit über das hellenische und mittelalterliche zu erheben, als das Bogen-Deckensystem das Mittelalter über das monolithe Steinbalkensystem der alten Welt erhob … Wird also vom Bogenbaue das statische Kraftprinzip entlehnt und zu einem ganz neuen ungekannten Systeme gestaltet, so wird auf der anderen Seite hinsichtlich der Kunstformen des neuen Systemes das Formenprinzip der hellenischen Weise aufgenommen werden müssen.« Zum hundertjährigen Geburtstag Karl Böttichers Berlin 1906 p 42, 44-46 (Das Prinzip der hellenischen und germanischen Bauweise hinsichtlich der Übertragung in die Bauweise unserer Tage) [F 1, 1]
Zu früh gekommenes Glas, zu frühes Eisen. In den Passagen ist das sprödeste und das stärkste Material gebrochen, gewissermaßen geschändet worden. Mitte vorigen Jahrhunderts wußte man noch nicht, wie mit Glas und Eisen gebaut werden muß. Darum ist der Tag so schmutzig und trübe, der durch die Scheiben zwischen eisernen Trägern von oben hereinfällt. [F 1, 2]
»In der Mitte der dreißiger Jahre kommen die eisernen Möbel auf, als Bettstellen, Stühle, Gueridons, Jardinièren, und es ist sehr bezeichnend für die Zeit, daß ihnen als besonderer Vorzug nachgerühmt wird: sie ließen sich in jeder Holzart täuschend nachahmen. Kurz nach 1840 erscheinen die französischen ganz überpolsterten Möbel und mit ihnen gelangt der Tapezierstil zu ausschließlicher Herrschaft.« Max von Boehn: Die Mode im XIX. Jahrhundert II München 1907 p 131 [F 1, 3]
Die beiden großen Errungenschaften der Technik: G〈l)as und Gußeisen gehen zusammen. »Sans compter la quantité innombrable de lumières entretenues par les marchands, ces galeries sont éclairées le soir par trente-quatre becs de gaz hydrogène portés par des enroulements en fonte fixés sur les pilastres.« Vermutlich ist von der Galerie de l’Opéra die Rede. J. A. Dulaure: Histoire de Paris … depuis 1821 jusqu’à nos jours II 〈Paris 1835 p 29〉 [F 1, 4]
»Der Postwagen sprengt am Seinequai hinauf. Ein Blitzstrahl zuckt über den Pont d’Austerlitz. Der Bleistift ruhe!« Karl Gutzkow: Briefe aus Paris II 〈Leipzig 1842〉 p 234 Der pont d’Austerlitz war eine der ersten Eisenkonstruktionen in Paris. Mit dem Blitzstrahl darüber wird er zum Emblem des hereinbrechenden technischen Zeitalters. Daneben der Postwagen mit seinen Rappen unter deren Hufen der romantische Funke hervorsprüht. Und der Bleistift des deutschen Autors, der sie nachzeichnet: eine großartige Vignette im Stile Grandvilles. [F 1, 5]
»Nous ne connaissons pas, en réalité, de beaux théâtres, de belles gares de chemins de fer, de belles expositions universelles, de beaux casinos, c’est-à-dire de beaux édifices industriels ou futiles.« Maurice Talmeyr: La cité du sang Paris 1908 p 277 [F 1, 6]
Gußeisenzauber: »Hahblle put se convaincre alors que l’anneau de cette planète n’était autre chose qu’un balcon circulaire sur lequel les Saturniens viennent le soir prendre le frais.« Grandville: Un autre monde Paris 〈1844〉 p 139 □ Haschisch □ [F 1, 7]
Bei Erwähnung der im Wohnhausstil erbauten Fabriken etc. ist die folgende Parallele aus der Geschichte der Architektur heranzuziehen: »Ich habe früher gesagt, daß in der Periode der Empfindsamkeit Tempel der Freundschaft und Zärtlichkeit errichtet wurden; als dann der antikisirte Geschmack kam, da tauchten alsbald in den Gärten, in den Parks, auf den Höhen Tempel oder tempelartige Gebäude in Menge auf, nicht bloß den Grazien oder Apoll und Musen gewidmet, sondern auch die Wirtschaftsgebäude, die Scheunen und Viehställe wurden im Tempelstil gebaut.« Jacob Falke: Geschichte des modernen Geschmacks Lpz 1866 p 373/374 Es gibt also Masken der Architektur und in solcher Maskierung steigt die Architektur um 1800, wie zu einem bal paré〈,〉 geisterhaft an den Sonntagen überall um Berlin herum auf. [F 1 a, 1]
»Ein jeder Gewerbsmann imitirte des anderen Stoff und Weise und glaubte ein Wunder von Geschmack gethan zu haben, wenn er Porzellantassen wie vom Faßbinder gemacht, Gläser gleich Porzellan, Goldschmuck gleich Lederriemen, Eisentische von Rohrstäben u. s. w. zu Stande gebracht hatte. Auf diesem Gebiete schwang sich auch der Conditor, das Reich und den Prüfstein seines Geschmacks gänzlich vergessend, zum Bildhauer und Architekten empor.« Jacob Falke: Geschichte des modernen Geschmacks p 380 Diese Ratlosigkeit entsprang zum Teil dem Überreichtum technischer Verfahren und neuer Stoffe, mit denen man über Nacht war beschenkt worden. Wie man sie tiefer sich anzueignen trachtete, kam es zu Mißgriffen und verfehlten Versuchen. Von einer andern Seite aber sind diese Versuche echteste Zeugnisse dafür, wie traumbefangen die technische Produktion in ihren Anfängen war. (Auch die Technik, nicht nur die Architektur, ist in gewissen Stadien Zeugnis eines Kollektivtraums). [F 1 a, 2]
»Dans un genre secondaire il est vrai, la construction en fer un art nouveau se révélait. La gare du chemin de fer de l’Est, due à Duquesnay, a mérité à cet égard l’attention des architectes. L’emploi du fer a augmenté beaucoup à cette époque, grâce aux combinaisons nouvelles auxquelles il s’est prêté. Deux œuvres remarquables à des titres divers, la bibliothèque Sainte-Geneviève et les Halles centrales sont à mentionner tout d’abord en ce genre. Les Halles sont … un véritable type, qui plusieurs fois reproduit à Paris et dans d’autres villes, commença alors, comme jadis le gothique de nos cathédrales, à faire le tour de la France … Dans les détails, on remarqua de notables améliorations. La plomberie monumentale devint riche et élégante; les grilles, les candélabres, les pavés en mosaïque témoignèrent d’une recherche souvent heureuse du beau. Le progrès de l’industrie permit de cuivrer la fonte, procédé dont il ne faut pas abuser; le progrès du luxe conduisit avec plus de bonheur à substituer à la fonte le bronze, qui a fait des candélabres de quelques places publiques des objets d’art.« □ Gas □ Anmerkung zu dieser Stelle: »A Paris, en 1848, il est entré 5,763 tonnes de fer; en 1854, 11,771; en 1862, 41,666; en 1867, 61,572.« E. Levasseur: Histoire des classes ouvrières et de l’industrie en France de 1789 à 1870 II Paris 1904 p 531/532 [F 1 a, 3]
»Henri Labrouste, artiste d’un talent sobre et sévère, inaugura avec succès l’emploi ornamental du fer dans la construction de la bibliothèque Sainte-Geneviève et de la Bibliothèque nationale.« Levasseur ebd p 197 [F 1 a, 4]
Erster Bau der Hallen nach einem Projekt, das Napoleon 1811 angenommen hatte〈,〉 1851 begonnen. Es mißfiel allgemein. Man nannte diese Steinkonstruktion le fort de la Halle. »L’essai était malheureux, on ne le renouvela pas …, et l’on chercha un genre de construction mieux approprié au but qu’on s’était proposé. La partie vitrée de la gare de l’Ouest et le souvenir du Palais de cristal qui avait, à Londres, abrité l’Exposition universelle de 1851 donnèrent, sans aucun doute, l’idée d’employer presque exclusivement la fonte et le verre. On peut voir aujourd’hui qu’on a eu raison d’avoir recours à ces légers matériaux qui, mieux que tous autres, remplissent les conditions qu’on doit exiger dans des établissements semblables. Depuis 1851, on n’a cessé de travailler aux Halles, et cependant elles ne sont pas encore terminées.« Maxime Du Camp: Paris Paris 1875 II p 121/122 [F 1 a, 5]
Projekt eines Bahnhofs, der die Gare St Lazare ersetzen sollte. Ecke place de la Madeleine und rue Tronchet. »Les rails, supportés sur ›d’élégants arceaux de fonte élevés de 20 pieds au-dessus du sol et ayant une longueur de 615 mètres,‹ selon le rapport, auraient traversé les rues Saint-Lazare, Saint-Nicolas, des Mathurins et Castellane, qui, chacune, aurait eu une station particulière. □ Flaneur. Eisenbahnstation bei〈?〉 den Straßen □ … Rien qu’à le voir [sc. le plan], on comprend combien on avait peu deviné l’avenir réservé aux chemins de fer. Quoique qualifiée de ›monumentale‹, la façade de cette gare, qui, heureusement, n’a jamais été construite, est de dimension singulièrement restreinte; elle ne suffirait même pas à loger un des magasins qui s’étalent maintenant aux angles de certains carrefours. C’est une sorte de maison à l’italienne, à trois étages ouverts chacun de huit fenêtres; le dégagement principal est représenté par un escalier de vingt-quatre marches se dégorgeant sous un porche plein cintre assez large pour laisser passer cinq ou six personnes de front.« Du Camp: Paris I p 238/239 [F 2, 1]
La gare de l’Ouest (heute?) offre »le double aspect d’une usine en activité et d’un ministère.« Du Camp: Paris I p 241 »Lorsque tournant le dos au souterrain à triple tunnel qui passe sous le boulevard des Batignolles, on aperçoit l’ensemble de la gare, on reconnaît qu’elle a presque la forme d’une immense mandoline dont les rails seraient les cordes et dont les poteaux de signaux, placés à chaque embranchement, seraient les chevilles.« Du Camp: Paris I p 250 [F 2, 2]
»Caron … ruiné par l’établissement d’une passerelle en fil de fer sur le Styx.« Grandville: Un autre monde Paris 1844 p 138 [F 2, 3]
Erster Akt von Offenbachs »Pariser Leben« spielt auf einem Bahnhof. »Die industrielle Bewegung scheint dieser Generation so im Blut gelegen zu haben, daß z. B. Flachat sein Haus auf einem Grundstück errichtete, an dem rechts und links die Züge unaufhörlich vorbeipfiffen.« Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich Leipzig Berlin 〈1928〉 p 13 Eugène Flachat (1802-1873) Eisenbahnbauer, Konstrukteur. [F 2, 4]
Zu der Galérie d’Orléans im Palais Royal (1829-1831)〈:〉 »Selbst Fontaine, einer der Gründer des Empirestils, bekehrt sich im Alter noch zu dem neuen Material. Er ersetzte übrigens auch 1835-36 den hölzernen Boden der Galerie des Batailles in Versailles durch eiserne Armierungen. – Diese Galerien, wie jene im Palais Royal, haben nachträglich in Italien ihre Weiterbildung erfahren. Für uns sind sie ein Ausgangspunkt für neue Bauprobleme: Bahnhöfe usw.« Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich p 21 [F 2, 5]
»Die Halle au blé erhielt 1811 ihre komplizierte Konstruktion aus Eisen und Kupfer … durch den Architekten Bellangé und den Ingenieur Brunet. Es ist unseres Wissens das erste Mal, daß Architekt und Ingenieur nicht mehr in einer Person vereinigt sind … Hittorf, der Erbauer des Gare du Nord, erhielt unter Bellangé den ersten Einblick in die Eisenkonstruktion. – Allerdings handelt es sich mehr um eine Anwendung des Eisens, als eine Eisenkonstruktion. Man überträgt noch einfach die Holzbauweise auf Eisen.« Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich p 20 [F 2, 6]
Zu Veugnys Markthalle an der Madeleine 1824〈;〉 »Die Grazilität der zarten Guß-Säulen erinnert an pompejanische Wandgemälde. ›La construction en fer et fonte du nouveau marché de la madeleine est une des plus gracieuses productions de ce genre:, on ne saurait imaginer rien de plus élégant et de meilleur goût …‹ Eck, Traité. O. c.« Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich p 21 [F 2, 7]
»Der wichtigste Schritt zur Industrialisierung: Herstellung bestimmter Formen (Profile) aus Schmiedeeisen oder Stahl auf maschinellem Wege. Die Gebiete durchdringen sich: man begann nicht bei Bauteilen, sondern mit der Eisenbahnschiene … 1832. Hier liegt der Ausgangspunkt zu den Profileisen, d. h. der Grundlage der Gerüstbauten. [Anm. zu dieser Stelle: Die neuen Herstellungsmethoden drangen langsam in die Industrie. Man kam in Paris 1845 zu den Doppel-T-Eisen als Deckenträger anläßlich eines Maurerstreikes und infolge der hohen Holzpreise bei der gesteigerten Bautätigkeit und den größer werdenden Spannweiten.〈]〉« Giedion: Bauen in Frankreich p 26 [F 2, 8]
Die ersten Eisenbauten dienten transitorischen Zwecken: Markthallen, Bahnhöfe, Ausstellungen. Das Eisen verbindet sich also sofort mit funktionalen Momenten im Wirtschaftsleben. Aber was damals funktional und transitorisch war, beginnt heute in verändertem Tempo formal und stabil zu wirken. [F 2, 9]
»Die Hallen bestehen aus zwei Gruppen von Pavillons, die durch ›rues couvertes‹ unter sich verbunden sind. Es handelt sich um eine etwas ängstliche Eisenkonstruktion, die die großzügigen Spannweiten der Horeau und Flachat vermeidet und sich sichtlich an das Vorbild der Gewächshäuser hält.« Giedion: Bauen in Frankreich p 28 [F 2 a, 1]
Zur Gare du Nord: »Der Luxus an Raumüberfluß bei Wartehallen, Eingängen, Restaurants, wie er um 1880 auftritt, und dann das Bahnhofsproblem als übersteigerten Barockpalast formulierte, wird hier noch ganz vermieden.« Giedion: Bauen in Frankreich p 31 [F 2 a, 2]
»Wo das 19. Jahrhundert sich unbeachtet fühlt, wird es kühn.« Giedion: Bauen in Frankreich p 33 Dieser Satz behauptet sich in der Tat in der allgemeinen Fassung, die er hier hat, die anonyme Illustrierungskunst der Familienzeitschriften und Kinderbücher z. B. ist dafür ein Beleg. [F 2 a, 3]
Bahnhöfe hießen früher »Eisenbahnhöfe«. [F 2 a, 4]
Man gedenkt die Kunst von den Formen aus zu erneuern. Sind aber Formen nicht das eigentliche Geheimnis der Natur, die sich vorbehält, gerade mit ihnen die richtige, die sachliche, die logische Lösung eines rein sachlich gestellten Problems zu belohnen. Als das Rad erfunden wurde um die Vorwärtsbewegung kontinuierlich über den Boden dahingehen lassen zu können – hätte da einer nicht mit einem gewissen Rechte sagen können: und nun ist es par-dessus le marché noch rund, noch Radform? Kommen nicht alle großen Eroberungen im Gebiete der Formen schließlich so, als technische Entdeckungen zustande? Welche Formen, die für unser Zeitalter bestimmend werden, in den Maschinen verborgen liegen, beginnen wir erst eben zu ahnen. »Wie sehr im Anfang die alte Form des Produktionsmittels seine neue Form beherrscht, zeigt … vielleicht schlagender als alles Andre eine vor der Erfindung der jetzigen Lokomotiven versuchte Lokomotive, die in der That zwei Füsse hatte, welche sie abwechselnd wie ein Pferd aufhob. Erst nach weitrer Entwicklung der Mechanik und gehäufter praktischer Erfahrung wird die Form gänzlich durch das mechanische Princip bestimmt und daher gänzlich emancipirt von der überlieferten Körperform des Werkzeugs, das sich zur Maschine entpuppt.« (In diesem Sinne sind z. B. auch in der Architektur Stütze und Last »Körperformen«.) Die Stelle bei Marx: Kapital I Hamburg 1922 p 347 Anm. [F 2 a, 5]
Durch die Ecole des Beaux-Arts wird die Architektur zu den bildenden Künsten geschlagen. »Das wurde ihr Unheil. Im Barock war diese Einheit vollendet und selbstverständlich gewesen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts aber zwiespältig und falsch geworden.« Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich 〈Leipzig Berlin 1928〉 p 16 Das gibt nicht nur eine sehr wichtige Perspektive auf das Barock, das zeigt zugleich, daß die Architektur am frühesten dem Begriffe der Kunst historisch entwachsen ist, oder besser gesagt, daß sie am wenigsten die Betrachtung als »Kunst« vertrug, die das 19te Jahrhundert, im Grunde mit nicht viel größerer Berechtigung in einem vordem ungeahnten Maße den Erzeugnissen geistiger Produktivität auf gezwungen hat. [F 3, 1]
Die staubige Fata Morgana des Wintergartens, die trübe Perspektive des Bahnhofs mit dem kleinen Altar des Glücks im Schnittpunkt der Gleise, das alles modert unter falschen Konstruktionen, zu früh gekommenem Glas, zu frühem Eisen. Denn in dem ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts ahnte noch niemand, wie mit Glas und Eisen gebaut werden muß. Aber längst haben Hangars und Silos das eingelöst. Nun steht es mit dem Menschenmaterial im Innern wie mit dem Baumaterial der Passagen. Zuhälter sind die eisernen Naturen dieser Straße und ihre gläsernen Spröden sind Huren. [F 3, 2]
»Das neue ›Bauen‹ hat seinen Ursprung im Augenblick der Industriebildung um 1830, im Augenblick der Umwandlung des handwerklichen in den industrieilen Produktionsprozeß.« Giedion: Bauen in Frankreich 〈Leipzig Berlin 1928〉 p 2 [F 3, 3]
Wie groß die natürliche Symbolgewalt technischer Neuerungen sein kann, dafür sind die »Eisenbahnschienen« mit der durchaus eigenen und unverwechselbaren Traumwelt, die sich an sie anschließt, ein sehr eindrückliches Beispiel. Volles Licht aber fällt darauf, wenn man von der erbitterten Polemik erfährt, die in den dreißiger Jahren gegen die Schienen geführt wurde. So wollte A. Gordon: A treatise in elementary locomotion die Dampfwagen – wie man damals sagte – auf Granitstraßen laufen lassen. Man glaubte garnicht Eisen genug für die damals doch erst in kleinstem Maßstab projektierten Eisenbahnlinien produzieren zu können. [F 3, 4]
Man muß beachten, daß die großartigen Aspekte, die die neuen Eisenkonstruktionen auf die Städte gewährten – Giedion: Bauen in Frankreich 〈Leipzig Berlin 1928〉 gibt in den Abb. 61-63 ausgezeichnete Beispiele am Pont Transbordeur in Marseille – auf lange hinaus sich ausschließlich den Arbeitern und Ingenieuren erschlossen. ■ Marxismus ■ Denn wer sonst als Ingenieur und Proletarier ging damals die Stufen, die allein erst das Neue, Entscheidende – das Raumgefühl dieser Bauten – ganz zu erkennen gaben? [F 3, 5]
1791 kommt in Frankreich für die Offiziere der Befestigungs- und Belagerungskunst die Bezeichnung »ingénieur« auf. »Und zu derselben Zeit, in demselben Land begann der Gegensatz zwischen ›Konstruktion‹ und ›Architektur‹ sich bewußt und bald in persönlicher Schärfe zu äußern. Die gesamte Vergangenheit kannte ihn nicht … In den ungemein zahlreichen kunsttheoretischen Erörterungen aber, welche die französische Kunst nach den Stürmen der Revolution wieder in geregelte Bahnen zurückbegleiteten, … traten die ›constructeurs‹ den ›décorateurs‹ gegenüber, und sofort zeigte sich die weitere Frage, ob dann nicht auch die ›ingénieurs‹, als ihre Verbündeten, sozial ein eigenes Lager mit ihnen beziehen müßten.« A. G. Meyer: Eisenbauten Esslingen 1907 p 3 [F 3, 6]
»Die Technik der Steinarchitektur ist: Stereotomie, die des Holzes: Tektonik. Was hat der Eisenbau mit dieser und mit jener gemeinsam?« Alfred Gotthold Meyer: Eisenbauten Esslingen 1907 p 5 »Im Stein spüren wir den natürlichen Geist der Masse. Das Eisen ist uns nur künstlich komprimierte Festigkeit und Zähigkeit.« ebd p 9 »Das Eisen ist an Festigkeit dem Stein vierzigfach, dem Holz zehnfach überlegen und hat jenem gegenüber trotzdem nur das vierfache, diesem gegenüber nur das achtfache Eigengewicht. Ein Eisenkörper besitzt also im Vergleich mit einem gleichgroßen Steinvolumen bei nur viermal größerer Schwere eine vierzigmal größere Tragkraft.« ebd p 11 [F 3, 7]
»Dieses Material selbst hat schon in seinen ersten hundert Jahren wesentliche Wandlungen erfahren – Gußeisen, Schweißeisen, Flußeisen – so daß heut dem Bauingenieur ein völlig anderer Baustoff zur Verfügung steht als vor etwa fünfzig Jahren … Das sind im Sinne geschichtlicher Betrachtung ›Fermente‹ von beunruhigender Wandelbarkeit. Kein Baustoff bietet etwas auch nur annähernd Verwandtes. Man steht hier am Anfang einer mit rasender Schnelligkeit weiterstrebenden Entwicklung … Die … Bedingungen des Stoffes … verflüchtigen sich zu unbegrenzten Möglichkeiten‹.« A. G. Meyer: Eisenbauten p 11 Eisen als revolutionäres Baumaterial! [F 3 a, 1]
Wie es indessen im Vulgärbewußtsein aussah, zeigt kraß und doch typisch die Äußerung eines zeitgenössischen Journalisten, einst werde die Nachwelt gestehen müssen: »Im 19ten Jahrhundert erblühte die altgriechische Baukunst wieder in ihrer alten Reinheit.« Europa Stuttgart u Lpz 1837 II p 207 [F 3 a, 2]
Bahnhöfe als »Kunststätten«. »Si Wiertz avait eu à sa disposition … les monuments publics de la civilisation moderne: des gares de chemins de fer, des chambres législatives, des salles d’université, des halles, des hôtels de ville … qui pourrait dire quel monde nouveau, vivant, dramatique, pittoresque, il eût jeté sur la toile?« A. J. Wiertz: Œuvres littéraires Paris 1870 p 525/26 [F 3 a, 3]
Welcher technische Absolutismus dem Eisenbau schon lediglich dem Material nach, zugrunde liegt, erkennt man, wenn man sich den Gegensatz vergegenwärtigt, in dem es zu den überkommenen Anschauungen von der Geltung und Brauch〈bar〉keit von Baumaterialien überhaupt stand. »Man brachte dem Eisen ein gewisses Mißtrauen entgegen, eben weil es nicht unmittelbar von der Natur dargeboten, sondern als Bildstoff erst künstlich gewonnen wird. Das ist nur eine Sonderanwendung jenes allgemeinen Empfindens der Renaissance, dem Leo Battista Alberti (De re aedificatoria Paris 1512 fol XLIV) einmal mit den Worten Ausdruck gibt: ›Nam est quidem cujusquis corporis pars indissolubilior, quae a natura concreta et counita est, quam quae hominum manu et arte conjuncta atque, compacta est.‹« A. G. Meyer: Eisenbauten Esslingen 1907 PH [F 3 a, 4]
Es ist der Überlegung wert – und es scheint diese Überlegung käme zu einem verneinenden Resultat – ob auch früher die technischen Notwendigkeiten im Bauen (aber auch in den übrigen Künsten) die Formen, den Stil so weitgehend determinierten, wie das heute geradezu zur Signatur aller Produktionen dieser Epoche zu werden scheint. Am Eisen als Material ist das schon deutlich, und vielleicht am frühesten, erkennbar. Denn die »Grundformen, in denen das Eisen als Baustoff auftritt, sind … bereits an sich als Einzelgebilde teilweise neuartig. Und ihre Eigenart ist in besonderem Grade Ergebnis und Ausdruck der natürlichen Eigenschaften des Baumaterials, weil schon die letzteren selbst technisch und wissenschaftlich gerade für diese Formen entwickelt und ausgenutzt werden. Der zielbewußte Arbeitsprozeß, der den Rohstoff zum unmittelbar verwendbaren Baustoff umformt, setzt beim Eisen bereits in einem weitaus früheren Stadium ein als bei den bisherigen Baumaterialien. Zwischen Materie und Material waltet hier füglich ein anderes Verhältnis als zwischen Stein und Quader, Ton und Ziegel, Holz und Balken: Baustoff und Bauform sind im Eisen gleichsam mehr homogen.« A. G. Meyer: Eisenbauten Esslingen 1907 p 23 [F 3 a, 5]
1840-1844: »La construction, inspirée par Thiers, des fortifications … Thiers, qui pensait que les chemins de fer ne marcheraient jamais, fit construire des portes à Paris au moment où il lui eût fallu des gares.« Dubech-D’Espezel: Histoire de Paris Paris 1926 p 386 [F 3 a, 6]
»Schon vom 15. Jahrhundert an beherrscht dieses fast farblose Glas als Fensterscheibe auch das Haus. Die ganze Entwicklung des Innenraumes folgt der Parole: ›Mehr Licht!‹ – Im 17. Jahrhundert führt sie zu Fensteröffnungen, die in Holland selbst im Bürgerhaus durchschnittlich etwa die Hälfte der Wandfläche einnehmen … / Die dadurch bedingte Lichtfülle mußte … bald unerwünscht werden. Beim Zimmer bot die Gardine eine durch den Übereifer der Tapezierkunst schnell verhängnisvoll werdende Hilfe … / Die Entwicklung des Raumes durch Glas und Eisen war auf einen toten Punkt gelangt. / Da floß ihr von einer ganz unscheinbaren Quelle plötzlich neue Kraft zu. / Und wieder war diese Quelle ein ›Haus‹, das ›Schutzbedürftiges bergen‹ sollte, aber weder ein Haus für Lebewesen noch für die Gottheit, ebensowenig ein Haus für die Herdflamme oder für tote Habe, sondern: ein Haus für Pflanzen. / Der Ursprung aller Architektur aus Eisen und Glas im Sinne der Gegenwart ist das Gewächshaus.« A. G. Meyer: Eisenbauten 〈Esslingen 1907〉 p 55 □ Licht in den Passagen □ Spiegel □ Die Passage ist das Wahrzeichen der Welt, die Proust malt. Merkwürdig wie sie, genau wie diese Welt, in ihrem Ursprung dem Pflanzendasein verhaftet ist. [F 4, 1]
Über den Kristallpalast von 1851〈:〉 »Unter allem Großen des ganzen Werkes ist diese gewölbte Mittelhalle das Größte – in jenem Sinn … Allein auch hier sprach zunächst nicht ein raumgestaltender Architekt, sondern ein – Gärtner … Das gilt sogar unmittelbar, denn der Hauptgrund für diese Erhöhung der Mittelhalle war, daß sich auf ihrem Terrain im Hydepark herrliche Ulmenbäume befanden, welche weder die Londoner noch Paxton selbst fällen mochten. Indem Paxton sie in sein riesiges Glashaus einschloß, wie zuvor die südlichen Pflanzen von Chatsworth, gab er seinem Bau fast unbewußt einen wesentlich höheren architektonischen Wert.« A. G. Meyer: Eisenbauten Esslingen 1907 p 62 [F 4, 2]