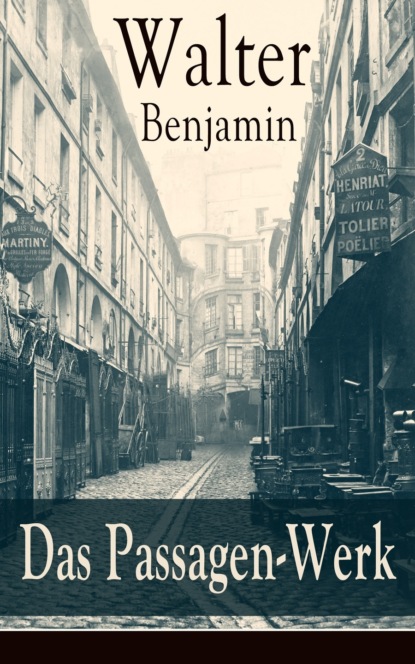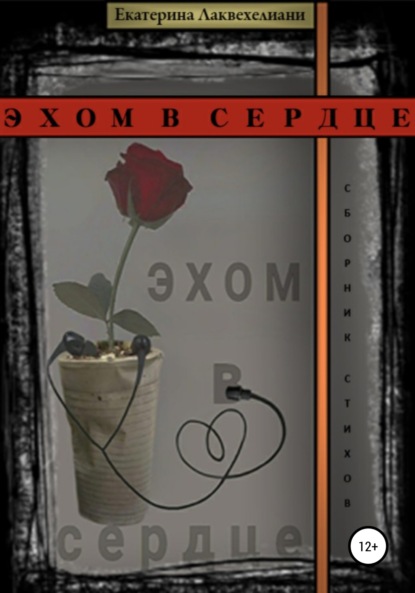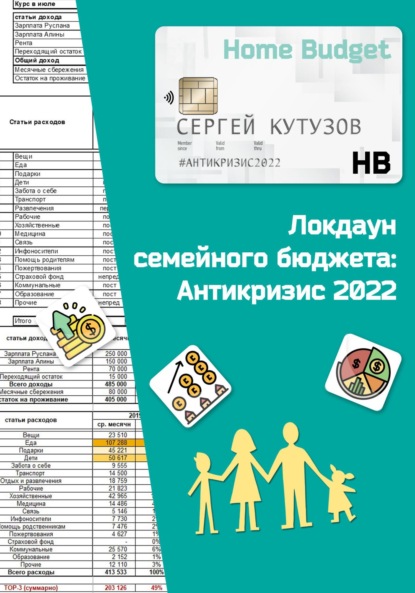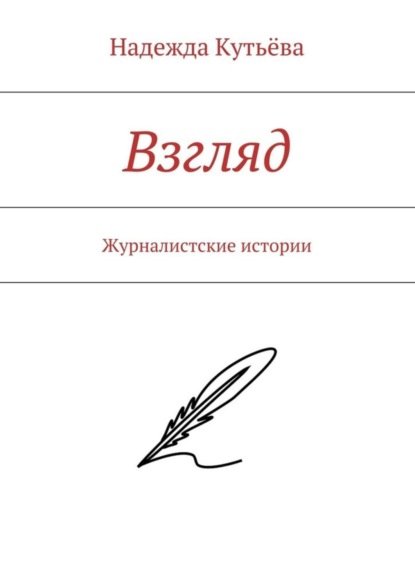- -
- 100%
- +
»Puisque le bal est la seule réunion où les hommes sachent se tenir, habituons-nous à calquer toutes nos institutions sur le bal, où la femme est reine.« A Toussenel: Le monde des oiseaux I Paris 1853 p 134 Und〈:〉 »Bien des hommes sont galants et très-bien dans un bal, qui ne se doutent pas que la galanterie est un commandement de Dieu.« le p 98 [G 13, 4]
Über Gabriel Engelmann. »Lorsqu’il publiera, en 1816, ses Essais lithographiques, il aura un grand soin de mettre cette médaille en frontispice de son livre, avec une légende: ›Décernée à M. G. Engelmann, de Mulhouse (Haut-Rhin). Exécution en grand et perfectionnement de l’art lithographique. Encouragement. 1816.‹« Henri Bouchot: La lithographie Paris 〈1895〉 p 〈38〉 [G 13, 5]
Über die Londoner Weltausstellung: »Au milieu de cette immense exposition, l’observateur reconnaissait bientôt que, pour ne pas s’y perdre …, il fallait réunir les peuples divers en un certain nombre de groupes, et que le seul mode efficace, utile, de composer ces groupes industriels consistait à prendre pour base, quoi? les croyances religieuses. A chacune des grandes divisions religieuses entre lesquelles se répartit le genre humain correspond en effet … un mode d’existence et d’activité industrielle qui lui est propre.« Michel Chevalier: Du progrès Paris 1852 p 13 [G 13 a, 1]
Aus dem ersten Kapitel des »Kapital«: »Eine Ware erscheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, daß sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Soweit sie Gebrauchswert, ist nichts Mystisches an ihr … Die Form des Holzes wird verändert, wenn man aus ihm einen Tisch macht; nichtsdestoweniger bleibt der Tisch Holz, ein ordinäres sinnliches Ding. Aber sobald er als Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich übersinnliches Ding. Er steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Boden, sondern er stellt sich allen anderen Waren gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu tanzen begänne.« cit Franz Mehring: Karl Marx und das Gleichnis [in: Karl Marx als Denker Mensch und Revolutionär hg. von Rjazanov Wien Berlin 〈1928〉 p 57 (abgedruckt aus »Die Neue Zeit« 13 März 1908)] [G 13 a, 2]
Renan vergleicht die Weltausstellungen mit den großen griechischen Festen, den olympischen Spielen, den Panathäneen. Aber zum Unterschied von den letzten feh〈l〉t den ersten die Poesie. »Deux fois l’Europe s’est dérangé pour voir des marchandises étalées et comparer des produits matériels et, au retour de ces pèlerinages d’un genre nouveau, personne ne s’est pleint que quelque chose lui manquait.« Einige Seiten weiter: »Notre siècle ne va ni vers le bien ni vers le mal; il va vers la médiocrité. En toute chose ce qui réussit de nos jours, c’est le médiocre.« Ernest Renan: Essais de morale et de critique Paris 1859 p 356/57 und 373 (La poésie de l’Exposition) [G 13 a, 3]
Haschischvision im Spielsaal von Aix-la-Chapelle. »Le tapis d’Aix-la-Chapelle est un congrès hospitalier où les monnaies de tous les règnes et de tous les pays sont admises … Une pluie de léopolds, de frédéric-guillaumes, de queen Victoria et de napoléons fondait … sur la table. A force de considérer cette brillante alluvion … je crus m’apercevoir … que les effigies des souverains … s’effaçaient invinciblement de leurs écus, guinées ou ducats respectifs, pour faire place à d’autres visages tout à fait nouveaux pour moi. Les plus grand nombre de ces faces … grimaçaient … le dépit, l’avidité ou la fureur. Il y en avait de joyeuses, mais c’était le très-petit nombre … Bientôt ce phénomène … pâlit et disparut devant une vision bien autrement extraordinaire … Les bourgeoises effigies qui avaient supplanté les Majestés ne tardèrent pas elles-mêmes à s’agiter dans le cercle métallique … où elles étaient confinées. Bientôt elles s’en séparèrent, d’abord par le grossissement exagéré de leur relief; puis les têtes se détachèrent en ronde bosse. Elles prirent ensuite … non-seulement la physionomie, mais la carnation humaine. Des corps lilliputiens vinrent y adhérer; le tout se modela … tant bien que mal, et des créatures de tout point semblables à nous, sauf la taille … commencèrent d’animer le tapis vert d’où tout numéraire avait disparu. J’entendais bien le cliquetis de l’argent choqué par l’acier des râteaux, mais c’était tout ce qui restait de l’ancienne sonorité … des louis et des écus changés en hommes. Ces pauvres myrmidons s’enfuyaient éperdus devant l’homicide râteau du croupier … mais en vain … Alors … l’enjeu nain, forcé de s’avouer vaincu, était impitoyablement appréhendé au corps par le fatal râteau, qui le ramenait dans la main crochue du croupier. Celui-ci, ô horreur! prenait l’homme délicatement entre deux doigts et le croquait à belles dents! En moins d’une demi-heure, je vis ainsi engouffrer dans cet effroyable tombeau une demi-douzaine de ces imprudents Lilliputiens … Mais ce dont je restai le plus épouvanté, ce fut lorsque, levant les yeux par hasard sur la galerie qui entourait ce redoutable champ de mort, je constatai non pas seulement une parfaite ressemblance, mais une complète identité entre divers pontes paraissant jouer un très-gros jeu et les miniatures humaines qui se débattaient sur la table … De plus, ces pontes … me parurent … s’affaisser sur eux-mêmes à mesure que leurs fac-similé enfantins étaient gagnés de vitesse … par le formidable râteau. Ils semblaient partager .., toutes les sensations de leurs petits Sosies; et je n’oublierai de ma vie le regard et le geste haineux, désespérés, que l’un de ces joueurs adressa à la banque au moment même où sa mignonne contrefaçon, saisie par le râteau, s’en allait assouvir la faim vorace du croupier.« Félix Mornand: La vie des eaux Paris 1862 p 219-221 (Aix-la-Chapelle) [G 14]
Zu Grandvilles Darstellung von Maschinen ist nützlich zu vergleichen, wie Chevalier noch 1852 von der Eisenbahn spricht. Er berechnet, daß zwei Lokomotiven von zusammen 400 Pferdekräften der Kraft von 800 wirklichen Pferden entsprechen würden. Wie soll man sie anschirren? wie sich das Futter für sie beschaffen? Und in einer Anmerkung hierzu: »Il faut tenir compte aussi de ce que des chevaux de chair et d’os sont forcés de se reposer après un court trajet; de sorte que, pour faire le même service qu’une locomotive, il faudrait avoir à l’écurie un très grand nombre de bêtes.« Michel Chevalier; Chemins de fer Extrait du dictionnaire de l’économie politique Paris 1852 p 10 [G 14 a, 1]
Die Anordnungsprinzipien der Ausstellungsgegenstände in der Galerie des machines von 1867 stammen von Le Play. [G 14 a, 2]
Eine divinatorische Darstellung der architektonischen Aspekte der späteren Weltausstellungen findet sich in Gogols Essay »Über die Architektur unserer Zeit«, der Mitte der dreißiger Jahre in seinem Sammelband »Arabesken« erschien. »Quand donc, – s’écrie-t-il – en finira-t-on avec cette manière scolastique d’imposer à tout ce qu’on construit un goût commun et une commune mesure? Une ville doit comprendre une grande diversité de masses, si nous voulons qu’elle donne de la joie aux yeux. Puissent s’y marier les goûts les plus contraires! Que dans une seule et même rue s’y élèvent un sombre édifice gothique, un bâtiment décoré dans le goût le plus riche de l’Orient, une colossale construction égyptienne, une demeure grecque aux harmonieuses proportions! Que l’on y voie côte à côte la coupole lactée légèrement concave, la haute flèche religieuse, la mitre orientale, le toit plat d’Italie, le toit de Flandre escarpé et chargé d’ornements, la pyramide tétraédrique, la colonne ronde, l’obélisque anguleux!« Nicolas Gogol: Sur l’architecture du temps présent cit Wladimir Weidlé: Les abeilles d’Aristée Paris 〈1936〉 p 162/163 (L’agonie de l’art) [G 14 a, 3]
Fourier beruft sich auf die Volksweisheit, die die Zivilisation seit langem als le monde à rebours gekennzeichnet habe. [G 14 a, 4]
Fourier läßt es sich nicht nehmen, ein Gelage an den Ufern des Euphrat zu beschreiben, bei dem sowohl die Sieger im Wettbewerb der eifrigen Deicharbeiter (600 000) wie die in einem gleichzeitigen Kuchenbackwettbewerb gefeiert werden. Die 600 000 Industrieathleten bemächtigen sich der 300 000 Champagnerflaschen, deren Pfropfen sie auf ein Signal von der tour d’ordre her gleichzeitig herausschnellen lassen. Echo in den »Bergen des Euphrat«, cit 〈Armand et〉 Maubl〈anc Fourier Paris 1937〉 II p 178/ 179 [G 14 a, 5]
»Pauvres étoiles! leur rôle de splendeur n’est qu’un rôle de sacrifice. Créatrices et servantes de la puissance productrice des planètes, elles ne la possèdent point elles-mêmes, et doivent se résigner à leur carrière ingrate et monotone de flambeaux. Elles ont l’éclat sans la jouissance; derrière elles, se cachent invisibles les réalités vivantes. Ces reines-esclaves sont cependant de la même pâte que leurs heureuses sujettes … Maintenant flammes éblouissantes, ils seront un jour ténèbres et glaces, et ne pourront renaître à la vie que planètes, après le choc qui volatilisera le cortège et sa reine en nébuleuse.« A Blanqui: L’éternité par les astres Paris 1872 p 69/70 vgl Goethe: »Euch bedaur’ ich, unglückselge Sterne« [G 15, 1]
»La sacristie, la bourse et la caserne, ces trois antres associés pour vomir sur les nations la nuit, la misère et la mort. Octobre 1869.« Auguste Blanqui: Critique sociale Paris 1885 II Fragments et notes p 351 [G 15, 2]
»Un riche mort, c’est un gouffre fermé.« In den fünfziger Jahren. Auguste Blanqui: Critique sociale Paris 1885 II Fragments et notes p 315 [G 15, 3]
Ein image d’Epinal von Sellerie stellt die Exposition universelle von 1855 dar. [G 15, 4]
Rauschhafte Elemente im Detektivroman, dessen Mechanismus (in einer an die Umwelt des Haschischessers erinnernden Weise) von Caillois folgendermaßen beschrieben wird: »Les caractères de la pensée enfantine, l’artificialisme en premier lieu, régissent cet univers étrangement présent; rien ne s’y passe qui ne soit prémédité de longue date, rien n’y répond aux apparences, tout y est préparé pour être utilisé au bon moment par le héros tout-puissant qui en est le maître. On a reconnu le Paris des livraisons de Fantômas.« Roger Caillois: Paris, mythe moderne (Nouvelle Revue Française XXV 284 1 mai 1937 p 688) [G 15, 5]
»Je vois chaque jour passer sous ma fenêtre un certain nombre de Kalmouks, d’Osages, d’indiens, de Chinois et de Grecs antiques, tous plus ou moins parisianisés.« Charles Baudelaire: Œuvres 〈Texte établi et annoté par Y.-G. Le Dantec Paris 1932〉 II p 99 (Salon de 1846 – De l’Idéal et du Modèle) [G 15, 6]
Publicité im Empire nach Ferdinand Brunot: Histoire de la langue française des origines à 1900 IX La Révolution et l’Empire 9 Les événements, les institutions et la langue Paris 1937: »Nous imaginerions volontiers qu’un homme de génie a conçu l’idée d’employer, en les enchâssant dans la banalité de la langue vulgaire, des vocables faits pour séduire lecteurs et acheteurs, et qu’il a choisi le grec non seulement parce qu’il fournissait d’inépuisables ressources à la formation, mais parce que, moins familier que le latin, il avait l’avantage d’être … incompréhensible à une génération très peu versée dans l’étude de la Grèce antique … Seulement nous ne savons ni comment cet homme s’appelle, ni s’il est français, ni même s’il a existé. Il se peut que … les mots grecs aient gagné de proche en proche, jusqu’au jour où … l’idée générale … s’est dégagée … qu’ils étaient, par leur propre et seule vertu, une réclame … Pour moi, je croirais volontiers que … plusieurs générations, plusieurs nations ont contribué à créer l’enseigne verbale, le monstre grec qui attire en surprenant. Je crois que l’époque dont je m’occupe ici est celle où le mouvement a commencé à se prononcer … L’âge de l’huile comagène allait venir.« p 1229/1230 (Les causes du triomphe du grec) [G 15 a, 1]
»Que dirait un Winckelmann moderne … en face d’un produit chinois, produit étrange, bizare, contourné dans sa forme, intense par sa couleur, et quelquefois délicat jusqu’à l’évanouissement? Cependant c’est un échantillon de la beauté universelle; mais il faut, pour qu’il soit compris, que le critique, le spectateur opère en lui-même une transformation qui tient du mystère, et que, par un phénomène de la volonté agissant sur l’imagination, il apprenne de lui-même à participer au milieu qui a donné naissance à cette floraison insolite.« Weiter unten figurieren auf der gleichen Seite »ces fleurs mystérieuses dont la couleur profonde entre dans l’œil despotiquement, pendant que leur forme taquine le regard.« Charles Baudelaire: Œuvres 〈éd Le Dantec Paris 1932〉 II p 144/145 (Exposition universelle de 1855) [G 15 a, 2]
»Dans la poésie française, et celle même de toute l’Europe, le goût et les tons de l’Orient n’ont été, jusqu’à Baudelaire, qu’un jeu tant soit peu puéril et factice. Avec Les fleurs du mal, la couleur étrangère ne va pas sans le sens aigu de l’évasion. Baudelaire … s’invite à l’absence … Baudelaire en voyage donne l’émotion de la … nature inconnue où le voyageur se quitte lui-même … Il ne change sans doute pas d’esprit; mais c’est une vision nouvelle de son âme qu’il présente. Elle est tropicale, elle est africaine, elle est noire, elle est esclave. Voilà de vrais pays, une Afrique reélle et des Indes authentiques.« André Suarès: Préface in [Charles Baudelaire: Les fleurs du mal Paris 1933] p XXV-XXVII [G 16, 1]
Prostitution des Raumes im Haschisch, wo er allem Gewesenen dient. [G 16, 2]
Grandvilles Maskierung der Natur – des Kosmos sowohl wie der Tier- und Pflanzenwelt – im Sinne der um die Jahrhundertmitte herrschenden Mode läßt die Geschichte, in der Figur der Mode, aus dem ewigen Kreislaufe der Natur hervorgehen. Wenn Grandville einen neuen Fächer als éventail d’Iris vorstellt, wenn die Milchstraße eine nächtliche, von Gaskandelabern erhellte avenue darstellt, »la lune peinte par elle-même« statt auf Wolken auf neumodischen Plüschkissen liegt – so ist die Geschichte ebenso rücksich〈s〉los säkularisiert und in den Naturzusammenhang eingebracht wie das dreihundert Jahre früher die Allegorie vollzogen hat. [G 16, 3]
Die planetarischen Moden von Grandville sind ebensoviele Parodien der Natur auf die Geschichte der Menschheit. Die Harlekinaden von Grandville werden bei Blanqui zu Moritaten. [G 16, 4]
»Die Ausstellungen sind die einzigen eigenthümlich modernen Feste.« Hermann Lotze: Mikrokosmos III Lpz 1864 p? [G 16, 5]
Die Weltausstellungen waren die hohe Schule, in der die vom Konsum abgedrängten Massen die Einfühlung in den Tauschwert lernten. »Alles ansehen, nichts anfassen.« [G 16, 6]
Die Vergnügungsindustrie verfeinert und vervielfacht die Spielarten des reaktiven Verhaltens der Massen. Sie rüstet sie damit für die Bearbeitung durch die Reklame zu. Die Verbindung dieser Industrie mit den Weltausstellungen ist also wohlbegründet. [G 16, 7]
Urbanistischer Vorschlag für Paris: »Il conviendra de varier la forme des maisons et d’employer, suivant les quartiers, différens ordres d’architecture, et même ceux qui, tels qui l’architecture gothique, turque, chinoise, égyptienne, birmane, etc., ne sont point classiques.« Amédée de Tissot: Paris et Londres comparés Paris 1830 p 150 – Die spätere Ausstellungsarchitektur! [G 16 a, 1]
»Tant que cette infâme bâtisse [das palais de l’industrie] subsistera … j’aurai du plaisir à renier mon titre d’homme de lettres … L’art et l’industrie! Oui, c’est en effet pour eux, pour eux seuls, qu’on a réservé en 1855 cet inextricable réseau de galeries, où ces pauvres littérateurs n’ont pas même obtenu six pieds carrés, la place d’une pierre tumulaire! Gloire à toi, papetier … Monte au Capitole, imprimeur …! Triomphez, artistes, triomphez, industriels, vous avez eu les honneurs et le profit d’une Exposition universelle, tandis que cette pauvre littérature …« (p V/VI) »Une Exposition universelle pour les gens de lettres, un Palais de cristal pour les auteurs-modistes!« Einflüsterungen eines skurrilen Dämons, dem Babou seiner Lettre à Charles Asselineau zufolge eines Tages auf den Champs Elysées begegnet sein will. Hippolyte Babou: Les payens innocents Paris 1858 p XIV [G 16 a, 2]
Ausstellungen. »Solche vorübergehenden Veranstaltungen haben sonst keinen Einfluß auf die Gestaltung einer Stadt gehabt … In Paris … ist das anders. Und man kann gerade daran, daß hier die Riesenausstellungen mitten in die Stadt gestellt werden konnten und fast jede ein gut in das Stadtbild sich fügendes Bauwerk … zurückließ, den Segen einer großartigen Grundanlage und der fortwirkenden städtebaulichen Tradition erkennen. Paris konnte … auch die umfangreichste Ausstellung so legen, daß sie von der … Place de la Concorde zugänglich ist. Man hat an den Ufern, die von diesem Platz nach Westen führen, kilometerweit die Randbebauung so weit zurückgerückt, daß sehr breite Streifen zur Verfügung bleiben, die, mit vielen Reihen von Bäumen bestanden, die schönsten fertigen Ausstellungsstraßen geben.« Fritz Stahl: Paris Berlin 〈1929〉 p 62 [G 16 a, 3]
Der Sammler
»Toutes ces vielleries-là ont une valeur morale«
Charles Baudelaire»Je crois … à mon âme: la Chose«
Léon Deubel: Œuvres Paris 1929 p 193Hier war die letzte Unterkunft der Wunderkinder, die als Patentkoffer mit Innenbeleuchtung, als meterlanges Taschenmesser oder gesetzlich geschützter Schirmgriff mit Uhr und Revolver auf Weltausstellungen das Tageslicht erblickten. Und neben den entarteten Riesengeschöpfen die halbe, steckengebliebene Materie. Wir sind den schmalen, dunklen Gang gegangen bis zwischen einer librairie en solde, wo staubige verschnürte Konvolute von allen Formen des Konkurses reden und einem Laden mit lauter Knöpfen (Perlmutt und solchen, die man in Paris de fantaisie nennt) eine Art Wohnzimmer stand. Auf eine blaßbunte Tapete voll Bildern und Büsten schien eine Gaslampe. Bei der las eine Alte. Die ist da wie seit Jahren allein und will Gebisse »in Gold, in Wachs und zerbrochen«. Seit diesem Tage wissen wir auch, woher der Doktor Mirakel das Wachs nahm, aus dem er die Olympia verfertigt hat. □ Puppen □ [H 1, 1]
»La foule se presse au passage Vivienne, où elle ne se voit pas, et délaisse le passage Colbert, où elle se voit trop peut-être. Un jour on voulut la rappeler, la foule, en remplissant chaque soir la rotonde d’une musique harmonieuse, qui s’échappait invisible par les croisées d’un entresol. Mais la foule vint mettre le nez à la porte et n’entra pas, soupçonnant dans cette nouveauté une conspiration contre ses habitudes et ses plaisirs routiniers.« Le livre des Cent-et-un X Paris 1833 p 58 Vor fünfzehn Jahren suchte man ähnlich und ebenso vergeblich dem Warenhaus W. Wertheim aufzuhelfen. Man gab in der großen Passage, die es durchzog, Konzerte. [H 1, 2]
Dem, was die Dichter selbst von ihren Schriften sagen, soll man niemals trauen. Als Zola seine Thérèse Raquin gegen feindselige Kritiken verteidigen wollte, hat er erklärt, sein Buch sei eine wissenschaftliche Studie über die Temperamente. Es sei ihm nämlich darum zu tun gewesen, exakt an einem Beispiel zu entwickeln, wie das sanguinische und nervöse Temperament – zu beider Unheil – auf einander wirken. Bei dieser Mitteilung konnte niemandem wohl werden. Sie erklärt auch nicht den Einschlag von Kolportage, die Blutrünstigkeit, die filmgerechte Gräßlichkeit der Handlung. Sie spielt nicht umsonst in einer Passage. Wenn dieses Buch denn wirklich wissenschaftlich etwas entwickelt, so ist es das Sterben der pariser Passagen, der Verwesungsprozeß einer Architektur. Von seinen Giften ist die Atmosphäre dieses Buches schwanger, und an ihr gehen seine Menschen zu grunde. [H 1, 3]
1893 werden die Kokotten aus den Passagen vertrieben. [H 1, 4]
Musik scheint sich in diesen Räumen erst mit ihrem Untergange angesiedelt zu haben, erst als Musikkapellen selber sozusagen altmodisch zu werden begannen, weil die mechanische Musik im Aufkommen war. So daß sich also diese Kapellen in Wahrheit eher dahin geflüchtet hätten. (Das »Theatrophon« in den Passagen war gewissermaßen der Vorläufer des Grammophons.) Und doch gab es Musik im Geiste der Passagen, eine panoramatische Musik, die man jetzt nur noch in altmodisch-vornehmen Konzerten, etwa von der Kurkapelle in Monte-Carlo zu hören bekommt: die panoramatischen Kompositionen von David z. B. – Le désert, Christoph Colomb, Herculanum. Man war sehr stolz, als in den sechziger (?) Jahren eine politische Araberdeputation nach Paris kam, ihr »Le désert« in der großen Oper (?) vorspielen zu können. [H 1, 5]
»Cinéoramas; Grand Globe céleste, sphère gigantesque de 46 mètres de diamètre où l’on nous jouera de la musique de Saint-Saëns.« Jules Claretie: La vie à Paris 1900 Paris 1901 p 61 ■ Diorama ■ [H 1, 6]
Oft beherbergen diese Binnenräume veraltende Gewerbe und auch die durchaus aktuellen bekommen in ihnen etwas Verschollenes. Es ist der Ort der Auskunfteien und Ermittlungsinstitute, die da im trüben Licht der oberen Galerien der Vergangenheit auf der Spur sind. In den Auslagen der Friseurläden sieht man die letzten Frauen mit langen Haaren. Sie haben reich ondulierte Haarmassen, die »indéfrisables« sind, versteinerte Haartouren. Kleine Votivtafeln sollten sie denen weihen, die eine eigene Welt aus diesen Bauten machten, Baudelaire und Odilon Redon, dessen Name selbst wie eine allzugut gedrehte Locke fällt. Statt dessen hat man sie verraten und verkauft und das Haupt der Salome zum Einsatz gemacht, wenn das, was dort von der Konsole träumt, nicht das einbalsamierte der Anna Czillag ist. Und während diese versteinern ist oben das Mauerwerk der Wände brüchig geworden. Brüchig sind auch □ Spiegel □ [H 1 a, 1]
Es ist beim Sammeln das Entscheidende, daß der Gegenstand aus allen ursprünglichen Funktionen gelöst wird um in die denkbar engste Beziehung zu seinesgleichen zu treten. Diese ist der diametrale Gegensatz zum Nutzen und steht unter der merkwürdigen Kategorie der Vollständigkeit. Was soll diese »Vollständigkeit«〈?〉 Sie ist ein großartiger Versuch, das völlig Irrationale seines bloßen Vorhandenseins durch Einordnung in ein neues eigens geschaffenes historisches System, die Sammlung, zu überwinden. Und für den wahren Sammler wird in diesem Systeme jedwedes einzelne Ding zu einer Enzyklopädie aller Wissenschaft von dem Zeitalter, der Landschaft, der Industrie, dem Besitzer von dem es herstammt. Es ist die tiefste Bezauberung des Sammlers, das. Einzelne in einen Bannkreis einzuschließen, indem es, während ein letzter Schauer (der Schauer des Erworbenwerdens) darüber hinläuft, erstarrt. Alles Erinnerte, Gedachte, Bewußte wird Sockel, Rahmen, Postament, Verschluß seines Besitztums. Man muß nicht denken, daß gerade dem Sammler der τοπος ὑπερουρανιος, der nach Platon die unverwandelbaren Urbilder der Dinge beherbergt, fremd sei. Er verliert sich, gewiß. Aber er hat die Kraft, an einem Strohhalm sich von neuem aufzurichten und aus dem Nebelmeer, das seinen Sinn umfängt, hebt sich das eben erworbene Stück wie eine Insel. – Sammeln ist eine Form des praktischen Erinnerns und unter den profanen Manifestationen der »Nähe« die bündigste. Jeder kleinste Akt der politischen Besinnung macht also gewissermaßen im Antiquitätenhandel Epoche. Wir konstruieren hier einen Wecker, der den Kitsch des vorigen Jahrhunderts zur »Versammlung〈«〉 aufstört. [H 1 a, 2]
Erstorbene Natur: der Muschelladen der Passagen. Strindberg erzählt in den »Drangsalen des Lotsen〈«〉 von »einer Passage mit Laden, die erleuchtet waren«. »Dann ging er weiter in die Passage hinein … Da waren alle möglichen Arten Läden, doch nicht ein Mensch war zu sehen, weder hinter den Ladentischen noch davor. Als er eine Weile gegangen war, blieb er vor einem großen Fenster stehen, hinter welchem eine ganze Ausstellung von Schnecken zu sehen war. Da die Tür offen stand, trat er ein. Vom Boden bis zur Decke waren Gestelle mit Schnecken aller Art, aus den vielen Meeren der Erde gesammelt. Niemand war darin, aber es hing ein Tabakrauch wie ein Ring in der Luft … Und dann begann er wieder zu gehen, dem blau-weißen Läufer folgend. Die Passage war nicht gerade, sondern lief in Krümmungen, so daß man nie das Ende sah; und immer waren da neue Läden, aber kein Volk; und die Ladeneigentümer waren nicht zu sehen.« Die Unabsehbarkeit der ausgestorbenen Passagen ist ein bezeichnendes Motiv. Strindberg: Märchen München und Berlin 1917 p 52/53, 59 [H 1 a, 3]
Man muß die »Fleurs du Mal« daraufhin durchgehen, wie die Dinge zur Allegorie erhoben werden. Der Gebrauch der Majuskel ist zu verfolgen. [H 1 a, 4]
Am Schlusse von »Matière et Mémoire« entwickelt Bergson, Wahrnehmung sei eine Funktion der Zeit. Würden wir – so darf man sagen – gewissen Dingen gegenüber gelassener, andern gegenüber schneller, nach einem andern Rhythmus, leben, so gäbe es nichts »Bestehendes« für uns sondern alles geschähe vor unsern Augen, alles stieße uns zu. So aber ergeht es mit den Dingen dem großen Sammler. Sie stoßen ihm zu. Wie er ihnen nachstellt und auf sie trifft, welche Veränderung in allen Stücken ein neues Stück, das hinzutritt, bewirkt, das alles zeigt ihm seine Sachen in ständigem Fluten. Hier betrachtet man die pariser Passagen als wären sie Besitztümer in der Hand eines Sammlers. (Im Grunde lebt der Sammler, so darf man sagen, ein Stück Traumleben. Denn auch im Traum ist der Rhythmus des Wahrnehmens und Erlebens derart verändert, daß alles – auch das scheinbar Neutralste – uns zustößt, uns betrifft. Um die Passagen aus dem Grunde zu verstehen, versenken wir sie in die tiefste Traumschicht, reden von ihnen so als wären sie uns zugestoßen.〈)〉 [H 1 a, 5]