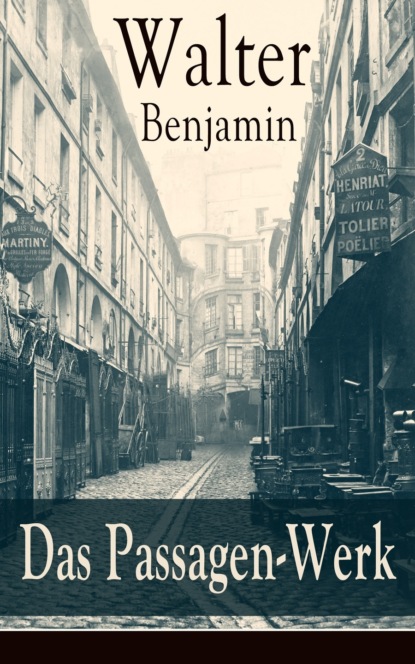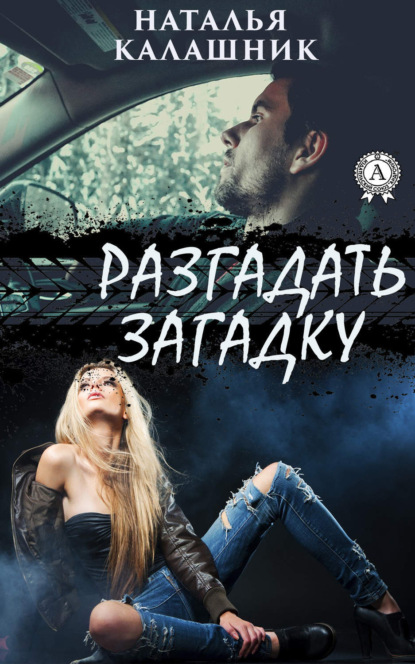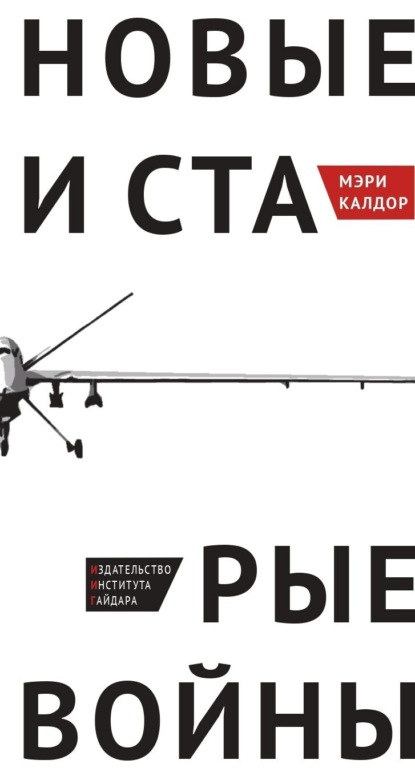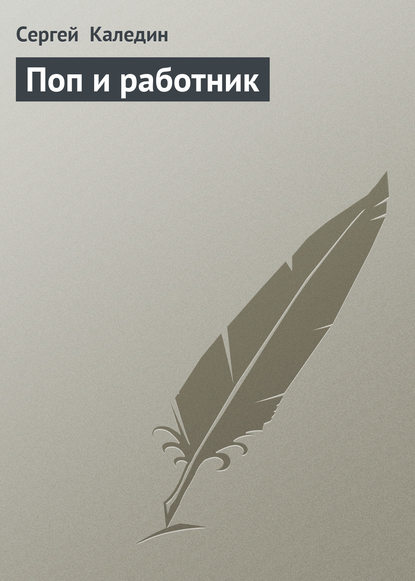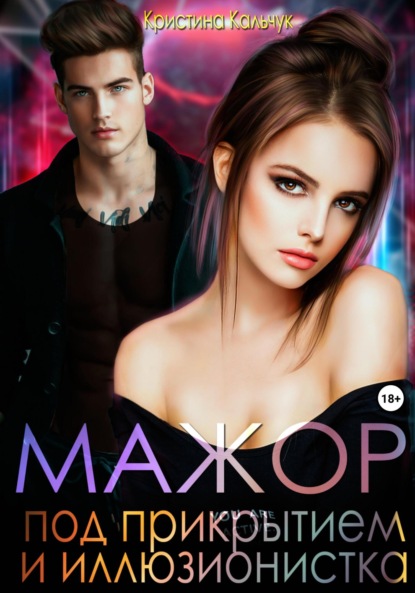- -
- 100%
- +
»L’intelligence de l’allégorie, prend en vous des proportions à vous-même inconnues; nous noterons, en passant, que l’allégorie, ce genre si spirituel, que les peintres maladroits nous ont accoutumés à mépriser, mais qui est vraiment l’une des formes primitives et les plus naturelles de la poésie, reprend sa domination légitime dans l’intelligence illuminée par l’ivresse.« Charles Baudelaire: Les paradis artificiels Paris 1917 p 73 (Aus dem, was folgt, ergibt sich unzweifelhaft, daß Baudelaire in der Tat die Allegorie, nicht das Symbol im Sinn hat. Die Stelle ist dem Kapitel vom Haschisch entnommen.) Der Sammler als Allegoriker □ Haschisch □ [H 2, 1]
»La publication de l’Histoire de la Société française pendant la Révolution et sous le Directoire ouvrit l’ère du bibelot, – et que l’on ne voie pas en ce mot une intention dépréciatrice; le bibelot historique jadis s’appela relique.« Rémy de Gourmont: Le IIe livre des Masques Paris 1924 p 259. Es ist von dem Werk der Brüder Goncourt die Rede. [H 2, 2]
Die wahre Methode, die Dinge sich gegenwärtig zu machen, ist, sie in unsere〈m〉 Raum (nicht uns in ihrem) vorzustellen. (So tut der Sammler, so auch die Anekdote.) Die Dinge, so vorgestellt, dulden keine vermittelnde Konstruktion aus »großen Zusammenhängen«. Es ist auch der Anblick großer vergangner Dinge – Kathedrale von Chartres, Tempel von Pästum – in Wahrheit (wenn er nämlich glückt) ein: sie in unserm Raum empfangen. Nicht wir versetzen uns in sie, sie treten in unser Leben. [H 2, 3]
Im Grunde ein recht sonderbares Faktum, daß Sammelgegenstände als solche industriell hergestellt wurden. Seit wann? Man hätte den verschiedenen Moden nachzugehen, die im 19ten Jahrhundert das Sammeln beherrscht haben. Charakteristisch für das Biedermeier – ob aber auch in Frankreich? – ist die Manie der Tassen. »Eltern, Kinder, Freunde, Verwandte, Vorgesetzte und Untergebene geben sich in Tassen ihre Gefühle kund, die Tasse ist das bevorzugte Geschenk, der beliebteste Zimmerschmuck; wie Friedrich Wilhelm III. sein Arbeitszimmer mit Pyramiden voller Porzellantassen füllte, so sammelte auch der Bürgersmann in seiner Servante in Tassen die Erinnerung an die wichtigsten Ereignisse, die wertvollsten Stunden seines Lebens.« Max von Boehn: Die Mode im XIX Jahrhundert II München 1907 p 136 [H 2, 4]
Besitz und Haben sind dem Taktischen zugeordnet und stehen in einem gewissen Gegensatz zum Optischen. Sammler sind Menschen mit taktischem Instinkt. Übrigens hat neuerdings mit der Abkehr vom Naturalismus der Primat des Optischen aufgehört, der das vorige Jahrhundert beherrscht. ■ Flaneur ■ Flaneur optisch, Sammler taktisch. [H 2, 5]
Gescheiterte Materie: das ist Erhebung der Ware in den Stand der Allegorie. Fetischcharakter der Ware und Allegorie. [H 2, 6]
Man mag davon ausgehen, daß der wahre Sammler den Gegenstand aus seinen Funktionszusammenhängen heraushebt. Aber das ist kein erschöpfender Blick auf diese merkwürdige Verhaltungsweise. Denn ist nicht dies die Grundlage, auf der eine im Kantischen und Schopenhauerschen Sinne »interesselose« Betrachtung sich aufbaut, dergestalt, daß der Sammler zu einem unvergleichlichen Blick auf den Gegenstand gelangt, einem Blick, der mehr und anderes sieht als der des profanen Besitzers und den man am besten mit dem Blick des großen Physiognomikers zu vergleichen hätte. Wie aber der auf den Gegenstand auftrifft, das hat man sich durch eine andere Betrachtung noch weit schärfer zu vergegenwärtigen. Man muß nämlich wissen: dem Sammler ist in jedem seiner Gegenstände die Welt präsent und zwar geordnet. Geordnet aber nach einem überraschenden, ja dem Profanen unverständlichen Zusammenhange. Der steht zu der geläufigen Anordnung und Schematisierung der Dinge ungefähr wie ihre Ordnung im Konversationslexikon zu einer natürlichen. Man erinnere doch nur, von welchem Belang für einen jeden Sammler nicht nur sein Objekt sondern auch dessen ganze Vergangenheit ist, ebensowohl die zu dessen Entstehung und sachlicher Qualifizierung gehört wie die Details aus dessen scheinbar äußerlicher Geschichte: Vorbesitzer, Erstehungspreis, Wert etc. Dies alles, die »sachlichen« Daten wie jene andern, rücken für den wahren Sammler in jedem einzelnen seiner Besitztümer zu einer ganzen magischen Enzyklopädie, zu einer Weltordnung zusammen, deren Abriß das Schicksal seines Gegenstandes ist. Hier also, auf diesem engen Felde, läßt sich verstehen, wie die großen Physiognomiker (und Sammler sind Physiognomiker der Dingwelt) zu Schicksalsdeutern werden. Man hat nur einen Sammler zu verfolgen, der die Gegenstände seiner Vitrine handhabt.
Kaum hält er sie in Händen, so scheint er inspiriert durch sie, scheint wie ein Magier durch sie hindurch in ihre Ferne zu schauen. (Interessant wäre den Büchersammler als den einzigen zu studieren, der seine Schätze nicht unbedingt aus ihrem Funktionszusammenhange gelöst hat.) [H 2, 7; H 2 a, 1]
Der große Sammler Pachinger, Wolfskehls Freund, hat eine Sammlung zustande gebracht, die im Verfemten, Verkommenen sich der Sammlung Figdor in Wien zur Seite stellen ließe. Er weiß kaum mehr, wie die Dinge im Leben stehen, erklärt seinen Besuchern neben den altertümlichsten Geräten Taschentücher, Handspiegel, etc. Von ihm erzählt man, wie er eines Tages über den Stachus ging, sich bückt, um etwas aufzuheben: Es lag da etwas, wonach er wochenlang gefahndet hatte: der Fehldruck eines Straßenbahnbilletts, das nur für ein paar Stunden im Verkehr gewesen war. [H 2 a, 2]
Eine Apologie des Sammlers dürfte nicht an diesen Invektiven vorbeigehen: »L’avarice et la vieillesse, remarque Gui Patin, sont toujours en bonne intelligence. Le besoin d’accumuler est un des signes avant-coureurs de la mort chez les individus comme dans les sociétés. On le constate à l’état aigu dans les périodes préparalytiques. Il y a aussi la manie de la collection, en neurologie ›le collectionnisme‹. / Depuis la collection d’épingles à cheveux jusqu’à la boîte en carton portant l’inscription: Petits bouts de ficelle ne pouvant servir à rien.« Les 7 péchés capitaux Paris 1929 p 26/27 (Paul Morand: L’avarice) vgl aber Sammeln bei Kindern! [H 2 a, 3]
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich so ganz und gar der Betrachtung dieses Erlebnisses hingegeben hätte, wenn ich nicht diese Unmenge phantastischer Dinge bunt durcheinandergewürfelt in dem Laden des Raritätenhändlers gesehen hätte. Sie drängten sich mir immer wieder auf, wenn ich an das Kind dachte, und, indem sie gleichsam unzertrennlich von ihm waren, führten sie mir die Lage dieses Geschöpfchens in greifbarer Deutlichkeit vor Augen. Ohne meiner Phantasie Zügel anzulegen, sah ich Nells Bild von allem umgeben, was ihrer Natur widersprach und den Wünschen ihres Alters und Geschlechts durchaus fernlag. Wenn mir diese Umgebung gefehlt und ich mir das Kind in einem ganz gewöhnlichen Zimmer hätte vorstellen müssen, in dem nichts Ungewöhnliches oder Unnatürliches gewesen wäre, dann hätte höchstwahrscheinlich ihr merkwürdiges und einsames Leben viel weniger Eindruck auf mich gemacht. So aber schien es mir, als lebte sie in einer Art Allegorie.« Charles Dickens: Der Raritätenladen Lpz ed Insel p 18/19 [H 2 a, 4]
Wiesengrund in einem ungedruckten Essay über den »Raritätenladen« von Dickens: »Nells Tod ist beschlossen in dem Satz: ›Es waren noch einige Kleinigkeiten dort, arme, wertlose Dinge, die sie wohl gerne hätte mitnehmen mögen –, aber es war unmöglich.‹ … Daß aber dieser Dingwelt, der verworfenen, verlorenen, die Möglichkeit des Übergangs und der dialektischen Rettung selbst innewohnt, hat Dickens erkannt und besser ausgesprochen, als es der romantischen Naturgläubigkeit jemals möglich wäre, in jener gewaltigen Allegorie des Geldes, welche die Darstellung der Industriestadt beschließt: ›… es waren zwei alte, abgeschliffene, rauchbraune Pennystücke. Wer weiß, ob sie nicht herrlicher leuchten in den Augen der Engel als die goldenen Buchstaben, die auf Grabsteinen eingemeißelt sind?‹« [H 2 a, 5]
»La plupart des amateurs composent leur collection en se laissant guider par la fortune, comme les bibliophiles en bouquinant … M. Thiers a procédé autrement: avant de réunir sa collection, il l’avait formée tout entière dans sa tête; il en avait dressé le plan, et ce plan, il a passé trente ans à l’exécuter … M. Thiers possède ce qu’il a voulu posséder … De quoi s’agissait-il? D’arranger autour de soi un abrégé de l’univers, c’est-à-dire de faire tenir dans un espace d’environ quatre-vingts mètres carrés, Rome et Florence, Pompéi et Venise, Dresde et la Haye, le Vatican et l’Escorial, le British-Museum et l’Ermitage, l’Alhambra et le Palais d’été … Eh bien, M. Thiers a pu réaliser une pensée aussi vaste avec des dépenses modérées, faites chaque année pendant trente ans … Voulant fixer avant tout sur les murailles de sa demeure les plus précieux souvenirs de ses voyages, M. Thiers fit exécuter … des copies réduites d’après les plus fameux morceaux de peinture … Aussi, en entrant chez lui, se trouve-t-on tout d’abord au milieu des chefs-d’œuvre éclos en Italie durant le siècle de Léon X. La paroi qui fait face aux fenêtres est occupée par le Jugement dernier, placé entre la Dispute du Saint-Sacrement et l’Ecole d’Athènes. L’Assomption du Titien décore le dessus de la cheminée, entre la Communion de saint Jérôme et la Transfiguration. La Madone de Saint-Sixte fait pendant à la Sainte Cécile, et dans les trumeaux sont encadrées les Sibylles de Raphaël, entre le Sposalizio et le tableau représentant Grégoire IX qui remet les Décrétales à un avocat du consistoire … Ces copies étant réduites à la même échelle ou à peu près … l’œil y retrouve avec plaisir la grandeur relative des originaux. Elles sont peintes à l’aquarelle.« Charles Blanc: Le cabinet de M. Thiers Paris 1871 p 16-18 [H 3, 1]
»Casimir Périer disait un jour, en visitant la galerie de tableaux d’un illustre amateur ›Tout cela est fort beau, mais ce sont des capitaux qui dorment.‹ … Aujourd’hui … on pourrait répondre à Casimir Périer … que … les tableaux …, quand ils sont bien authentiques; les dessins, lorsqu’on y reconnaît la griffe du maître … dorment d’un sommeil réparateur et profitable … La … vente des curiosités et des tableaux de M. R. …, a prouvé par chiffres que les œuvres de génie sont des valeurs aussi solides que l’Orléans et un peu plus sûres que les docks.« Charles Blanc: Le trésor de la curiosité II Paris 1858 p 578 [H 3, 2]
Der positive Gegentypus zum Sammler, der doch zugleich dessen Vollendung darstellt, insofern er die Befreiung der Dinge von der Fron, nützlich zu sein, verwirklicht, ist nach diesem Wort von Marx darzustellen: »Das Privateigentum hat uns so dumm und untätig gemacht, daß ein Gegenstand erst der unsrige ist, wenn wir ihn haben, also als Kapital für uns existiert, oder von uns … gebraucht wird.« Karl Marx: Der historische Materialimus Die Frühschriften hg von Landshut und Mayer Lpz 〈1932〉 I p 299 (Nationalökonomie und Philosophie) [H 3 a, 1]
»An die Stelle aller physischen und geistigen Sinne ist … die einfache Entfremdung aller dieser Sinne, der Sinn des Habens getreten … (Über die Kategorie des Habens siehe Heß in den ›21 Bogen‹.)« Karl Marx: Der historische Materialismus Lpz I p 300 (Nationalökonomie und Philosophie) [H 3 a, 2]
»Ich kann mich praktisch nur menschlich zu der Sache verhalten, wenn die Sache sich zum Menschen menschlich verhält.« Karl Marx: Der historische Materialismus Lpz I p 300 (Nationalökonomie und Philosophie) [H 3 a, 3]
Die Sammlungen Alexandre de Sommerards im Fond des Musée Cluny. [H 3 a, 4]
Das Quodlibet hat etwas vom Ingenium des Sammlers und des Flaneurs. [H 3 a, 5]
Vom Sammler werden latente archaische Besitzvorstellungen aktualisiert. Diese Besitzvorstellungen dürften in der Tat mit dem Tabu zusammenhängen, wie die folgende Bemerkung es andeutet: »Il … est … sûr que le tabou est la forme primitive de la propriété. D’abord émotivement et ›sincèrement‹, puis comme procédé courant et légal, le tabouage constituait un titre. S’approprier un objet, c’est le rendre sacré et redoutable pour tout autre que soi, le rendre ›participant‹ à soi-même.« N Guterman et H Lefebvre: La conscience mystifiée 〈Paris 1936〉 p 228 [H 3 a, 6]
Marxstellen aus »Nationalökonomie und Philosophie«: »Das Privateigentum hat uns so dumm und untätig gemacht, daß ein Gegenstand erst der unsrige ist, wenn wir ihn haben«. »An die Stelle aller physischen und geistigen Sinne ist … die einfache Entfremdung aller dieser Sinne, der Sinn des Habens, getreten.« cit Hugo Fischer: Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft Jena 1932 p 64 [H 3 a, 7]
Die Vorfahren von Balthazar Claës waren Sammler. [H 3 a, 8]
Modelle zum Cousin Pons: Sommerard, Sauvageot, Jacaze. [H 3 a, 9]
Die physiologische Seite des Sammelns ist wichtig. Bei der Analyse dieses Verhaltens ist nicht zu übergehen, daß das Sammeln beim Nestbau der Vögel eine eindeutige biologische Funktion übernimmt. Angeblich findet sich ein Hinweis darauf in Vasaris »Trattato sull’ Architectura«. Auch Pawlow soll sich mit dem Sammeln beschäftigt haben. [H 4, 1]
Vasari soll – im Trattato sull architectura? – behaupten, daß der Begriff »Groteske« von den Grotten komme, in denen Sammler ihre Schätze aufbewahren. [H 4, 2]
Das Sammeln ist ein Urphänomen des Studiums: der Student sammelt Wissen. [H 4, 3]
Über das Verhältnis des mittelalterlichen Menschen zu seinen Sachen führt Huizinga gelegentlich der Erläuterung des literarischen Genres »Testament« aus: »Diese literarische Form ist … nur verständlich, wenn man nicht vergißt, daß die mittelalterlichen Menschen tatsächlich daran gewohnt waren, durch ein Testament selbst über das Geringste[!] ihrer Besitztümer separat und ausführlich zu verfügen. Eine arme Frau vermachte ihr Sonntagskleid und ihre Kappe ihrem Kirchspiel; ihr Bett ihrem Patenkind, einen Pelz ihrer Pflegerin, ihren Alltagsrock einer Armen, und vier Pfund Turnosen [sic], die ihr Vermögen ausmachten, samt einem weiteren Kleid und einer Kappe den Minoriten. (Champion: Villon II p 182) Ist nicht auch hierin eine ganz triviale Äußerung derselben Denkrichtung zu erkennen, die jeden Fall von Tugendhaftigkeit als ein ewiges Beispiel aufstellte, die in jeder Gewohnheit eine gottgewollte Einrichtung sah?« J Huizinga: Herbst des Mittelalters München 1928 p 346 Was an dieser bemerkenswerten Stelle vor allem auffällt, ist, daß ein derartiges Verhältnis zu den Mobilien etwa im Zeitalter standardisierter Massenproduktion nicht mehr möglich wäre. Man käme damit von selbst auf die Frage, ob nicht die Argumentierungsformen, auf die der Verfasser anspielt, ja gewisse Denkformen der Scholastik überhaupt (Berufung auf die ererbte Autorität) mit den Produktionsformen zusammenhingen? Der Sammler, dem sich die Dinge durch sein Wissen um ihre Entstehung und ihre Dauer in der Geschichte anreichern, verschafft sich zu ihnen ein ähnliches Verhältnis, das nun archaisch wirkt. [H 4, 4]
Vielleicht läßt sich das verborgenste Motiv des Sammelnden so umschreiben: er nimmt den Kampf gegen die Zerstreuung auf. Der große Sammler wird ganz ursprünglich von der Verworrenheit, von der Zerstreutheit angerührt, in dem die Dinge sich in der Welt vorfinden. Das gleiche Schauspiel ist es gewesen, das die Menschen des Barockzeitalters so sehr beschäftigt hat; insbesondere ist das Weltbild des Allegorikers ohne das leidenschaftliche Betroffensein durch dieses Schauspiel nicht zu erklären. Der Allegoriker bildet gleichsam zum Sammler den Gegenpol. Er hat es aufgegeben, die Dinge durch die Nachforschung nach dem aufzuhellen, was etwa ihnen verwandt und zu ihnen gehörig wäre. Er löst sie aus ihrem Zusammenhange und überläßt es von Anfang an seinem Tiefsinn, ihre Bedeutung aufzuhellen. Der Sammler dagegen vereint das Zueinandergehörige; es kann ihm derart gelingen, über die Dinge durch ihre Verwandtschaften oder durch ihre Abfolge in der Zeit zu belehren. Nichtsdestoweniger aber steckt – und das ist wichtiger als alles, was etwa Unterscheidendes zwischen ihnen bestehen mag – in jedem Sammler ein Allegoriker und in jedem Allegoriker ein Sammler. Was den Sammler angeht, so ist ja seine Sammlung niemals vollständig; und fehlte ihm nur ein Stück, so bleibt doch alles, was er versammelt hat, eben Stückwerk, wie es die Dinge für die Allegorie ja von vornherein sind. Auf der andern Seite wird gerade der Allegoriker, für den die Dinge ja nur Stichworte eines geheimen Wörterbuches darstellen, das ihre Bedeutungen dem Kundigen verraten wird, niemals genug an Dingen haben, von denen eines das andere um so weniger vertreten kann, als keinerlei Reflexion die Bedeutung vorhersehen läßt, die der Tiefsinn jedwedem von ihnen zu vindizieren vermag. [H 4 a, 1]
Tiere (Vögel, Ameisen), Kinder und Greise als Sammler. [H 4 a, 2]
Eine Art von produktiver Unordnung ist der Kanon der mémoire involontaire wie auch des Sammlers. »Et ma vie était déjà assez longue pour qu’à plus d’un des êtres qu’elle m’offrait, je trouvasse dans des régions opposées de mes souvenirs un autre être pour le compléter … Ainsi un amateur d’art à qui on montre le volet d’un rétable, se rappelle dans quelle église, dans quel musée, dans quelle collection particulière, les autres sont dispersés; (de même qu’en suivant les catalogues des ventes ou en fréquentant les antiquaires, il finit par trouver l’objet jumeau de celui qu’il possède et qui fait avec lui la paire, il peut reconstituer dans sa tête la prédelle, l’autel tout entier).« Marcel Proust: Le temps retrouvé Paris II p 158 Die mémoire volontaire dagegen ist eine Registratur, die den Gegenstand mit einer Ordnungsnummer versieht, hinter der er verschwindet. »Da wären wir nun gewesen.« (»Es war mir ein Erlebnis.«) In welcher Art von Beziehung die Zerstreutheit der allegorischen Requisiten (des Stückwerks) zu dieser schöpferischen Unordnung steht, bleibt zu untersuchen. [H 5, 1]
Das Interieur, die Spur
»En 1830, le romantisme triomphait dans la littérature. Il envahit l’architecture et placarda sur la façade des maisons un gothique de fantaisie, plaqué trop souvent en carton-pierre. Il s’imposa à l’ébénisterie. ›Tout à coup, dit le rapporteur de l’exposition de 1834, on s’est pris d’enthousiasme pour des ameublements à formes étranges: on les a tirés des vieux châteaux, des antiques garde-meubles et des dépôts de friperie, afin d’en parer des salons, modernes pour tout le reste …‹ Les fabricants s’en inspiraient et prodiguaient dans leurs meubles ›les ogives et les machicoulis‹: on voyait des lits et des armoires hérissés de créneaux, comme des forteresses du XIIIe siècle.« E. Levasseur: l. c. 〈Histoire des classes ouvrières et de l’industrie en France de 1789 à 1870 Paris 1904〉 II p 206/207 [I 1, 1]
Bei Behne anläßlich eines Ritterschrankes die gute Bemerkung: »Das Mobiliar hat sich ganz deutlich aus dem Immobiliar entwickelt.« Weiter wird der Schrank verglichen mit einem »mittelalterlichen Befestigungswerk. Wie dieses Mauern und Wälle und Gräben in immer mehr sich erweiternden Ringen als ein gewaltiges Außenwerk um ein bißchen Wohninhalt herumlegt, so ist auch hier der Schubfach- und Ladeninhalt unter einem mächtigen Außenwerk erdrückt.« Adolf Behne: Neues Wohnen, neues Bauen Lpz 1927 p 59, 61/62 [I 1, 2]
Die Wichtigkeit des Mobiliars neben dem Immobiliar. Hier ist, was zu bewältigen uns aufgegeben ist, um ein geringes leichter. Leichter, ins Herz der abgeschafften Dinge vorzustoßen, um die Konturen des Banalen als Vexierbild zu entziffern, aus den waldigen Eingeweiden einen versteckten »Wilhelm Tell« aufzustören, oder auf die Frage »Wo ist die Braut?« erwidern zu können. Vexierbilder als Schematismen der Traumarbeit hat längst die Psychoanalyse aufgedeckt. Wir aber sind mit solcher Gewißheit der Seele weniger als den Dingen auf der Spur. Den Totembaum der Gegenstände suchen wir im Dickicht der Urgeschichte auf. Die oberste, die allerletzte Fratze dieses Totembaumes ist der Kitsch. [I 1, 3]
Die Auseinandersetzung mit dem Mobiliar bei Poe. Ringen um das Erwachen aus dem Kollektivtraum. [I 1, 4]
Wie sich das Interieur gegen Gaslicht verteidigt hat: »Presque toutes les maisons neuves ont le gaz aujourd’hui; il brûle dans les cours intérieures et dans l’escalier, il n’a pas encore droit de cité dans les appartements; on l’admet dans l’antichambre, quelquefois même dans la salle à manger, mais on ne le reçoit pas dans le salon. Pourquoi? Il fane les tentures. C’est le seul motif qu’on ait pu me donner, et il n’a aucune valeur.« Du Camp: Paris V p 309 [I 1, 5]
Hessel spricht von der »träumerischen Zeit des schlechten Geschmacks«. Ja, diese Zeit war ganz auf den Traum eingerichtet, war auf Traum möbliert. Der Wechsel der Stile, das Gotische, Persische, Renaissance etc. das hieß: über das Interieur des bürgerlichen Speisezimmers schiebt sich ein Festsaal Cesare Borgias, aus dem Boudoir der Hausfrau steigt eine gotische Kapelle heraus, das Arbeitszimmer des Hausherrn spielt irisierend in das Gemach eines persischen Scheichs hinüber. Die Photomontage, die uns solche Bilder fixiert, entspricht der primitivsten Anschauungsform dieser Generationen. Nur langsam haben die Bilder, unter denen sie lebte, sich losgelöst und auf Inserate〈n〉, Etiketten, Affichen als die Figuren der Reklame sich niedergeschlagen. [I 1, 6]
Eine Serie von Lithographien um 18〈…〉 zeigte in einem verhangenen dämmernden Boudoir Frauen, wollüstig auf die Ottomane hingelagert, und diese Blätter trugen die Unterschrift: »Au bord du Tajo« »Au bord de la Néva« »Au bord de la Seine« und so fort. Der Guadalquivir, die Rhône, der Rhein, die Aare, die Tamise traten hier auf. Man glaube nicht, ein Nationalkostüm hätte diese weiblichen Figuren von einander unterschieden. Die »légende« unter diesen Frauenbildern hatte das Phantasiebild einer Landschaft über die dargestellten Innenräume zu zaubern. [I 1, 7]
Das Bild jener Salons geben, in deren gebauschten Portieren und schwellenden Kissen der Blick sich verfing, in deren Standspiegeln Kirchenportale und in deren Causeusen Gondeln vor den Blicken der Gäste sich auftaten und auf die Gaslicht aus einer gläsernen Kugel herniederschien wie der Mond. [I 1, 8]
»Nous avons vu ce qui ne s’était encore jamais présenté: des mariages de style qu’on eut pu croire à jamais inmariables; des chapeaux premier Empire ou Restauration avec des jaquettes Louis XV; des robes Directoire avec des bottines à hauts talons – mieux encore, des redingotes à taille basse enfilées sur des robes à taille haute.« John Grand-Carteret: Les élégances de la Toilette Paris p XVI [I 1 a, 1]
Name der verschiednen Eisenbahnwagen aus der Frühzeit der Eisenbahn: berlines (fermée und ouverte), diligences, wagons garnis, wagons non garnis. □ Eisenkonstruktion □ [I 1 a, 2]
»In diesem Jahre war auch der Frühling früher und schöner denn je gekommen, so daß wir uns wirklich kaum mehr recht erinnern können, ob es hier denn eigentlich überhaupt Winter wird, und ob die Kamine zu etwas Anderm da sind, als die schönen Pendulen und Candelaber darauf zu setzen, die ja bekanntlich hier in keinem Zimmer fehlen dürfen; denn der ächte Pariser ißt lieber täglich ein Gericht weniger, nur um seine ›garniture de cheminée‹ zu haben.« Lebende Bilder aus dem modernen Paris 4 Bde Köln 1863/66 Bd II p 369 (Ein kaiserliches Familienbild) [I 1 a, 3]
Schwellenzauber. Vorm Eingang der Eisbahn, des Bierlokals, des Tennisplatzes, der Ausflugsorte: Penaten. Die Henne, die goldene Pralinéeier legt, der Automat, der unsere Namen stanzt, Glücksspielapparate, Wahrsage- und vor allem Wiegeautomaten: das zeitgemäße delphische γνωϑι σεαυτον hüten die Schwelle. Sie gedeihen bemerkenswerterweise nicht in der Stadt – machen einen Bestandteil der Ausflugsorte, der Biergärten in den Vorstädten. Und die Reise geht sonntagnachmittags nicht nur dahin, nicht nur ins Grüne, sondern auch zu den geheimnisvollen Schwellen. Verborgner waltet dieser gleiche Zauber freilich auch im Interieur der Bürgerwohnung. Stühle, die eine Schwelle, Photos die den Türrahmen flankier〈en〉, sind verkommene Hausgötter und die Gewalt, die sie zu beschwichtigen haben, trifft uns noch heute mit den Klingeln ins Herz. Versuche man doch, ihr zu widerstehen. Allein, in einer Wohnung, einem beharrlichen Klingeln nicht zu folgen. Man wird finden, es ist so schwer wie ein Exorzismus. Wie alle magische Substanz ist auch diese wieder irgendwann, als Pornographie, in den Sexus herabgesunken. Um 1830 freute sich Paris an schlüpfrigen Lithos mit verschiebbaren Türen und Fenstern. Es waren die »Images dites à portes et à fenêtres« von Numa Bassajet. [I 1 a, 4]
Zum träumerischen, womöglich orientalischen Interieur: »Alles träumt hier von plötzlichem Glück, Alles will mit einem Schlage haben, woran man in friedlichen und fleißigen Zeiten die ganze Kraft seines Lebens setzte. Die Erfindungen der Dichter sind voll von plötzlicher Umgestaltung häuslicher Existenzen, Alles schwärmt von Marquisinnen, Prinzessinnen, von den Wundern der Tausend und einen Nacht. Es ist ein Opiumrausch, der das ganze Volk ergriffen hat. Die Industrie hat hierin noch mehr verdorben, als die Poesie. Die Industrie hat den Aktienschwindel erzeugt, die Exploitationen aller möglichen Dinge, die man zu künstlichen Bedürfnissen machen wollte, und die … Dividenden.« Gutzkow: Briefe aus Paris 〈Leipzig 1842〉 I p 93 [I 1 a, 5]