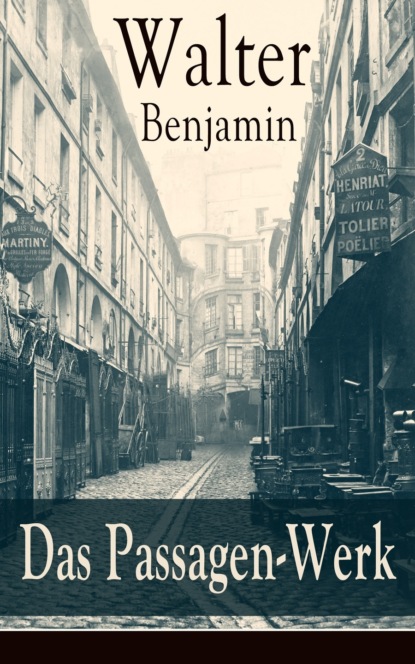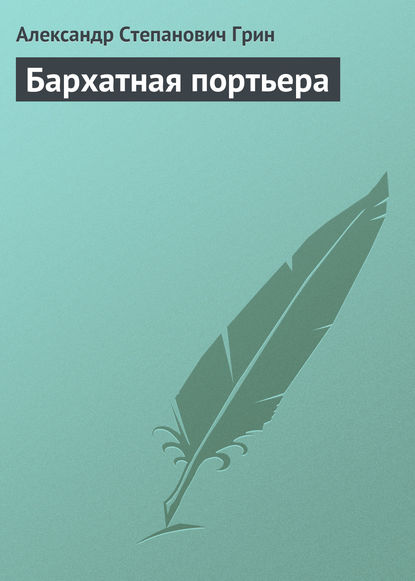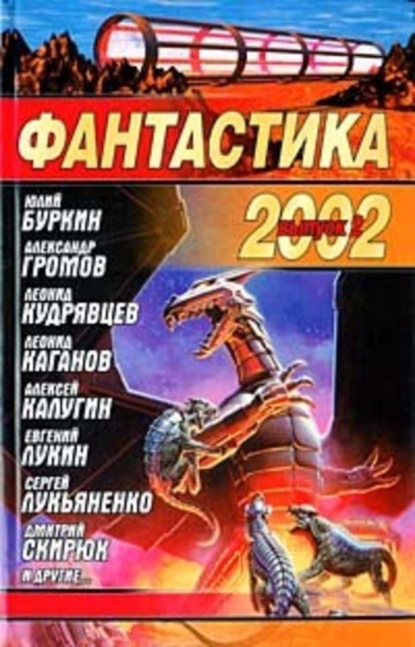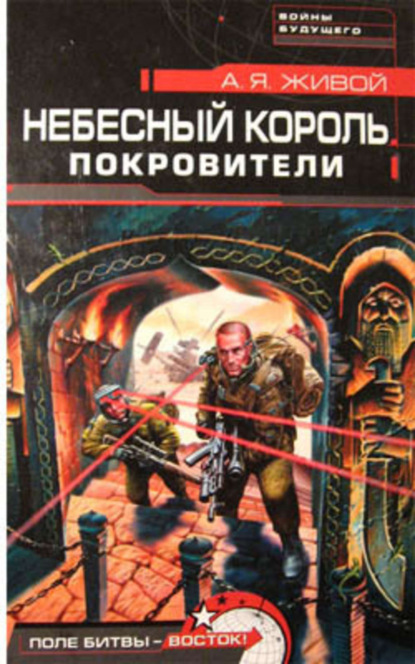- -
- 100%
- +
Zur medizinischen Diskussion über die Krinoline: Man meinte sie, wie den Reifrock »rechtfertigen zu können mit der angenehmen, zweckmäßigen Kühle, welche die Glieder darunter genießen … man will [also] auf Seiten der Mediciner wissen, daß jene so belobte Kühle schon Erkältungen mit sich gebracht habe, welche ein verderblich vorschnelles Ende eines Zustandes herbeiführten, den zu verhüllen der ursprüngliche Zweck der Crinoline sei.« F. Th. Vischer: Kritische Gänge Neue Folge Drittes Heft Stuttgart 1861 p 100 [Vernünftige Gedanken über die jetzige Mode] [B 2 a, 2]
Es war »verrückt, daß die französische Mode der Revolutions- und ersten Kaiserzeit mit modern geschnittenen und genähten Kleidern das griechische Verhältnis nachahmte.« Vischer: Vernünftige Gedanken über die jetzige Mode p 99 [B 2 a, 3]
Gestrickter Halsshawl – Cache-nez-Bajadere – in unansehnlichen Farben auch von Männern getragen. [B 2 a, 4]
F. Th. Vischer über die Mode der weiten, übers Gelenk fallenden Ärmeln bei Männerkleidern: »Das sind nicht mehr Arme, sondern Flügelrudimente, Pinguinsflügelstümpfe, Fischflossen und die Bewegung der formlosen Anhängsel im Gang sieht einem thörichten, simpelhaften Fuchteln, Schieben, Nachjücken, Rudern gleich.« Vischer: Vernünftige Gedanken über die jetzige Mode p 111 [B 2 a, 5]
Bedeutende politische Kritik der Mode vom bürgerlichen Standpunkt: »Als der Verfasser dieser vernünftigen Gedanken den ersten Jüngling mit dem allermodernsten Hemdkragen auf der Eisenbahn einsteigen sah, so meinte er alles Ernstes, einen Pfaffen zu sehen; denn dieser weiße Streifen läuft ja in gleicher Höhe niedrig um den Hals, wie das bekannte Collar des katholischen Clerus, und der lange Kittel war zudem schwarz. Als er den Weltmenschen neuester Mode erkannt hatte, begriff er, was auch dieser Hemdkragen heißen will: O, uns ist Alles, Alles Eins, auch die Concordate! Warum nicht? Sollen wir für Aufklärung schwärmen wie edle Jünglinge? Ist nicht Hierarchie vornehmer, als die Plattheit seichter Geisterbefreiung, die am Ende immer darauf geht, den noblen Menschen im Genusse zu stören? – Zudem gibt dieser Kragen, da er den Hals in gerader, scharfer Linie rund umschneidet, so etwas angenehm frisch Geköpftes, was so recht zum Charakter des Blasirten stimmt.« Dazu kommt die heftige Reaktion gegen das Violett. Vischer: Vernünftige Gedanken über die jetzige Mode p 112 [B 2 a, 6]
Zur Reaktion von 1850/60: »Farbe bekennen gilt für lächerlich, straff sein für kindisch; wie sollte da die Tracht nicht auch farblos, schlaff und eng zugleich werden?« Vischer 117 So bringt er die Krinoline auch in Verbindung mit dem erstarkten »Imperialismus, der sich breit und hohl ausspannt wie dieses sein Bild, der als letzter und stärkster Ausdruck der Zurückschwellung aller Tendenzen des Jahres 1848 seine Macht wie eine Glocke über Gutes und Schlimmes, Berechtigtes und Unberechtigtes der Revolution gestürzt hat.« p 119 [B 2 a, 7]
»Im Grund sind diese Dinge eben frei und unfrei zugleich. Es ist ein Helldunkel, worin Nöthigung und Humor sich durchdringen … Je phantastischer eine Form, desto stärker geht neben dem gebundenen Willen das klare und ironische Bewußtsein her. Und dieses Bewußtsein verbürgt uns, daß die Thorheit nicht dauern werde; je mehr es wächst, desto näher ist die Zeit, wo es wirkt, zur That wird, die Fessel abwirft.« Vischer p 122/123 [B 2 a, 8]
Eine der wichtigsten Stellen zur Beleuchtung der exzentrischen, revolutionären und surrealistischen Möglichkeiten der Mode, vor allem auch eine Stelle die eben damit den Zusammenhang des Surrealismus mit Grandville etc herstellt, ist das Kapitel Mode in Apollinaires Poète assassiné Paris 1927 p 74 ff [B 2 a, 9]
Wie die Mode allen folgt: Für Gesellschaftskleider kamen Programme auf wie für die neueste Symphoniemusik. 1901 stellte Victor Prouvé in Paris eine große Toilette aus mit dem Titel: Flußufer im Frühling. [B 2 a, 10]
Cachet der damaligen Mode: einen Körper anzudeuten, der überhaupt niemals völlige Nacktheit kennen lernt. [B 3, 1]
»Erst um 1890 findet man, daß die Seide nicht mehr für das Straßenkleid das vornehmste Material ist, und weist ihr dafür eine bis dahin unbekannte Bedeutung als Futterstoff zu. Die Kleidung von 1870 bis 1890 ist außerordentlich kostbar, und die Änderungen der Mode beschränken sich daher vielfach sehr vorsichtig auf Änderungen, denen die Absicht innewohnt, durch Umarbeitung des alten Kleides gewissermaßen ein neues Kleid zu gewinnen.« 70 Jahre deutsche Mode 1925 p 71 [B 3, 2]
»1873 … wo die riesigen über die auf das Gesäß aufgebundenen Kissen sich spannenden Röcke mit ihren gerafften Gardinen, plissierten Rüschen, Besätzen und Bändern weniger aus der Werkstatt eines Schneiders als eines Tapeziers zu stammen scheinen.« J. W. Samson: Die Frauenmode der Gegenwart Berlin und Köln 1927 p 8/9 [B 3, 3]
Keine Art von Verewigung so erschütternd wie die des Ephemeren und der modischen Formen, die die Wachsfigurenkabinette uns aufsparen. Und wer sie einmal sah, der muß wie André Breton sein Herz an die Frauengestalt im Musée Grévin verlieren, die im Winkel einer Loge ihr Strumpfband richtet. (Nadja (Paris 1928) p 199) [B 3, 4]
»Die Blumen-Garnierungen aus großen weißen Lilien oder Wasserrosen mit den langen Schilfgraszweigen, welche sich so graziös in jedem Haarputz zeigen, erinnern unwillkürlich an zarte, leicht schwebende Sylphiden und Najaden – so wie sich die feurige Brunette nicht reizender schmücken kann, als mit den, zu anmuthigen Zweigen gewundenen Früchten: Kirschen, Johannisbeeren, ja Weintrauben mit Epheu und Grasblüthe vereint; oder: mit den langen Fuchsien aus brennend rotem Sammet, deren roth geäderte, wie vom Thau angehauchte Blätter sich zu einer Krone bilden; auch steht ihr der schönste Cactus Speciosus, mit langen weißen Federstaubfäden zu Gebote; überhaupt sind die Blumen zu den Haargarnierungen sehr groß gewählt – wir sahen eine solche aus weißen Cantifolien (Unica) malerisch schön mit großen Stiefmütterchen und Epheuzweigen, oder vielmehr Ästen, zusammengeflochten, denn es zeigte sich daran wirklich so täuschend das knorrige, rankige Geäst als hätte sich die Natur selbst hineingemischt – lange Knospenzweige und Halme wiegten sich an den Seiten bei der leisesten Berührung.« Der Bazar Dritter Jahrgang Berlin 1857 p 11 (Veronika von G.: Die Mode) [B 3, 5]
Der Eindruck des Altmodischen kann nur entstehen, wo auf gewisse Art an das Aktuellste gerührt wird. Wenn in den Passagen Anfänge der modernsten Baukunst liegen, so hat ihre altmodische Wirkung auf den heutigen Menschen genau soviel zu sagen wie das Antiquiert-Wirken des Vaters auf seinen Sohn. [B 3, 6]
Ich formulierte, »daß das Ewige jedenfalls eher eine Rüsche am Kleid ist, als eine Idee«. □ Dialektisches Bild □ [B 3, 7]
Im Fetischismus legt der Sexus die Schranken zwischen organischer und anorganischer Welt nieder. Kleidung und Schmuck stehen mit ihm im Bunde. Er ist im Toten wie im Fleisch zuhause. Auch weist das letztere selber ihm den Weg, im ersten sich einzurichten. Die Haare sind ein Konfinium, welches zwischen den beiden Reichen des Sexus gelegen ist. Ein anderes erschließt sich ihm im Taumel der Leidenschaft: die Landschaften des Leibs. Sie sind schon nicht mehr belebt, doch immer noch dem Auge zugänglich, das freilich je weiter desto mehr dem Tastsinn oder dem Geruch die Führung durch diese Todesreiche überläßt. Im Traum aber schwellen dann nicht selten Brüste, die wie die Erde ganz mit Wald und Felsen bekleidet sind und die Blicke haben ihr Leben in den Grund von Wasserspiegeln versenkt, die in Tälern schlummern. Diese Landschaften durchziehen Wege, die den Sexus in die Welt des Anorganischen geleiten. Die Mode selbst ist nur ein anderes Medium, das ihn noch tiefer in die Stoffwelt lockt. [B 3, 8]
»Cette année, dit Tristouse, la mode est bizarre et familière, elle est simple et pleine de fantaisie. Toutes les matières des différents règnes de la nature peuvent maintenant entrer dans la composition d’un costume de femme. J’ai vu une robe charmante, faite de bouchons de liège … Un grand couturier médite de lancer les costumes tailleur en dos de vieux livres, reliés en veau … Les arêtes de poisson se portent beaucoup sur les chapeaux. On voit souvent de délicieuses jeunes filles habillées en pèlerines de Saint-Jacques de Compostelle; leur costume, comme il sied, est constellé de coquilles Saint-Jacques. La porcelaine, le grès et la faïence ont brusquement apparu dans l’art vestimentaire … Les plumes décorent maintenant non seulement les chapeaux, mais les souliers, les gants, et l’an prochain on en mettra sur les ombrelles. On fait des souliers en verre de Venise et des chapeaux en cristal de Baccarat … J’oubliais de vous dire que, mercredi dernier, j’ai vu sur les boulevards une rombière vêtue de petits miroirs appliqués et collés sur un tissu. Au soleil, l’effet était somptueux. On eût dit une mine d’or en promenade. Plus tard il se mit à pleuvoir, et la dame ressembla à une mine d’argent … La mode devient pratique et ne méprise plus rien, elle ennoblit tout. Elle fait pour les matières ce que les romantiques firent pour les mots.« Guillaume Apollinaire: Le poète assassiné Nouvelle édition Paris 1927 p 75-77 [B 3 a, 1]
Ein Karikaturist stellt – um 1867 – das Gerüst der Krinoline als einen Käfig dar, in dem ein junges Mädchen Hühner und einen Papagei gefangen hält. S. Louis Sonolet: La vie parisienne sous le second empire Paris 1929 p 245 [B 3 a, 2]
»Les bains de mer … donnèrent le premier coup à la solennelle et encombrante crinoline.« Louis Sonolet: La vie parisienne sous le second empire Paris 1929 p 247 [B 3 a, 3]
»Die Mode besteht ja nur aus Extremen. Da sie von Natur aus die Extreme sucht, bleibt ihr nichts übrig, als sich beim Aufgeben einer bestimmten Form genau dem Gegenteil zu überliefern.« 70 Jahre deutsche Mode 1925 p 51 Ihre äußersten Extreme: die Frivolität und der Tod [B 3 a, 4]
»Wir hielten die Krinoline für das Symbol des zweiten Kaiserreichs in Frankreich, seiner aufgeblasenen Lüge, seiner windigen und protzigen Frechheit. Es stürzte … aber … die Pariser Welt hatte just vor dem Sturze des Kaiserreichs noch Zeit, in der weiblichen Mode eine andere Seite ihrer Stimmung hervorzukehren, und die Republik war sich nicht zu gut, sie aufzunehmen und zu behalten.« F. Th. Vischer: Mode und Cynismus Stuttgart 1879 p 6 Die neue Mode, auf die Vischer anspielt, erklärt er: »Das Kleid wird quer über den Leib geschnitten und spannt über … den Bauch«, (p 6) Später nennt er die Frauen, die sich so tragen »in Kleidern nackt«, (p 8) [B 3 a, 5]
Friedell erklärt mit Bezug auf die Frau, »daß die Geschichte ihrer Kleidung überraschend geringere Variationen aufweist und nicht viel mehr ist als ein Turnus einiger viel rascher wechselnder, aber auch viel häufiger wiederkehrender Nuancen: der Länge der Schleppe, der Höhe der Frisur, der Kürze der Ärmel, der Bauschung des Rockes, der Entblößung der Brust, des Sitzes der Taille. Selbst radikale Revolutionen wie das heutige knabenhaft geschnittene Haar sind nur die ›ewige Wiederkunft des Gleichen‹.« Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit III München 1931 p 88 So hebt sich nach dem Verfasser die weibliche Mode gegen die manni〈g〉faltigere und entschiednere männliche ab. [B 4, 1]
»Von allen Versprechungen, welche Cabets Roman, ›Reise nach Ikarien‹ gemacht, ist jedenfalls eine realisirt worden. Cabet hatte nämlich in dem Romane, den sein System enthielt, zu beweisen gesucht, daß der künftige communistische Staat kein Product der Phantasie enthalten und in Nichts irgend einen Wechsel erleiden dürfe; er hatte deshalb alle Moden und namentlich die capriciösen Priesterinnen der Mode, die Modistinnen, sowie die Goldarbeiter, und alle anderen Professionen, welche dem Luxus dienen, aus Ikarien verbannt und gefordert, daß die Trachten, Gerätschaften u. s. w. nie verändert werden sollen.« Sigmund Engländer: Geschichte der französischen Arbeiter-Associationen Hamburg 1864 II p 165/166 [B 4, 2]
1828 fand die Uraufführung der »Stummen von Portici« statt. Das ist eine wallende Musik, eine Oper aus Draperien, die sich über den Worten heben und senken. Sie mußte in einer Zeit Erfolg haben als die Draperien ihren Triumphzug (zunächst als türkische Shawls in der Mode) antraten. Diese Revolte, deren erste Aufgabe es ist, den König vor ihr selbst in Sicherheit zu bringen, erscheint als Vorspiel derjenigen von 1830 – einer Revolution, die doch wohl nur Draperie vor einem Revirement in den herrschenden Kreisen war. [B 4, 3]
Stirbt die Mode vielleicht – in Rußland z. B. – daran, daß sie das Tempo nicht mehr mitmachen kann – auf gewissen Gebieten zumindest? [B 4, 4]
Grandvilles Werke sind wahre Kosmogonien der Mode. Ein Teil seines œuvres ließe sich überschreiben: der Kampf der Mode mit der Natur. Vergleich zwischen Hogarth und Grandville. Grandville und Lautréamont. – Was hat die Hypertrophie des Mottos bei Grandville zu sagen? [B 4, 5]
»La mode … est un témoin, mais un témoin de l’histoire du grand monde seulement, car chez tous les peuples … les pauvres gens n’ont pas plus de modes que d’histoire et leurs idées, leurs goûts ni leur vie ne changent guère. Sans doute … la vie publique commence à pénétrer dans les petits ménages, mais il faudra du temps.« Eugène Montrue: Le XIXe siècle vécu par deux français Paris p 241 [B 4, 6]
Die folgende Bemerkung erlaubt, zu erkennen, welche Bedeutung die Mode als Tarnung ganz bestimmter Anliegen der herrschenden Klasse hat. »Die Herrschenden haben eine große Abneigung gegen starke Veränderungen. Sie möchten, daß alles so bleibt, am liebsten tausend Jahre. Am besten der Mond bliebe stehen und die Sonne liefe nicht weiter! Dann bekäme keiner mehr Hunger und wollte zu Abend essen. Wenn sie geschossen haben, so soll der Gegner nicht mehr schießen dürfen, ihr Schuß soll der letzte gewesen sein.« Bertolt Brecht: Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit (Unsere Zeit VIII 2/3 April 1935 Paris Basel Prag p 32) [B 4 a, 1]
Mac-Orlan, der die Analogien zum Surrealismus hervorhebt, die man 〈bei〉 Grandville findet, macht in diesem Zusammenhang auf das Werk von Walt Disney aufmerksam, von dem er sagt: »Il ne contient aucun germe de mortification. En ceci il s’éloigne de l’humeur de Grandville qui porta toujours en soi la présence de la mort.« Mac-Orlan: Grandville le précurseur (Arts et métiers graphiques 44 15 Dezember 1934 〈p 24〉) [B 4 a, 2]
»Zwei bis drei Stunden etwa dauert die Vorführung einer großen Kollektion. Je nach dem Tempo, an das die Mannequins gewöhnt wurden. Zum Schluß, das ist Tradition, erscheint eine verschleierte Braut.« Helen Grund: Vom Wesen der Mode p 19 (Privatdruck München 1935) In der erwähnten Gepflogenheit macht die Mode der Sitte eine Referenz, bedeutet ihr aber zugleich, daß sie vor ihr nicht halt macht. [B 4 a, 3]
Eine gegenwärtige Mode und ihre Bedeutung. Im Frühjahr 1935 ungefähr kamen in der Frauenmode mittelgroße à jour gearbeitete Metallplaketten auf, die auf dem Jumper oder dem Mantel getragen wurden und den Anfangsbuchstaben des Vornamens der Trägerin zeigten. Darin machte die Mode sich die vogue der Abzeichen zu nutze, die im Gefolge der ligues bei Männern sehr häufig geworden waren. Auf der andern Seite aber kommt damit die zunehmende Einschränkung der Privatsphäre zum Ausdruck. Der Name, und zwar der Vorname, der Unbekannten wird an einem Zipfel in die Öffentlichkeit gezogen. Daß damit die »Anknüpfung« einer Unbekannten gegenüber erleichtert wird, ist von sekundärer Bedeutung. [B 4 a, 4]
»Die Modeschöpfer … verkehren in der Gesellschaft und gewinnen aus ihrem Bild einen Gesamteindruck, sie nehmen Teil am künstlerischen Leben, sehen Premieren und Ausstellungen, lesen die sensationellen Bücher – mit anderen Worten, ihre Inspiration entzündet sich an den … Anregungen, … die eine bewegte Aktualität bietet. Da nun aber keine Gegenwart sich völlig von der Vergangenheit loslöst, bietet ihm auch die Vergangenheit Anregung … So läßt sich aber nur das verwenden, was in die Harmonie des modischen Klanges gehört. Das in die Stirn gerückte Hütchen, das wir der Manet-Ausstellung zu verdanken haben, beweist nichts anderes als daß wir eine neue Bereitschaft haben, uns mit dem Ende des vorigen Jahrhunderts auseinanderzusetzen.« Helen Grund: Vom Wesen der Mode 〈München 1935〉 p 13 [B 4 a, 5]
Über den Reklamekampf des Modenhauses und die Modejournalisten. »Es erleichtert seine Aufgabe, daß unsere Wünsche übereinstimmen.« (sc die der Modejournalisten) »Es erschwert sie aber auch, da keine Zeitung oder Zeitschrift das als neu ansehen mag, was eine andere schon gebracht hat. Aus diesem Dilemma können ihn und uns nur die Photographen und Zeichner retten, die einem Kleid durch Pose und Beleuchtung vielerlei Aspekte abgewinnen. Die wichtigsten Zeitschriften … haben eigene, mit allen technischen und künstlerischen Raffinements ausgestattete Photoateliers, die hochbegabte, spezialisierte Photographen leiten … Allen aber ist die Veröffentlichung dieser Dokumente vor dem Zeitpunkt verboten, zu dem die Kundin ihre Wahl getroffen hat, also gewöhnlich 4 bis 6 Wochen nach der Erstaufführung. Die Ursache für diese Maßregel? – Auch die Frau will sich mit dem Auftreten in der Gesellschaft in diesen neuen Kleidern den Effekt des Überraschenden nicht nehmen lassen.« Helen Grund: Vom Wesen der Mode p 21/22 (Privatdruck München 1935) [B 5, 1]
Dem Überblick über die six premières livraisons zufolge befindet sich in der von Stéphane Mallarmé herausgegebnen Zeitschrift »La dernière mode« Paris 1874 »une charmante esquisse sportive, résultat d’une conversation avec le merveilleux naturaliste Toussenel«. Abdruck dieses Überblicks in Minotaure (II) 6 Hiver 1935 〈p 27〉 [B 5, 2]
Eine biologische Theorie der Mode im Anschluß an die im »Kleinen Brehm« p 771 geschilderte Entwicklung des Zebras zum Pferde »die sich durch Millionen von Jahren hinzog … Die in den Pferden liegende Strebung ging auf die Schöpfung eines erstklassigen Renners und Läufers … Die ursprünglichsten Tiere der Gegenwart tragen eine ganz auffällige Streifenzeichnung. Es ist nun sehr merkwürdig, daß die äußeren Streifen des Zebras eine gewisse Übereinstimmung zeigen mit der Anordnung der Rippen und Wirbel im Innern. Auch kann man durch die besonders eigenartig angeordnete Streifung an Oberarm und Oberschenkel die Lage dieser Teile schon äußerlich bestimmen. Was bedeutet diese Streifung? Schützend wirkt sie sicher nicht … Ihre Streifen werden … erhalten, trotz ihrer ›Zweckwidrigkeit‹ und – daher müssen sie … eine besondere Bedeutung haben. Sollten wir es hier nicht mit äußeren auslösenden Reizen für innere Bestrebungen zu tun haben, die in der Paarungszeit besonders lebendig werden müssen? Was dürfen wir aus dieser Theorie für unser Thema übernehmen? – Mir scheint, etwas grundlegend Wichtiges. – Die ›sinnwidrige‹ Mode übernimmt, seit die Menschheit von der Nacktheit zur Kleidung übergegangen ist, die Rolle der weisen Natur … Indem nämlich die Mode in ihrem Wandel … eine dauernde Revision aller Teile der Gestalt anordnet … zwingt sie die Frau zu einer dauernden Bemühung um die Schönheit.« Helen Grund: Vom Wesen der Mode 〈München 1935〉 p 7/8 [B 5, 3]
Auf der pariser Weltausstellung von 1900 gab es ein Palais du Costume, in dem Wachspuppen vor gestellten Hintergründen die Trachten der Völker und die Moden der Zeiten zur Schau trugen. [B 5 a, 1]
»Nous, nous observons autour de nous … les effets de confusion et de dissipation que nous inflige le mouvement désordonné du monde moderne. Les arts ne s’accommodent pas de la hâte. Nos idéaux durent dix ans! L’absurde superstition du nouveau – qui a fâcheusement remplacé l’antique et excellente croyance au jugement de la postérité – assigne aux efforts le but le plus illusoire et les applique à créer ce qu’il y a de plus périssable, ce qui est périssable par essence: la sensation du neuf … Or, tout ce que l’on voit ici a été goûté, a séduit, a ravi, pendant des siècles, et toute cette gloire nous dit avec sérénité: JE NE SUIS RIEN DE NEUF. Le Temps peut bien gâter la matière que j’ai empruntée; mais tant qu’il ne m’a point détruite, je ne puis l’être par l’indifférence ou le dédain de quelque homme digne de ce nom.« Paul Valéry: Préambule (Exposition de l’art italien De Cimabue à Tiepolo Petit Palais 1935) p IV, VII [B 5 a, 2]
»Le triomphe de la bourgeoisie modifie le costume féminin. Le vêtement et la coiffure se développent en largeur … les épaules sont élargies par des manches à gigot, et … on ne tarda pas à remettre en faveur les anciens paniers et à se faire des jupons bouffants. Ainsi accoutrées, les femmes paraissaient destinées à la vie sédentaire, à la vie de famille, parce que leur manière de s’habiller n’avait rien qui donnât l’idée du mouvement ou qui parût le favoriser. Ce fut tout le contraire à l’avénement du second empire; les liens de famille se relâchèrent; un luxe toujours croissant corrompit les mœurs, au point qu’il devint difficile de distinguer, au seul caractère du vêtement, une femme honnête d’une courtisane. Alors la toilette féminine se transforma des pieds à la tête … Les paniers furent rejetés en arrière et se réunirent en croupe accentuée. On développa tout ce qui pouvait empêcher les femmes de rester assises; on écarta tout ce qui aurait pu gêner leur marche. Elles se coiffèrent et s’habillèrent comme pour être vues de profil. Or, le profil, c’est la silhouette d’une personne … qui passe, qui va nous fuir. La toilette devint une image du mouvement rapide qui emporte le monde.« Charles Blanc: Considérations sur le vêtement des femmes (Institut de France 25 oct〈obre〉 1872) p 12/13 [B 5 a, 3]
»Um das Wesen der heutigen Mode zu begreifen, darf man nicht auf Motive individueller Art zurückgreifen, wie es … sind: Veränderungslust, Schönheitssinn, Putzsucht, Nachahmungstrieb. Es ist zweifellos, daß diese Motive sich zu den verschiedensten Zeiten … an der Gestaltung der Kleidung … versucht haben … Aber die Mode in unserem heutigen Sinn hat keine individuellen Motive, sondern ein sociales Motiv, und auf der richtigen Erkenntniß desselben beruht das Verständniß ihres ganzen Wesens. Es ist das Bestreben der Abscheidung der höheren Gesellschaftsklassen von den niederen oder richtiger den mittleren … Die Mode ist die unausgesetzt von neuem aufgeführte, weil stets von neuem niedergerissene Schranke, durch welche sich die vornehme Welt von der mittleren Region der Gesellschaft abzusperren sucht, es ist die Hetzjagd der Standeseitelkeit, bei der sich ein und dasselbe Phänonem unausgesetzt wiederholt: das Bestreben des einen Theils, einen wenn auch noch so kleinen Vorsprung zu gewinnen, der ihn von seinem Verfolger trennt, und das des anderen, durch sofortige Aufnahme der neuen Mode denselben wiederum auszugleichen. Daraus erklären sich die charakteristischen Züge der heutigen Mode. Zuerst ihre Entstehung in den höheren Gesellschaftskreisen und ihre Nachahmung in den mittleren. Die Mode geht von oben nach unten, nicht von unten nach oben … Ein Versuch der mittleren Klassen, eine neue Mode aufzubringen, würde … niemals gelingen, den höheren würde nichts erwünschter sein, als wenn jene ihre eigene Mode für sich hätten. ([Anm.] Was sie aber gleichwohl nicht abhält, in der Kloake der pariser demi-monde nach neuen Mustern zu suchen und Moden aufzubringen, welche den Stempel ihres unzüchtigen Ursprungs deutlich an der Stirn tragen, wie Fr. Vischer in seinem … vielgetadelten, meines Erachtens aber … höchst verdienstlichen Aufsatz über die Mode … schlagend nachgewiesen hat.) Sodann der unausgesetzte Wechsel der Mode. Haben die mittleren Klassen die neuaufgebrachte Mode adoptirt, so hat sie … ihren Werth für die höheren verloren … Darum ist Neuheit die unerläßliche Bedingung der Mode … Die Lebensdauer der Mode bestimmt sich im entgegengesetzten Verhältnis zur Raschheit ihrer Verbreitung; ihre Kurzlebigkeit hat sich in unserer Zeit in demselben Maße gesteigert, als die Mittel zu ihrer Verbreitung durch unsere vervollkommneten Communicationsmittel gewachsen sind … Aus dem angegebenen socialen Motiv erklärt sich endlich auch der dritte charakteristische Zug unserer heutigen Mode: ihre … Tyrannei. Die Mode enthält das äußere Kriterium, daß man … ›mit zur Gesellschaft gehört‹. Wer darauf nicht verzichten will, muß sie mitmachen, selbst wenn er … eine neu aufgekommene Gestaltung derselben noch so sehr verwirft … Damit ist der Mode ihr Urtheil gesprochen … Gelangten die Stände, welche schwach und thöricht genug sind, sie nachzuahmen, zum Gefühl ihrer Würde und Selbstachtung, … so wäre es um die Mode geschehen, und die Schönheit könnte wiederum ihren Sitz aufschlagen, wie sie ihn bei allen Völkern behauptet hat, welche … nicht das Bedürfniß fühlten, die Standesunterschiede durch die Kleidung zu accentuiren oder, wo es geschah, verständig genug waren, sie zu respectiren.« Rudolph von Jhering: Der Zweck im Recht II Lpz 1883 p 234-238 [B 6; B 6 a, 1]