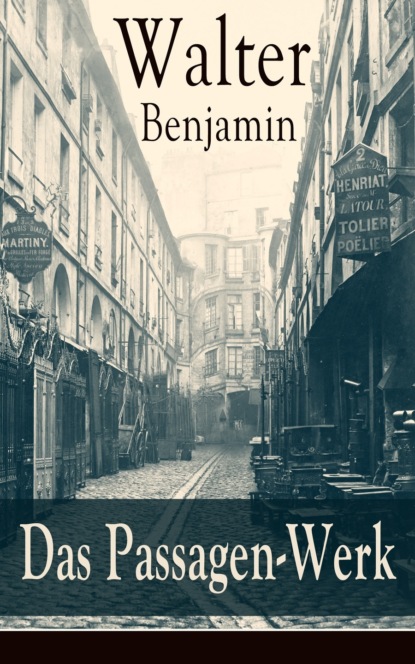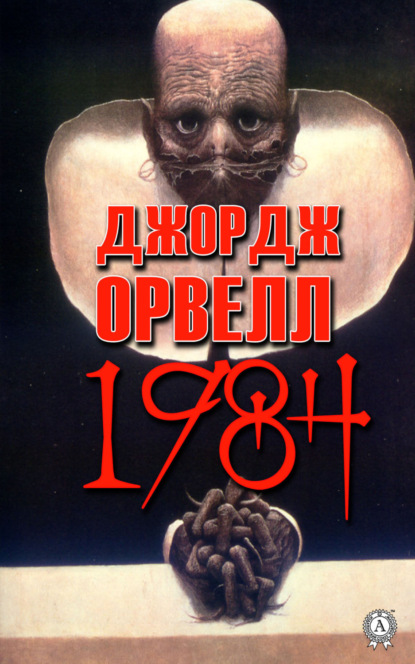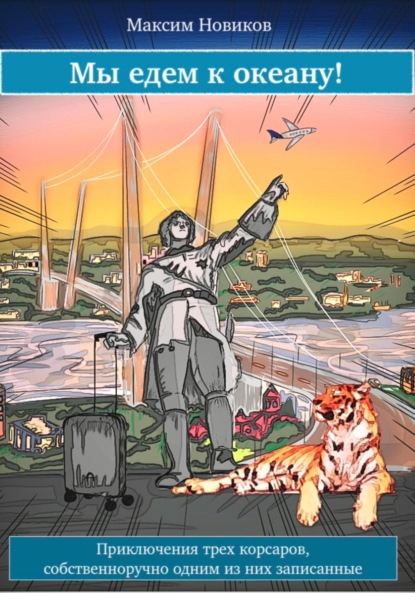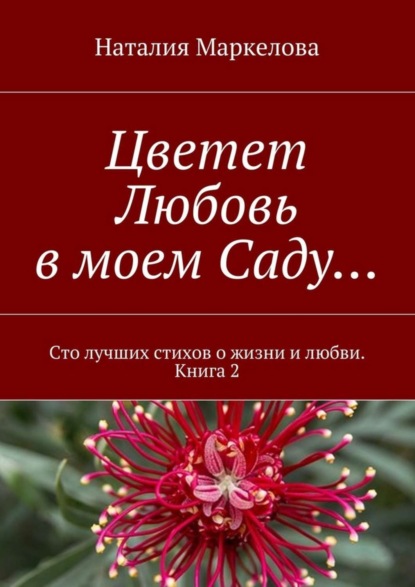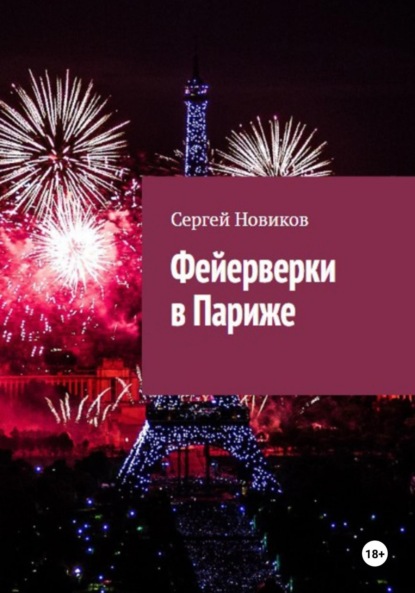- -
- 100%
- +
Zur Epoche Napoleons III: »Das Geldverdienen wird Gegenstand einer fast sinnlichen Inbrunst und die Liebe eine Geldangelegenheit. Zur Zeit der französischen Romantik war das erotische Ideal die Grisette, die sich verschenkt; jetzt ist es die Lorette, die sich verkauft … In die Mode kam eine gaminhafte Nuance: die Damen tragen Kragen und Krawatten, Paletots, frackartig geschnittene Röcke …, Zuavenjäckchen, Offizierstaillen, Spazierstöcke, Monokies. Man bevorzugt grell kontrastierte, schreiende Farben, auch für die Frisur: feuerrote Haare sind sehr beliebt … Der Modetypus ist die grande dame, die die Kokotte spielt.« Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit III München 1931 p 203 Der »plebejische Charakter« dieser Mode stellt sich dem Verfasser als »Invasion … von unten« durch die nouveaux riches dar. [B 6 a, 2]
»Les étoffes de coton remplacent les brocards, les satins … et bientôt, grâce … à l’esprit révolutionnaire, le costume des classes inférieures devient plus convenable et plus agréable à la vue.« Edouard Foucaud: Paris inventeur Physiologie de l’industrie française Paris 1844 p 64 (bezieht sich auf die große Revolution). [B 6 a, 3]
Gruppe, die bei genauerer Betrachtung nur aus Kleidungsstücken nebst einigen Puppenköpfen zusammengesetzt ist. Beschriftung: »Des Poupées sur des chaises, des Manequins chargés de faux cols, de faux cheveux, de faux attraits … voilà Longchamp!« C〈abinet〉 d〈es〉 E〈stampes〉 [B 6 a, 4]
»Si, en 1829, nous entrons dans les magasins de Delisle, nous trouvons une foule d’étoffes diverses: des japonaises, des alhambras, des gros d’Orient, des stokolines, des méotides, de la silénie, de la zinzoline, du bagazinkoff chinois … Par la révolution de 1830 … le sceptre de la mode avait traversé la Seine et la chaussée d’Antin remplaçait le noble faubourg.« Paul D’Ariste: La vie et le monde du boulevard (1830-1870) 〈Paris 1930〉 p 227 [B 6 a, 5]
»Der bemittelte Bürgersmann bezahlt als Ordnungsfreund seine Lieferanten mindestens alljährlich; aber der Mann der Mode, der sogenannte Löwe, bezahlt seinen Schneider alle zehn Jahre, wenn er ihn überhaupt bezahlt.« Acht Tage in Paris Paris Juli 1855 p 125 [B 7, 1]
»C’est moi qui ai inventé les tics. A présent le lorgnon les a remplacés … Le tic consistait à fermer l’œil avec un certain mouvement de bouche et un certain mouvement d’habit … Une figure d’homme élégant doit avoir toujours … quelque chose de convulsif et de crispé. On peut attribuer ces agitations faciales, soit à un satanisme naturel, soit à la fièvre des passions, soit enfin à tout ce qu’on voudra.« Paris-Viveur Par les auteurs des mémoires de Bilboquet [Taxile Delord] Paris 1854 p 25/26 [B 7, 2]
»La mode de se faire habiller à Londres n’atteignit jamais que les hommes; la mode féminine, même pour les étrangères, fut toujours de se faire habiller à Paris.« Charles Seignobos: Histoire sincère de la nation française Paris 1932 p 402 [B 7, 3]
Marcelin, der Begründer der »Vie Parisienne« hat »die vier Zeitalter der Krinoline« dargestellt. [B 7, 4]
Die Krinoline »ist das unverkennbare Symbol der Reaktion durch den Imperialismus, der sich breit und hohl ausspannt …, der … seine Macht wie eine Glocke über Gutes und Schlimmes, Berechtigtes und Unberechtigtes der Revolution gestürzt hat … Sie schien eine Grille des Augenblicks und sie hat sich für eine Periode festgesetzt wie der 2. Dezember«. F. Th. Vischer cit Eduard Fuchs: Die Karikatur der europäischen Völker München II p 156 [B 7, 5]
Im Anfang der vierziger Jahre befindet sich ein Zentrum der Modistinnen Rue Vivienne. [B 7, 6]
Simmel weist darauf hin, daß »die Erfindung der Mode in der Gegenwart mehr und mehr in die objektive Arbeitsverfassung der Wirtschaft eingegliedert« wird. »Es entsteht nicht irgendwo ein Artikel, der dann Mode wird, sondern es werden Artikel zu dem Zweck aufgebracht, Mode zu werden.« Der Gegensatz, den der letzte Satz herausstellt, dürfte in gewissem Maße den des bürgerlichen und feudalen Zeitalters betreffen. Georg Simmel: Philosophische Kultur Lpz 1911 p 34 (Die Mode) [B 7, 7]
Simmel erklärt »weshalb die Frauen im allgemeinen der Mode besonders stark anhängen. Aus der Schwäche der sozialen Position nämlich, zu der die Frauen den weit überwiegenden Teil der Geschichte hindurch verurteilt waren, ergibt sich ihre enge Beziehung zu allem, was ›Sitte‹ ist.« Georg Simmel: Philosophische Kultur Lpz 1911 p 47 (Die Mode) [B 7, 8]
Die folgende Analyse der Mode wirft nebenher ein Licht auf die Bedeutung der Reisen, die in der zweiten Jahrhunderthälfte im Bürgertum Mode wurden. »Der Akzent der Reize rückt in steigendem Maß von ihrem substanziellen Zentrum auf ihren Anfang und ihr Ende. Dies beginnt mit den geringfügigsten Symptomen, etwa dem … Ersatz der Zigarre durch die Zigarette, es offenbart sich an der Reisesucht, die das Leben des Jahres möglichst in mehreren kurzen Perioden, mit den starken Akzentuierungen des Abschieds und der Ankunft, schwingen läßt. Das … Tempo des modernen Lebens besagt nicht nur die Sehnsucht nach raschem Wechsel der qualitativen Inhalte des Lebens, sondern die Stärke des formalen Reizes der Grenze, des Anfangs und Endes.« Georg Simmel: Philosophische Kultur Lpz 1911 p 41 (Die Mode) [B 7 a, 1]
Simmel spricht aus, »daß Moden immer Klassenmoden sind, daß die Moden der höheren Schicht sich von der der tieferen unterscheiden und in dem Augenblick verlassen werden, in dem diese letztere sie sich anzueignen beginnt«. Georg Simmel: Philosophische Kultur Lpz 1911 p 32 (Die Mode) [B 7 a, 2]
Der rasche Wechsel der Mode bewirkt »daß die Moden nicht mehr so kostspielig … sein können, wie sie in früheren Zeiten waren … Ein eigentümlicher Zirkel … entsteht hier: je rascher die Mode wechselt, desto billiger müssen die Dinge werden; und je billiger sie werden, zu desto rascherem Wechsel der Mode laden sie die Konsumenten ein und zwingen sie die Produzenten.« Georg Simmel: Philosophische Kultur Lpz 1911 p 58/59 (Die Mode) [B 7 a, 3]
Fuchs zu Jherings Ausführungen über Mode: »Es muß … wiederholt werden, daß die Interessen der Klassenscheidung nur die eine Ursache des häufigen Modewechsels sind, und daß die zweite: der häufige Modewechsel als Konsequenz der privatkapitalistischen Produktionsweise, die im Interesse ihrer Gewinnrate ständig ihre Absatzmöglichkeiten steigern muß, schließlich … ebensosehr ins Gewicht fällt. Diese Ursache ist Ihering vollständig entgangen. Und auch die dritte Ursache übersah er: die erotisch stimulierenden Zwecke der Mode, die dadurch sich am besten erfüllen, wenn die erotischen Reize des Trägers oder der Trägerin immer wieder auf andere Weise auffallen … Fr. Vischer, der zwanzig Jahre vor Ihering über die … Mode schrieb, erkannte die Tendenzen der Klassenscheidung in der Modebildung noch nicht, … dagegen sind ihm wiederum die erotischen Probleme der Kleidung zum Bewußtsein gekommen.« Eduard Fuchs: Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart Das bürgerliche Zeitalter Ergänzungsband München p 53/54 [B 7 a, 4]
Eduard Fuchs (Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart Das bürgerliche Zeitalter Ergänzungsband p 56/57) zitiert – ohne Stellenangabe – eine Bemerkung von FTh Vischer, die die graue Farbe der Männerkleidung als symbolisch für »das ganz Blasirte« der Männerwelt und ihrer Mattheit und Schlaffheit ansieht. [B 8, 1]
»L’idée niaise et funeste d’opposer la connaissance approfondie des moyens d’exécution, … le travail savamment soutenu … à Pacte impulsif de la sensibilité singulière, est un des traits les plus certains et les plus déplorables de la légèreté et de la faiblesse de caractère qui ont marqué l’âge romantique. Le souci de la durée des ouvrages déjà s’affaiblissait et le cédait, dans les esprits, au désir d’étonner: l’art se vit condamné à un régime de ruptures successives. Il naquit un automatisme de la hardiesse. Elle devint impérative comme la tradition l’avait été. Enfin, la Mode, qui est le changement à haute fréquence du goût d’une clientèle, substitua sa mobilité essentielle aux lentes formations des styles, des écoles, des grandes renommées. Mais dire que la Mode se charge du destin des Beaux-Arts, c’est assez dire que le commerce s’en mêle.« Paul Valéry: Pièces sur l’art Paris p 187/188 (Autour de Corot) [B 8, 2]
»La grande et capitale révolution a été l’indienne. Il a fallu l’effort combiné de la science et de l’art pour forcer un tissu rebelle, ingrat, le coton, a subir chaque jour tant de transformations brillantes, puis transformé ainsi, … le mettre à la portée des pauvres. Toute femme portait jadis une robe bleue ou noire qu’elle gardait dix ans sans la laver, de peur qu’elle ne s’en allât en lambeaux. Aujourd’hui, son mari, pauvre ouvrier, au prix d’une journée de travail, la couvre d’un vêtement de fleurs. Tout ce peuple de femmes qui présente sur nos promenades une éblouissante iris de mille couleurs, naguère était en deuil.« J Michelet: Le peuple Paris 1846 p 80/81 [B 8, 3]
»C’est le commerce du vêtement, et non plus l’art comme autrefois qui a créé le prototype de l’homme et de la femme modernes … On imite les mannequins et l’âme est à l’image du corps.« Henri Pollès; L’art du commerce (Vendredi 〈12〉 février 1937) vgl. englische Herrenmode und Ticks. [B 8, 4]
»On calculera, en Harmonie, que les changemens de mode … et la confection imparfaite, causeraient une perte annuelle de 500 fr. par individu, parce que le plus pauvre des harmoniens a une garde-robe en vêtemens de toute saison … L’Harmonie … veut en vêtement et en mobilier, la variété infinie, mais la moindre consommation …. L’excellence des produits de l’industrie sociétaire … élève chaque objet manufacturé à l’extrême perfection, de sorte que le mobilier et le vêtement … deviennent éternels.« 〈Fourier〉 cit Armand et Maublanc: Fourier Paris 1937 II p 196 et 198 [B 8 a, 1]
»Ce goût de la modernité va si loin que Baudelaire comme Balzac l’étend aux plus futiles détails de la mode et de l’habillement. Tous deux les étudient en eux-mêmes et en font des questions morales et philosophiques, car ils représentent la réalité immédiate dans son aspect le plus aigu, le plus agressif, le plus irritant peut-être, mais aussi le plus généralement vécu. [Anm] »De plus, pour Baudelaire, ces préoccupations rejoignent son importante théorie du Dandysme dont précisément il fait une question de morale et de modernité.« Roger Caillois: Paris, mythe moderne (Nouvelle Revue Française XXV 284 1 mai 1937 p 692) [B 8 a, 2]
»Grand événement! les belles dames éprouvent un jour le besoin de se renfler le derrière. Vite, par milliers, des fabriques de tournures! … Mais qu’est-ce qu’un simple polisson sur d’illustres coccys! Une babiole en vérité … ›A bas les croupions! vivent les crinolines!‹ Et soudain, l’univers civilisé se change en manufacture de cloches ambulantes. Pourquoi le sexe charmant a-t-il oublié les garnitures de clochettes? … Ce n’est pas tout de tenir de la place, il faut faire du bruit ici-bas … Le quartier Bréda et le faubourg Saint-Germain sont rivaux en piété, aussi bien qu’en plâtrures et en chignons. Que ne prennent-ils modèle sur l’Eglise! A vêpres, l’orgue et le clergé débitent alternativement un verset des psaumes. Les belles dames et leurs clochettes pourraient se relayer à cet exemple, paroles et tintins reprenant tour à tour la suite de la conversation.« A Blanqui: Critique sociale Paris 1885 1 p 83/4 (Le Luxe) – »Le luxe« ist eine Polemik gegen die Luxusindustrie. [B 8 a, 3]
Jede Generation erlebt die Moden der gerade verflossenen als das gründlichste Antiaphrodisiacum, das sich denken läßt. Mit diesem Urteil trifft sie nicht so sehr daneben wie man annehmen könnte. Es ist in jeder Mode etwas von bitterer Satire auf Liebe, in jeder sind Perversionen auf das rücksichtsloseste angelegt. Jede steht im Widerstreit mit dem Organischen. Jede verkuppelt den lebendigen Leib der anorganischen Welt. An dem Lebenden nimmt die Mode die Rechte der Leiche wahr. Der Fetischismus, der dem sex-appeal des Anorganischen unterliegt, ist ihr Lebensnerv. [B 9, 1]
Geburt und Tod – erstere durch die natürlichen Umstände, letzterer durch gesellschaftliche – schränken, wo sie aktuell werden, den Spielraum der Mode beträchtlich ein. Dieser Tatbestand tritt durch einen doppelten Umstand ins rechte Licht. Der erste betrifft die Geburt und zeigt die natürliche Neuschöpfung des Lebens im Bereiche der Mode durch die Nouveautät »aufgehoben«. Der zweite betrifft den Tod. Was ihn angeht, so erscheint er nicht minder in der Mode als »aufgehoben« und zwar in dem durch sie entbundenen sex appeal des Anorganischen. [B 9, 2]
Die in der Dichtung des Barock beliebte Detaillierung der weiblichen Schönheiten, die jede einzelne durch den Vergleich heraushebt, hält sich insgeheim an das Bild der Leiche. Und diese Zerstücklung der weiblichen Schönheit in ihre rühmenswerten Bestandteile sieht einer Sektion ähnlich und die beliebten Vergleiche der Körperteile mit Alabaster, Schnee, Edelsteinen oder andern meist anorganischen Gebilden tut ein übriges. (Solche Zerstückelungen finden sich auch bei Baudelaire: le beau navire.) [B 9, 3]
Lipps über die dunkle Farbe in der Männerkleidung: er meint, »daß in unserer allgemeinen Scheu vor bunten Farben, zumal bei der männlichen Kleidung am deutlichsten eine öfter berührte Eigentümlichkeit unseres Charakters sich ausspricht. Grau ist alle Theorie, grün und nicht nur grün, sondern auch roth, gelb, blau ist des Lebens goldner Baum. So zeigt sich in unserer Vorliebe für die verschiedenen Schattierungen des Grau … bis zum Schwarz deutlich unsere gesellschaftliche und sonstige Art, die Theorie der Bildung des Intellekts über alles zu schätzen, selbst das Schöne nicht mehr vor allem genießen, sondern … an ihm Kritik üben zu wollen, wodurch … unser geistiges Leben immer kühler und farbloser wird.« Theodor Lipps: Über die Symbolik unserer Kleidung [Nord und Süd XXXIII Breslau Berlin 1885 p 352] [B 9, 4]
Moden sind ein Medikament, das die verhängnisvollen Wirkungen des Vergessens, im kollektiven Maßstab, kompensieren soll. Je kurzlebiger eine Zeit, desto mehr ist sie an der Mode ausgerichtet, vgl. K 2 a, 3 [B 9 a, 1]
Focillon über die fantasmagorie de la mode: »le plus souvent … elle crée … des hybrides, elle impose à l’être humain le profil de la bête … La mode invente ainsi une humanité artificielle qui n’est pas le décor passif du milieu formel, mais ce milieu même. Cette humanité tour à tour héraldique, théâtrale, féerique, architecturale, a … pour règle … la poétique de l’ornement, et ce qu’elle appelle ligne … n’est peut-être qu’un subtil compromis entre un certain canon physiologique … et la fantaisie des figures.« Henri Focillon: Vie des formes Paris 1934 p 41 [B 9 a, 2]
Es gibt schwerlich ein Kleidungsstück, das so divergierenden erotischen Tendenzen Ausdruck geben kann und soviel Freiheit sie zu verkleiden hat wie 〈der〉 weibliche Hut. So strikt die Bedeutung der männlichen Kopfbedeckung in ihrer Sphäre – der politischen – an einige wenige starre Modelle gebunden war, so unabsehbar sind die Abschattierungen der erotischen Bedeutung am Frauenhut. Es sind nicht sowohl die verschiednen Möglichkeiten, symbolisch die Geschlechtsorgane zu umspielen, die hier am meisten interessieren können. Überraschender kann der Aufschluß sein, der etwa vom Kleid aus dem Hute werden kann. H〈elen〉 Grund hat die geistvolle Vermutung geäußert, die Schute, die gleichzeitig mit der Krinoline ist, stelle eigentlich eine Gebrauchsanweisung der letzteren für den Mann dar. Die breiten Ränder der Schute sind aufgeklappt – derart andeutend, wie die Krinoline aufgeklappt werden muß, um dem Mann die geschlechtliche Annäherung an die Frau leicht zu machen. [B 10, 1]
Die horizontale Körperhaltung hatte für die Weibchen der Gattung des homo sapiens, denkt man an deren älteste Exemplare, die größten Vorteile. Sie erleichterte ihnen die Schwangerschaft, wie man das schon aus den Gürteln und Bandagen ersehen kann, zu denen die schwangern Frauen heute zu greifen pflegen. Davon ausgehend ließe sich vielleicht die Frage wagen, ob der aufrechte Gang im allgemeinen bei den Männchen nicht früher als bei den Weibchen auftrat? Dann wäre das Weibchen zu Zeiten der vierfüßige Begleiter des Manns gewesen wie es heute Hund oder Katze ist. Ja es ist von dieser Vorstellung aus möglicherweise nur ein Schritt zu der weitern, die frontale Begegnung der beiden Partner beim Begattungsakt sei ursprünglich gleichsam eine Art Perversion gewesen, und vielleicht sei es nicht zum wenigsten diese Verirrung gewesen, durch die das Weibchen im aufrechten Gang angelernt worden sei. (vgl. Note in 〈dem〉 Aufsatz »Eduard Fuchs der Sammler und 〈der〉 Historiker〈«〉) [B 10, 2]
»Es würde … Interesse haben, nachzuforschen, welche weiteren Nachwirkungen diese Bestimmung zur aufrechten Stellung auf den Bau und die Verrichtungen des übrigen Körpers ausübt. Wir sind nicht in Zweifel darüber, daß ein enger Zusammenhang alle Einzelheiten der organischen Structur umfaßt, aber nach dem gegenwärtigen Zustande unserer Wissenschaft müssen wir doch behaupten, daß die außerordentlichen Einflüsse, welche man in diesem Betracht dem Aufrechtstehen zuschreibt, nicht vollkommen beweisbar sind … Für den Bau und die Function der inneren Organe läßt sich keine bedeutende Rückwirkung nachweisen, und die Annahmen Herders, alle Kräfte würden in aufrechter Stellung anders wirken, das Blut anders die Nerven reizen, entbehren, wenn sie sich auf erhebliche und für die Lebensweise nachweisbar wichtige Unterschiede beziehen sollen, jeder Begründung.« Hermann Lotze: Mikrokosmos Zweiter Band Lpz 1858 p 90 [B 10 a, 1]
Eine Stelle aus einem kosmetischen Prospekt, die für die Mode des second empire kennzeichnend ist. Der Fabrikant empfiehlt »un cosmétique … au moyen duquel les dames peuvent, si elles le désirent, donner à leur teint le reflet du taffetas rose.« cit Ludwig Börne: Gesammelte Schriften Hamburg Frankfurt a/M 1862 III p 282 (Die Industrie-Ausstellung im Louvre) [B 10 a, 2]
Antikisches Paris, Katakomben, demolitions, Untergang von Paris
»Facilis descensus Averno.«
Vergil»Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes.«
Guillaume ApollinaireWie die Gitter – als Allegorien – sich in der Hölle ansiedeln. In der Passage Vivienne Portalskulpturen, Allegorien des Handel darstellend. [C 1, 1]
In einer Passage ist der Surrealismus geboren worden. Und unterm Protektorat welcher Musen! [C 1, 2]
Der Vater des Surrealismus war Dada, seine Mutter war eine Passage. Dada war, als er ihre Bekanntschaft machte, schon alt. Ende 1919 verlegten Aragon und Breton aus Abneigung gegen Montparnasse und Montmartre ihre Zusammenkünfte mit Freunden in ein Café der Passage de l’Opéra. Der Durchbruch des Boulevard Haussmann hat ihr ein Ende gemacht. Louis Aragon hat über sie 135 Seiten geschrieben, in deren Quersumme sich die Neunzahl der Musen versteckt hält, die den kleinen Surrealismus mit ihren Geschenken begabt haben. Sie heißen: Luna, die Gräfin Geschwitz, Kate Greenaway, Mors, Cléo de Mérode, Dulcinea, Libido, Baby Cadum und Friederike Kempner. (statt Gräfin Geschwitz: Tipse?) [C 1, 3]
Caissière als Danae [C 1, 4]
Pausanias schrieb seine Topographie von Griechenland 200 n. Chr. als die Kultstätten und viele der anderen Monumente zu verfallen begannen. [C 1, 5]
Es gibt weniges in der Geschichte der Menschheit, wovon wir soviel wissen wie von der Geschichte der Stadt Paris. Tausende und zehntausende von Bänden sind einzig der Erforschung dieses winzigen Fleckens Erde gewidmet. Die echten Führer durch die Altertümer der alten Lutetia Parisorum kommen schon aus dem 16ten Jahrhundert. Der Katalog der kaiserlichen Bibliothek, der unter Napoleon III in Druck ging, enthält fast hundert Seiten unter dem Stichwort Paris und auch diese Sammlung ist bei weitem nicht vollständig. Viele der Hauptstraßen haben ihre Sonderliteratur und über Tausende der unscheinbarsten Häuser besitzen wir schriftliche Nachsicht. Mit einem schönen Worte nannte Hofmannsthal 〈diese Stadt〉 »eine Landschaft aus lauter Leben gebaut«. Und in der attraction, die sie über Menschen ausübt, wirkt eine Art von Schönheit wie sie großer Landschaft eignet – genauer gesagt: der vulkanischen. Paris ist in der sozialen Ordnung ein Gegenbild von dem, was in der geographischen der Vesuv ist. Ein drohendes, gefährliches Massiv, ein immer tätiger Herd der Revolution. Wie aber die Abhänge des Vesuv dank der sie deckenden Lavaschichten zu paradiesischen Fruchtgärten wurden, so blühen auf der Lava der Revolutionen die Kunst, das festliche Leben, die Mode wie nirgend sonst. ■ Mode ■ [C 1, 6]
Balzac hat die mythische Verfassung seiner Welt durch deren bestimmte topographische Umrisse gesichert. Paris ist der Boden seiner Mythologie – Paris mit seinen zwei, drei großen Bankiers (Nucingen, du Tillet), Paris mit seinem großen Arzte Horace Bianchon, mit seinem Unternehmer César Birotteau, mit seinen vier oder fünf großen Kokotten, mit seinem Wucherer Gobseck, seinen paar Advokaten und Militärs. Vor allen Dingen aber sind es immer wieder dieselben Straßen und Winkel, Gelasse und Ecken, aus denen die Figuren dieses Kreises ans Licht treten. Was heißt das anderes als daß die Topographie der Aufriß dieses, wie jedes, mythischen Traditionsraums ist, ja der Schlüssel derselben werden kann, wie sie es dem Pausanias für Griechenland wurde, wie die Geschichte und Lage der pariser Passagen für dies Jahrhundert Unterwelt, in das Paris versank, es werden soll. [C 1, 7]
Die Stadt zehnfach und hundertfach topographisch zu erbauen aus ihren Passagen und ihren Toren, ihren Friedhöfen und Bordellen, ihren Bahnhöfen und ihren … genau wie sich früher durch ihre Kirchen und ihre Märkte bestimmte. Und die geheimeren, tiefer gelagerten Stadtfiguren: Morde und Rebellionen, die blutigen Knoten im Straßennetze, Lagerstätten der Liebe und Feuersbrünste. □ Flaneur □ [C 1, 8]
Ließe nicht ein passionierender Film sich aus dem Stadtplan von Paris gewinnen? aus der Entwicklung seiner verschiedenen Gestalten in zeitlicher Abfolge? aus der Verdichtung einer jahrhundertelangen Bewegung von Straßen, Boulevards, Passagen, Plätzen im Zeitraum einer halben Stunde? Und was anderes tut der Flaneur? □ Flaneur □ [C 1, 9]
»Il y a, à deux pas du Palais-Royal, – entre la cour des Fontaines et la rue Neuve-des-Bons-Enfants, – un petit passage noir et tortueux, orné d’un écrivain public et d’une fruitière. Cela peut ressembler à l’antre de Cacus ou de Trophonius, mais cela ne pourra jamais ressembler à un passage, – même avec de la bonne volonté et des becs de gaz.« Delvau: Les dessous de Paris Paris 1860 p 105/106 [C 1 a, 1]
Man zeigte im alten Griechenland Stellen, an denen es in die Unterwelt hinabging. Auch unser waches Dasein ist ein Land, in dem es an verborgenen Stellen in die Unterwelt hinabgeht, voll unscheinbarer Örter, wo die Träume münden. Alle Tage gehen wir nichtsahnend an ihnen vorüber, kaum aber kommt der Schlaf, so tasten wir mit geschwinden Griffen zu ihnen zurück und verlieren uns in den dunklen Gängen. Das Häuserlabyrinth der Städte gleicht am hellen Tage dem Bewußtsein; die Passagen (das sind die Galerien, die in ihr vergangenes Dasein führen) münden tagsüber unbemerkt in die Straßen. Nachts unter den dunklen Häusermassen aber tritt ihr kompakteres Dunkel erschreckend heraus und der späte Passant hastet an ihnen vorüber, es sei denn, daß wir ihn zur Reise durch die schmale Gasse ermuntert haben.
Aber ein anderes System von Galerien, die unterirdisch durch Paris sich hinziehen: die Métro, wo am Abend rot die Lichter aufglühen, die den Weg in den Hades der Namen zeigen. Combat – Elysée – Georges V – Etienne Marcel – Solférino – Invalides – Vaugirard haben die schmachvollen Ketten der rue, der place von sich abgeworfen, sind hier im blitzdurchzuckten, pfiffdurchgellten Dunkel zu ungestalten Kloakengöttern, Katakombenfeen geworden. Dies Labyrinth beherbergt in seinem Innern nicht einen sondern Dutzende blinder, rasender Stiere, in deren Rachen nicht jährlich eine thebanische Jungfrau, sondern allmorgentlich tausende bleichsüchtiger Midinetten, unausgeschlafener Kommis sich werfen müssen. □ Straßennamen □ Hier unten nichts mehr von dem Aufeinanderprall, der Überschneidung von Namen, die das oberirdische Sprachnetz der Stadt bilden. Ein jeder haust hier einzeln, die Hölle sein Hofstaat, Amer Picon Dubonnet sind die Hüter der Schwelle. [C 1 a, 2]
»Hat nicht jedes Quartier seine eigentliche Blütezeit etwas bevor es vollständig bebaut ist? Und dann beschreibt sein Planet eine Kurve, nähert sich dem Handel und hier wieder erst dem großen und dann dem kleinen. Solange die Straße noch etwas neu ist, gehört sie den kleinen Leuten und wird sie erst los, wenn die Mode ihr lächelt. Ohne aufs Geld zu sehen, machen die Interessenten sich gegenseitig die kleinen Häuser und die einzelnen Wohnungen streitig, solange nämlich hier schöne Frauen mit der strahlenden Eleganz, die nicht nur dem Salon sondern dem Haus und sogar der Straße zur Zier wird, ihre Empfänge veranstalten und empfangen werden. Und ist die schöne Dame einmal Passantin geworden, dann will sie auch Kaufläden und häufig kommt es die Straße teuer zu stehen, wenn sie sich zu geschwind diesem Wunsch anpaßt. Dann fängt man an, die Höfe zu verkleinern, manche fallen ganz fort, man rückt in den Häusern zusammen und am Ende kommt dann ein Neujahrstag, an dem es gegen den guten Ton ist, ein〈e〉 solche Adresse auf seiner Besuchskarte zu haben. Denn die Mehrzahl der Mieter sind nur Gewerbeleute und die Torwege haben nicht mehr viel zu verlieren, wenn sie hin und wieder einem der kleinen Handwerker Zuflucht gewähren, deren kümmerliche Bretterbuden an die Stelle der Läden getreten sind.« Lefeuve: Les anciennes maisons de Paris sous Napoléon III Paris Bruxelles 1873 I p 482 □ Mode □ [C 1 a, 3]