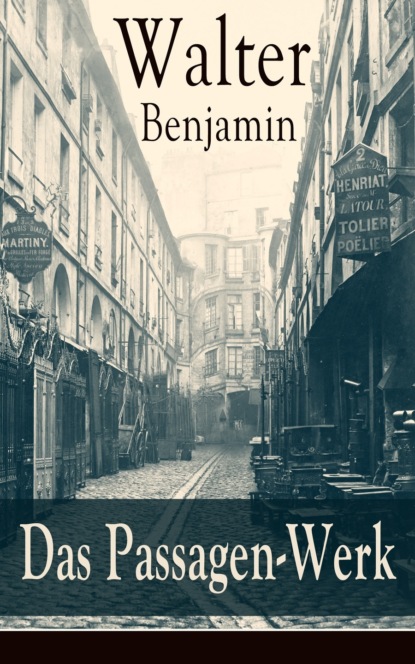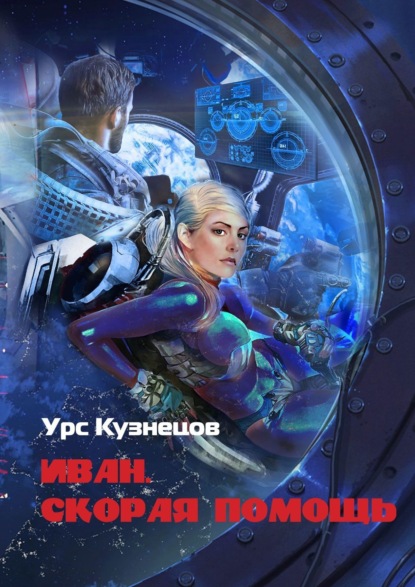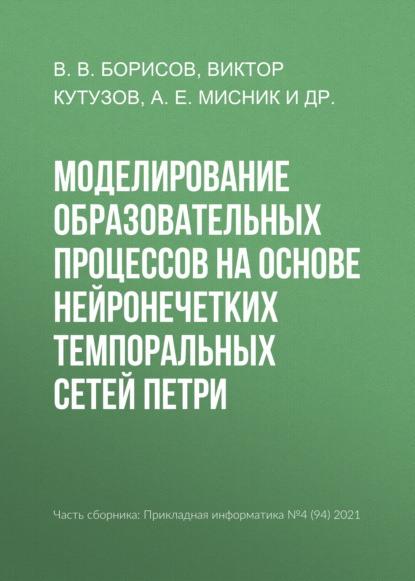- -
- 100%
- +
Es ist für das schwach entwickelte Selbstgefühl der meisten europäischen Großstädte ein trauriges Zeugnis, daß so sehr wenige und jedenfalls keine deutsche, einen so handlichen, minutiösen und dauerhaften Plan haben wie er für Paris existiert. Das ist mit seinen 22 Karten von allen pariser Arrondissements und von den Parks von Boulogne und Vincennes der ausgezeichnete plan Taride. Wer je in einer fremden Stadt an einer Straßenecke bei schlechtem Wetter mit einem der großen papiernen Stadtpläne hantieren mußte, die bei jedem Windzug wie ein Segel schwellen, an jeder Kante durchreißen und bald nur noch ein Häufchen schmutziger bunter Blätter sind, mit denen man sich herumquält wie mit einem Puzzle, der lerne aus dem Studium des plan Taride, was ein Stadtplan sein kann. Leuten, denen die Phantasie bei der Versenkung in ihn nicht wach wird und die ihren pariser Erlebnissen nicht lieber über einem Stadtplan als über Photos oder Reiseaufzeichnungen nachhängen, denen kann nicht geholfen werden. [C 1 a, 4]
Paris steht über einem Höhlensystem, aus dem Geräusche der Métro und Eisenbahnen heraufdröhnen, in dem jeder Omnibus, jeder Lastwagen langausgehaltenen Widerhall erweckt. Und dieses große technische Straßen- und Röhrensystem durchkreuzt sich mit den altertümlichen Gewölben, den Kalksteinbrüchen, Grotten, Katakomben, die seit dem frühen Mittelalter Jahrhunderte hindurch gewachsen sind. Noch heute kann man gegen zwei Franken Entgelt sich seine Eintrittskarte zum Besuche dieses nächtlichsten Paris lösen, das so viel billiger und ungefährlicher als das der Oberwelt ist. Das Mittelalter hat es anders gesehen. Aus Quellen wissen wir, daß hin und wieder sich kluge Leute erbötig machten, gegen hohe Bezahlung und Schweigegelübde ihren Mitbürgern dort unten den Teufel in seiner höllischen Majestät zu zeigen. Ein Finanzunternehmen, das für die Geprellten viel weniger riskant war als für den betreffenden Gauner. Mußte die Kirche eine unechte Teufelserscheinung der Gotteslästerung nicht beinahe gleichsetzen? Auch sonst warf diese unterirdische Stadt für die, die sich in ihr ausgekannt haben, ihren greifbaren Nutzen ab. Denn ihre Straßen schnitten die große Zollmauer, mit der die fermiers généraux ihre Rechte auf Abgaben von der Einfuhr sich sicherten. Der Schmuggelverkehr im sechzehnten und achtzehnten Jahrhundert ging zum großen Teil unter der Erde vor sich. Wir wissen auch, daß in Zeiten öffentlicher Erregung sehr schnell unheimliche Gerüchte über die Katakomben umliefen, zu schweigen von den prophetischen Geistern und wei〈s〉en Frauen, die von rechtswegen dahin zuständig sind. Am Tage nach der Flucht Ludwigs XVI verbreitete die Revolutionsregierung Plakate, in denen sie genaueste Durchsuchung dieser Gänge anordnete. Und ein paar Jahre später ging unversehens das Gerücht durch die Massen, einige Stadtviertel seien dem Einbruch nahe. [C 2, 1]
Die Stadt auch weiter zu erbauen aus ihren »fontaines«. »Quelques rues ont conservé le nom de ceux-ci, quoique le plus célèbre d’entre eux, le Puits d’Amour, qui était situé non loin des halles, dans la rue de la Truanderie, ait été tari, comblé, rasé, sans laisser de traces. Il n’en est point ainsi de ce puits à écho dont le sobriquet a été donné à la rue du Puits-qui-Parle, ni du puits que le tanneur Adam-l’Hermite avait fait creuser dans le quartier Saint-Victor; nous avons connu les rues du Puits-Mauconseil, du Puits-de-Fer, du Puits-du-Chapitre, du Puits-Certain, du Bon-Puits, et enfin la rue du Puits qui, après avoir été le rue du Bout-du-Monde, est devenue l’impasse Saint-Claude-Montmartre. Les fontaines marchandes, les fontaines à la sangle, les porteurs d’eau iront rejoindre les puits publics, et nos enfants, qui auront de l’eau avec facilité aux derniers étages des maisons les plus élevées de Paris, s’étonneront que nous ayons conservé si longtemps ces moyens primitifs de pourvoir à l’un des plus impérieux besoins de l’homme.« Maxime du Camp: Paris Ses organes, ses fonctions et sa vie Paris 1875 V p 263 [C 2, 2]
Eine andere Topographie, nicht architektonisch sondern anthropozentrisch gedacht, würde uns das stillste Quartier, das abgelegne vierzehnte Arrondissement mit einem Schlag in seinem wahren Lichte zeigen. So sah es wenigstens schon Jules Janin vor hundert Jahren. Wer darin zur Welt kam, konnte das bewegteste, verwegenste Leben führen ohne es je zu verlassen. Denn in ihm liegen, eines nach dem andern, all die Gebäude des öffentlichen Elends, der proletarischen Not in lückenlosester Folge: die Entbindungsanstalt, das Findelhaus, das Hospital, die berühmte Santé: das große pariser Gefängnis und das Schaffott. Nachts sieht man auf versteckten, schmalen Bänken – nicht etwa auf den komfortablen der Squares – Männer zum Schlafen wie im Wartesaal auf einer Zwischenstation dieser schrecklichen Reise dahingestreckt. [C 2, 3]
Es gibt architektonische Embleme des Handels: Stufen führen zur Apotheke, der Zigarrenladen hat sich der Ecke bemächtigt. Der Handel weiß die Schwelle zu nutzen: vor der Passage, der Eisbahn, der Schwimmanstalt, de〈m〉 Bahnsteig steht als Hüterin der Schwelle eine Henne, die automatisch blecherne Eier legt, die im Innern Bonbons haben, neben ihr eine automatische Wahrsagerin, ein automatischer Stanzapparat, von dem wir unsern Namen auf ein Blechband prägen lassen, das uns das Schicksal am Collier befestigt. [C 2, 4]
Im alten Paris gab es Hinrichtungen (z. B. durch den Strang) auf offener Straße, [C 2, 5]
Rodenberg spricht von der »stygischen Existenz« gewisser wertloser Papiere – z. B. Aktien der Caisse-Mirès –, die in der Hoffnung auf »künftige Wiederauferstehung nach täglichen Chancen« von der »petite pègre« der Börse verkauft werden. Julius Rodenberg: Paris bei Sonnenschein und Lampenlicht Berlin 1867 p 102/103 [C 2 a, 1]
Konservative Tendenz des pariser Lebens: noch im Jahr 1867 faßt ein Unternehmer den Plan, fünfhundert Sänften in Paris zirkulieren zu lassen. [C 2 a, 2]
Zur mythologischen Topographie von Paris: welchen Charakter die Tore ihm geben. Wichtig ist ihre Zweiheit: Grenzpforten und Triumphtore. Geheimnis des ins Innere der Stadt einbezogenen Grenzsteins, der ehemals den Ort markierte, wo sie zu Ende war. – Auf der andern Seite der Triumphbogen, der heute zur Rettungsinsel geworden ist. Aus dem Erfahrungskreise der Schwelle hat das Tor sich entwickelt, das den verwandelt, der unter seiner Wölbung hindurchschreitet. Das römische Siegestor macht aus dem heimkehrenden Feldherrn den Triumphator. (Widersinn der Reliefs an der inneren Torwandung? ein klassizistisches Mißverständnis?) [C 2 a, 3]
Die Galerie, die zu den Müttern führt, ist aus Holz. Holz tritt auch bei den gewaltigen Umwandlungen im Bilde der Großstadt transitorisch immer wieder auf, baut mitten in den modernen Verkehr in hölzernen Bauzäunen, hölzernen Planken, die über die aufgerissenen Substruktionen gelegt sind, das Bild ihrer dörflichen Urzeit. □ Eisen □ [C 2 a, 4]
»Es ist der finster beginnende Traum von den Nordstraßen der Großstadt, nicht nur Paris vielleicht auch Berlin und das nur flüchtig gekannte London, finster beginnend, regenlose Dämmerung und doch Feuchtheit. Die Straße verengert sich, die Häuser rücken rechts und links näher, es wird schließlich eine Passage mit trüben Scheibenwänden, ein Glasgang, rechts und links: sind es garstige Weinstuben mit lauernden Kellnerinnen in schwarz und weißen Seidenblusen? es riecht nach vergossenem Kratzer. Oder sind es bunthelle Bordellflure? Wie ich aber weiterkomme, sind es zu beiden Seiten sommergrüne kleine Türen und ländliche Fensterläden, volets, und sitzen da nicht gutalte Weiblein und spinnen und hinter den Fenstern bei den etwas steifen Blumenstöcken wie in Bauerngärten und doch in holdem Zimmer helle Jungfern und es singt: ›Eins spinnt Seide …‹« Franz Hessel: Manuscript vgl, Strindberg: Die Drangsale des Lotsen [C 2 a, 5]
Vor dem Eingang ein Briefkasten: letzte Gelegenheit, der Welt, die man verläßt, ein Zeichen zu geben. [C 2 a, 6]
Unterirdische Spazierbesichtigung der Kanalisation. Beliebter parcours: Châtelet-Madeleine. [C 2 a, 7]
»Les ruines de l’Eglise et de la Noblesse, celles de la Féodalité, du Moyen-Age, sont sublimes et frappent aujourd’hui d’admiration les vainqueurs étonnés, ébahis; mais celles de la Bourgeoisie seront un ignoble détritus de carton-pierre, de plâtres, de coloriages.« Le diable à Paris Paris 1845 II p 18 (Balzac: Ce qui disparait de Paris) □ Sammler □ [C 2 a, 8]
… dies alles sind die Passagen in unsern Augen. Und nichts von alledem sind sie gewesen. »Car c’est aujourd’hui seulement que la pioche les menace, qu’ils sont effectivement devenus les sanctuaires d’un culte de l’éphémère, qu’ils sont devenus le paysage fantomatique des plaisirs et des professions maudites, incompréhensibles hier et que demain ne connaîtra jamais.« Louis Aragon: Le paysan de Paris Paris 1926 p 19 □ Sammler □ [C 2 a, 9]
Plötzliche Vergangenheit einer Stadt: Erleuchtete Fenster vor Weihnachten leuchten als brennten sie noch von 1880 her. [C 2 a, 10]
Der Traum – das ist die Erde, in der die Funde gemacht werden, die von der Urgeschichte des 19ten Jahrhunderts Zeugnis ablegen. □ Traum □ [C 2 a, 11]
Motive für den Untergang der Passagen: Verbreiterte Trottoirs, elektrisches Licht, Verbot für Prostituierte, Kultur der Freiluft. [C 2 a, 12]
Die Wiedergeburt des archaischen Dramas der Griechen auf den Bretterbuden der foire. Der Polizeipräfekt gestattet auf diesen Bühnen nur Dialoge. »Ce troisième personnage est muet, de par M. le Préfet de Police, qui ne permet que le dialogue aux théâtres dits forains.« Gérard de Nerval: Le cabaret dé la Mère Saguet. Paris 〈1927〉 p 259/260 (Le boulevard du Temple Autrefois et aujourd’hui) [C 3, 1]
Vor dem Eingang der Passage ein Briefkasten: eine letzte Gelegenheit, der Welt, die man verläßt, ein Zeichen zu geben. [C 3, 2]
Die Stadt ist nur scheinbar gleichförmig. Sogar ihr Name nimmt verschiedenen Klang in den verschiedenen Teilen an. Nirgends, es sei denn in Träumen, ist noch ursprünglicher das Phänomen der Grenze zu erfahren als in Städten. Sie kennen heißt jene Linien, die längs der Eisenbahnüberführungen, quer durch Häuser, innerhalb des Parks, am Ufer des Flusses entlang als Grenzscheiden verlaufen, wissen; heißt diese Grenzen wie auch die Enklaven der verschiednen Gebiete kennen. Als Schwelle zieht die Grenze über Straßen; ein neuer Rayon fängt an wie ein Schritt ins Leere; als sei man auf eine tiefe Stufe getreten, die man nicht sah. [C 3, 3]
Vorm Eingang der Passage, der Eisbahn, des Bierlokals, des Tennisplatzes: Penaten. Die Henne, die goldene Pralinéeier legt, der Automat, der unsern Namen stanzt und jener andere, der uns wiegt – das moderne γνωϑι σεαυτον – Glücksspielapparate, die mechanische Wahrsagerin hüten die Schwelle. Sie finden sich, bemerkenswerterweise, so stetig weder im Innern noch eigentlich im Freien. Sie beschirmen und bezeichnen die Übergänge und die Reise geht Sonntagnachmittags nicht nur ins Grüne, sondern auch zu diesen geheimnisvollen Penaten. □ Traumhaus □ Liebe □ [C 3, 4]
Der despotische Schrecken der Klingel, der über der Wohnung waltet, hat seine Kraft ebenfalls aus dem Zauber der Schwelle. Gellend schickt etwas sich an, die Schwelle zu überschreiten. Aber seltsam wie dies Klingeln wehmütig, glockenhaft wird, wenn es den Abschied ansagt, wie es im Kaiserpanorama mit der leisen Erschütterung des weichenden Bildes einsetzt und das nächste verkündet. □ Traumhaus □ Liebe □ [C 3, 5]
Diese Tore – die Eingänge der Passagen – sind Schwellen. Keine steinerne Stufe markiert sie. Aber das tut die wartende Haltung der wenigen Personen. Sparsam abgemessene Schritte spiegeln, ohne daß sie selbst davon wissen, es ab, daß man vor einem Entschluß steht. □ Traumhaus □ Liebe □ [C 3, 6]
Cours dés miracles neben dem aus »Notre-Dame de Paris« berühmten an der passage du Caire. »On trouve au Marais, dans la rue des Tournelles, le passage et la cour des Miracles; il y avait encore d’autres cours des miracles dans les rues Saint-Denis, du Bac, de Neuilly, des Coquilles, de la Jussienne, Saint-Nicaise et la butte Saint-Roch.« Labedollière: Histoire du nouveau Paris Paris p 31 [Die Stelle nach der diese Hofe benannt wurden Jesaias XXVI, 4/5 und XXVII] [C 3, 7]
Mit Beziehung auf Haussmanns Erfolge auf dem Gebiet der Wasserversorgung und der Drainage von Paris: »Les poètes pourraient dire qu’Haussmann fut mieux inspiré par les divinités d’en bas que par les dieux supérieurs.« Dubech-D’Espezel: Histoire de Paris Paris 1926 p 418 [C 3, 8]
Métro. »On a donné à la plupart des stations des noms absurdes, dont le pire semble appartenir à celle qui, à l’angle des rues Bréguet et Saint-Sabin, a fini par réunir dans l’abréviation ›Bréguet-Sabin‹ le nom d’un horloger et le nom d’un saint.« Dubech-D’Espezel: l c p 463 [C 3, 9]
Holz ein archaisches Element im Straßenbild: hölzerne Barrikaden. [C 3, 10]
Juniinsurrektion. »Die meisten Gefangenen wurden nach den Steinbrüchen und unterirdischen Gängen gebracht, welche sich unter den Forts von Paris befinden und die so weitläufig sind, daß die halbe Bevölkerung von Paris in denselben Platz hätte. Die Kälte in diesen unterirdischen Gallerien ist so groß, daß Viele blos durch fortwährendes Rennen oder durch Bewegung der Arme sich die Lebenswärme erhalten konnten und Niemand es wagte, sich auf die kalten Steine niederzulegen … Die Gefangenen gaben allen Gängen Namen von Pariser Straßen, und gaben sich gegenseitig ihre Adressen, wenn sie sich begegneten.« Engländer lc 〈Geschichte der französischen Arbeiter-Associationen Hamburg 1864〉 II p 314/15 [C 3 a, 1]
»Die Pariser Steingruben hängen alle unter einander zusammen … Man hat an mehreren Stellen Pfeiler stehen gelassen, damit die Decke nicht einstürze. An anderen hat man Mauern untergelegt. Diese Mauern bilden lange Gänge unter der Erde, wie enge Straßen. An mehreren sind an den Enden Nummern angeschrieben, um das Verirren zu verhüten, – aber doch darf man sich ohne Führer … wenig in dieses ausgebaute Kalkflöz wagen, … wenn man sich nicht … dem Hungertode aussetzen wollte.« – »Die Sage, daß man in den Kellern der Pariser Steingruben die Sterne bei Tage sehen könne« ist durch einen alten Schacht entstanden, »den man oben mit einem Steine zugedeckt hat, in dem ein kleines Loch von drei Linien Durchmesser ist. Durch dieses scheint der Tag unten in die Finsterniß, wie ein blasser Stern.« J. F. Benzenberg: Briefe geschrieben auf einer Reise nach Paris Dortmund 1805 I p 207/208 [C 3 a, 2]
»… une chose qui fumait et clapotait par la Seine avec le bruit d’un chien qui nage, allant et venant sous les fenêtres des Tuileries, du pont Royal au pont Louis XV: c’était une mécanique bonne à pas grand’chose, une espèce de joujou, une rêverie d’inventeur songe-creux, une utopie: un bateau à vapeur. Les Parisiens regardaient cette inutilité avec indifférence.« Victor Hugo: Les Misérables I cit bei Nadar: Quand j’étais photographe Paris 〈1900〉 p 280 [C 3 a, 3]
»Comme si d’un enchanteur ou d’un machiniste de théâtre, le premier coup de sifflet de la première locomotive a donné le signal d’éveil, d’envolement à toutes choses.« Nadar: Quand j’étais photographe Paris p 281 [C 3 a, 4]
Bezeichnend ist die Entstehungsgeschichte eines der großen Realienbücher über Paris, nämlich von Maxime Du Camp’s »Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle« 6 vol Paris 1893-96. Über dieses Werk schreibt ein Antiquariatskatalog: »Ouvrage d’un vif intérêt par sa documentation aussi exacte que minutieuse. Du Camp, en effet, n’hésita pas d’exercer les métiers les plus divers, se faisant conducteur d’omnibus, balayeur, égoutier pour se procurer les matériaux de son livre. Cette opiniâtreté l’avait fait surnommer le ›préfet de la Seine in partibus‹ et elle ne fût certes pas étrangère à son élévation à la dignité de sénateur.« Die Entstehung des Buches beschreibt Paul Bourget in seinem »Discours académique du 13 juin 1895. Succession à Maxime Du Camp« (L’Anthologie de l’Académie Française Paris 1921 II p 191-93) 1862, erzählt Bourget, hätten sich bei Du Camp Anzeichen eines Augenleidens eingestellt; er sei zu dem Optiker Secrétan gegangen, der ihm eine Brille gegen Weitsichtigkeit verordnet habe. Weiter hat Du Camp das Wort: »L’âge me touchait. Je ne lui fis pas un accueil aimable. Mais je me soumis. Je commandai un binocle et une paire de besicles.« Nun Bourget: »L’opticien n’avait pas les verres demandés. Il lui fallait une demi-heure pour les préparer. M. Maxime Du Camp sortit pour tuer cette demi-heure, en flânant au hasard. Il se trouva sur le Pont-Neuf … L’écrivain était dans un de ces moments où l’homme, qui va cesser d’être jeune, pense à la vie, avec une gravité résignée qui lui fait retrouver partout l’image de ses propres mélancolies. La toute petite déchéance physiologique dont sa visite chez l’opticien venait de le convaincre, lui avait rappelé ce qui s’oublie si vite, cette loi de l’inévitable destruction qui gouverne toute chose humaine … Il se prit soudain, lui, le voyageur d’Orient, le pèlerin des muettes solitudes où le sable est fait de la poussière des morts, à songer qu’un jour aussi cette ville, dont il entendait l’énorme halètement, mourrait, comme sont mortes tant de capitales de tant d’Empires. L’idée lui vint de l’intérêt prodigieux que nous présenterait aujourd’hui un tableau exact et complet d’une Athènes au temps de Périclès, d’une Carthage au temps des Barca, d’une Alexandrie au temps des Ptolémées, d’une Rome au temps des Césars … Par une de ces intuitions fulgurantes où un magnifique sujet de travail surgit devant notre esprit, il aperçut nettement la possibilité d’écrire sur Paris ce livre que les historiens de l’antiquité n’ont pas écrit sur leurs villes. Il regarda de nouveau le spectacle du pont, de la Seine et du quai … L’œuvre de son âge mûr venait de lui apparaître.« Diese antike Inspiration des modernen verwaltungstechnischen Werkes über Paris ist höchst bezeichnend. Im übrigen zu vergl. Léon Daudet in »Paris vécu« über den Untergang von Paris im Kapitel über Sacré Coeur. [C 4]
Der folgende merkwürdige Satz in dem Bravourstück »Paris souterrain« aus Nadars »Quand j’étais photographe« Paris 〈1900〉 (p 124〈:〉 »Dans l’histoire des égouts, écrite avec la plume géniale du poète et du philosophe, après cette description qu’il a su rendre plus émouvante qu’un drame, Hugo raconte qu’en Chine il n’est pas un paysan revenant de vendre ses légumes à la ville qui n’en rapporte la lourde charge d’un double seau rempli de ces précieux ferments.« [C 4 a, 1]
Über die Tore von Paris: »Jusqu’au moment où entre deux colonnes on voyait apparaître le commis de l’octroi, on pouvait se croire aux portes de Rome ou d’Athènes.« Biographie universelle ancienne et moderne Nouvelle édition publiée sous la direction de M Michaud XIV Paris 1856 p 321 (article PFL Fontaine) [C 4 a, 2]
»In einem Buche von Theophile Gautier, ›Caprices et Zigzags‹, finde ich eine kuriose Seite. ›Eine große Gefahr bedroht uns,‹ heißt es dort … ›Das moderne Babylon wird nicht zerschmettert werden wie der Thurm von Lylak, in einem Asphaltsee untergehen wie die Pentapolis oder versanden wie Theben; es wird einfach entvölkert und zerstört werden von den Ratten von Montfaucon.‹ Merkwürdige Vision eines unklaren, aber prophetischen Träumers! Sie hat sich im Wesen bewahrheitet Die Ratten Montfaucons … sind Paris nicht gefährlich geworden; die Verschönerungskünste Haußmanns haben sie verscheucht … Aber von den Höhen Montfaucons sind die Proletarier herabgestiegen und haben mit Pulver und Petroleum die Zerstörung von Paris begonnen, die Gautier vorhergesagt hat.« Max Nordau: Aus dem wahren Milliardenlande Pariser Studien und Bilder Lpz 1878 I p 75/76 (Belleville) [C 4 a, 3]
1899 wurden bei Metro-Arbeiten in der rue Saint-Antoine Fundamente eines Turms der Bastille entdeckt. C〈abinet〉 d〈es〉 E〈stampes〉 [C 4 a, 4]
Halles aux vins〈:〉 »Das Entrepôt, welches theils aus Gewölben für die Spirituosen, theils aus Felsenkellern für die Weine besteht, bildet … gleichsam eine Stadt, deren Straßen die Namen der bedeutendsten Weingegenden Frankreichs tragen.« Acht Tage in Paris Paris Juillet 1855 p 37/38 [C 4 a, 5]
»Les caves du café Anglais … s’étendent fort loin sous les boulevards, et forment des défilés des plus compliqués. On a eu le soin de les diviser en rues … Vous avez la rue du Bourgogne, la rue du Bordeaux, la rue du Beaune, la rue de l’Ermitage, la rue du Chambertin, le carrefour des … Tonneaux. Vous arrivez à une grotte fraîche, … remplie de coquillages …; c’est la grotte aux vins de Champagne … Les grands seigneurs d’autrefois avaient imaginé de dîner dans leurs écuries … Vivent les caves pour manger d’une façon réellement excentrique!« Taxile Delord: Paris-viveur Paris 1854 p 79-81, 83/84 [C 4 a, 6]
»Soyez persuadé que quand Hugo voyait le mendiant sur la route, … il le voyait ce qu’il est, réellement ce qu’il est réellement, le mendiant antique, le suppliant antique … sur la route antique. Quand il regardait la plaque de marbre de l’une de nos cheminées, ou la brique cimentée de l’une de nos cheminées modernes, il la voyait ce qu’elle est; la pierre du foyer. L’antique pierre du foyer. Quand il regardait la porte de la rue, et le pas de la porte, qui est généralement une pierre de taille, sur cette pierre de taille il distinguait nettement la ligne antique, le seuil sacré, car c’est la même ligne.« Charles Péguy: Œuvres complètes 1873-1914 Œuvres de prose Paris 1916 p 388/389 (Victor-Marie, comte Hugo) [C 5, 1]
»Les cabarets du faubourg Antoine ressemblent à ces tavernes du mont Aventin bâties sur l’antre de la sibylle et communiquant avec les profonds souffles sacrés; tavernes dont les table étaient presque des trépieds, et où l’on buvait ce qu’Ennius appelle le vin sibyllin.« Victor Hugo: Œuvres complètes Roman 8 Paris 1881 p 55/56 (Les Misérables IV) [C 5, 2]
»Ceux qui ont parcouru la Sicile se souviennent de ce couvent célèbre où, la terre jouissant de la propriété de dessécher et de conserver les corps, les moines, à une certaine époque de l’année, revêtent de leurs anciens costumes toutes les grandeurs humaines auxquelles ils ont accordé l’hospitalité de la tombe, ministres, papes, cardinaux, guerriers et rois; et, les rangeant sur deux files dans leurs vastes catacombes, font passer le peuple à travers cette haie de squelettes … Eh bien! ce couvent sicilien est l’image de notre état social. Sous ces habits d’apparat dont on décore les arts et la littérature, il n’y a point de cœur qui batte, et ce sont des morts qui attachent sur vous des yeux fixes, éteints et froids, quand vous demandez au siècle où sont les inspirations, où sont les arts, où est la littérature.« Nettement: Les ruines morales et intellectuelles Paris octobre 1836 p 32 Hierzu ist Hugos »A l’arc de triomphe« von 1837 zu vergleichen. [C 5, 3]
Die beiden letzten Kapitel in Léo Claretie’s »Paris depuis ses origines jusqu’en l’an 3000« Paris 1886 sind überschrieben »Les ruines de Paris« und »L’an 3000«. Das erste enthält eine Umschreibung von Victor Hugos Versen aus dem Arc de Triomphe. Das zweite bringt eine Vorlesung über die Altertümer von Paris in der berühmten »Académie de Floksima … située dans la Cénépire. C’est un continent nouveau …, découvert en l’année 2500 entre le cap Horn et les terres australes.« (p 347) [C 5, 4]
»Il y avait au Châtelet de Paris une grande cave longue. Cette cave était à huit pieds en contre-bas au-dessous du niveau de la Seine. Elle n’avait ni fenêtres ni soupiraux …; les hommes pouvaient y entrer, l’air non. Cette cave avait pour plafond une voûte de pierre et pour plancher dix pouces de boue … A huit pieds au-dessus du sol, une longue poutre massive traversait ce souterrain de part en part; de cette poutre tombaient, de distance en distance, des chaînes … et à l’extrémité de ces chaînes il y avait des carcans. On mettait dans cette cave les hommes condamnés aux galères jusqu’au jour du départ pour Toulon. On les poussait sous cette poutre où chacun avait son ferrement oscillant dans les ténèbres, qui l’attendait … Pour manger, ils faisaient monter avec leur talon le long de leur tibia jusqu’à leur main leur pain qu’on leur jetait dans la boue … Dans ce sépulcre enfer, que faisaient-ils? Ce qu’on peut faire dans un sépulcre, ils agonisaient, et ce qu’on peut faire dans un enfer, ils chantaient … C’est dans cette cave que sont nées presque toutes les chansons d’argot. C’est du cachot du Grand-Châtelet de Paris que vient le mélancolique refrain de la galère de Montgomery: Timaloumisaine, timoulamison. La plupart de ces chansons sont lugubres; quelques-unes sont gaies.« Victor Hugo: Œuvres complètes Roman 8 Paris 1881 (Les Misérables) p 297/98 □ Unterirdisches Paris □ [C 5 a, 1]
Zur Schwellenkunde: »›Entre ceux qui, à Paris, vont à pied et ceux qui vont en voiture, il n’y a que la différence du marchepieds‹, comme disait un philosophe à pied. Ah! le marchepied! … C’est le point de départ d’un pays à un autre, de la misère au luxe, de Pinsouciance au soucis. C’est le trait d’union de celui qui n’est rien à celui qui est tout. La question, c’est d’y mettre le pied.« Théophile Gautier: Etudes philosophiques (Paris et les Parisiens au XIXe siècle Paris 1856 p 26) [C 5 a, 2]