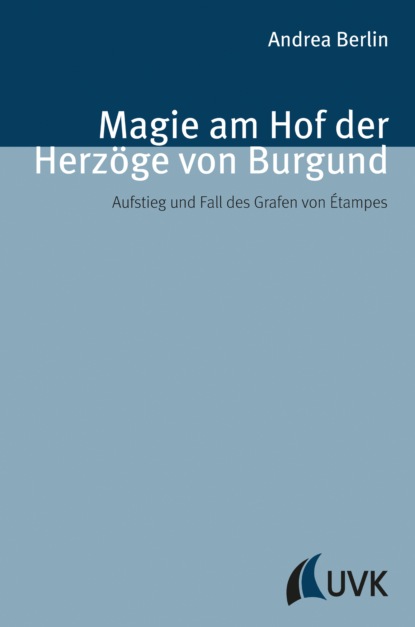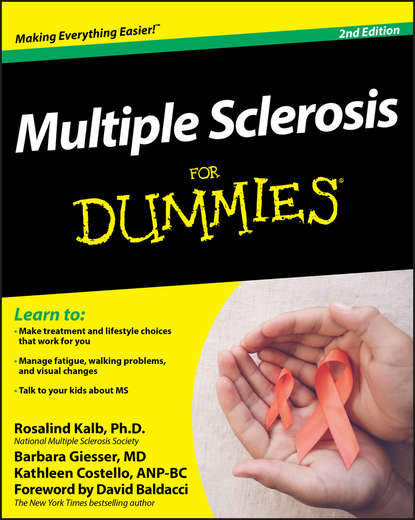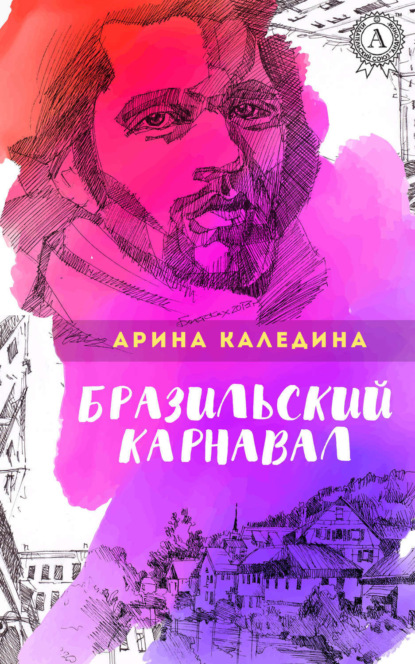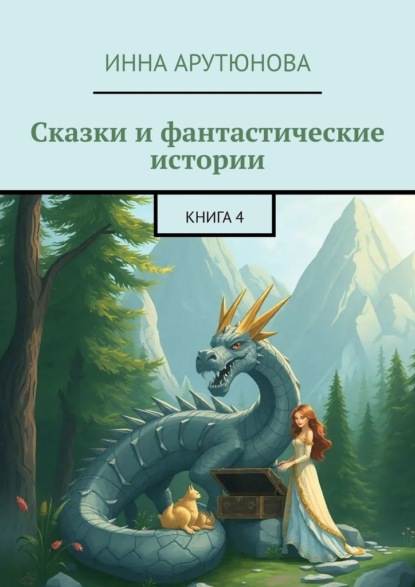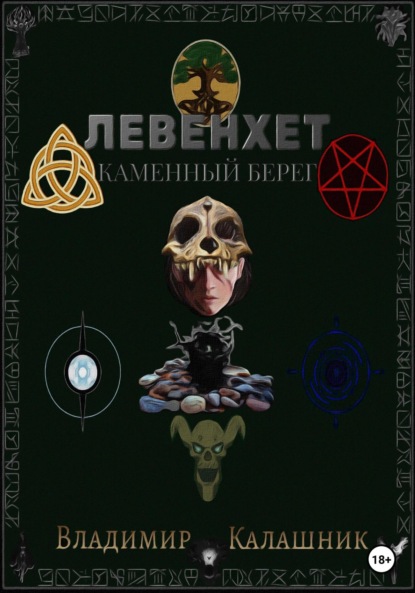- -
- 100%
- +
Jacques du Clercq und Jean de Wavrin haben erst in den letzten Jahrzehnten wieder verstärkt das Interesse der historiographiegeschichtlichen Forschung auf sich gezogen – ohne freilich, dass dieses Interesse je gänzlich abgebrochen war. Beide sind, wie bereits 1946 Jean Stengers herausgearbeitet hat, in ihren Arbeiten von der Chronik des selbsterklärten Froissart-Fortsetzers Enguerrand de Monstrelet abhängig.31 Über Jacques du Clercq ist als Person erstaunlich wenig bekannt; alle wesentlichen Details entstammen seinen Mémoires selbst.32 In der burgundischen Chronistik nimmt der Sohn eines Rats Philipps des Guten aus Lille eine Sonderstellung ein, weil er sein Werk offenbar selbstständig, jedenfalls ohne Referenz an einen fürstlichen Auftraggeber oder Adressaten verfasste – er schreibt à distance, wie Franck Mercier feststellte,33 was sich nicht nur auf die Darstellung, sondern unter Umständen auch auf den Grad der Informiertheit ausgewirkt haben könnte. Dem steht entgegen, dass du Clercq bei der Abfassung seiner Arbeit durchaus auch auf amtliche Schriftstücke zurückgegriffen hat.34 Ferner wird ein didaktischer Anspruch und eine Nähe zum Adel deutlich, die ihm möglicherweise seine Leserschaft am burgundischen Hof bescherten.35 »Er stand also«, folgert Klaus Oschema wohl zu Recht, »der Adels- und Hofkultur seiner Zeit vermutlich näher, als es die wenigen konkreten Details seiner Biographie, die wir kennen, zu zeigen vermögen.«36
Gelesen wurde du Clercq jedenfalls am burgundischen Hofe, denn Jean de Wavrin greift bei der Abfassung seines Werkes auf ihn zurück.37 Aus einer angesehenen flandrischen Familie stammend, aber unehelich geboren nahm dieser seiner Herkunft nach zunächst eine ambivalente Rolle in der burgundischen Hofgesellschaft ein, scheint dann aber eine steile Karriere am Hof gemacht zu haben.38 Mehrfach war er im Auftrag Philipps des Guten in Frankreich, England und Italien;39 auch unter Karl dem Kühnen war er beschäftigt. Bedeutsam ist ferner seine große Sammlung von Büchern gewesen, die Antoinette Naber näher untersucht hat.40 Wavrins Receuil des croniques et anchiennes istories de la Grant Bretaigne, a présent nommé Engleterre wurden und werden verstärkt von der britischen Forschung beachtet;41 seine besondere persönliche Stellung als Chronist zwischen England und Burgund hat vor einigen Jahren noch Alain Marchandisse beleuchtet.42
1.1.2. Vorbemerkungen zur Forschungsliteratur
Aufgrund der besonderen Überlieferungssituation des Aktenmaterials, das im Mittelpunkt dieser Studie steht, liegt auf der Hand, dass Forschungsliteratur dazu bislang nicht existierte. Der Prozess selbst ist der Forschung zumindest seiner Existenz nach freilich über die Erwähnungen durch burgundische Chronisten bekannt gewesen und wird hier und da auch en passant erwähnt.43 Dass er nie ausführlicher thematisiert worden ist, liegt an den allzu kurzen Erwähnungen, die sich bei den Chronisten finden lassen. Erst das nun zugängliche Prozessmaterial erlaubt es überhaupt, Licht auf die Sache zu werfen.
Bevor das Material aber einer näheren Untersuchung unterzogen wird, gilt es, einen ersten Blick auf die bisher existierenden Grundlagen zu werfen, auf denen diese Arbeit aufbauen kann. Diese Vorbemerkungen sollen allerdings nur die Aufgabe eines allgemeinen Überblicks erfüllen; Detailforschungen werden in den jeweiligen Einzelkapiteln zu diskutieren sein.
Insgesamt gesehen hat das rund hundertjährige ›Phänomen Burgund‹ – der bemerkenswerte Aufstieg eines vergleichsweise kleinen Herzogtums innerhalb weniger Generationen zu einem der zentralen Spieler auf dem Feld westeuropäischer Politik und dessen nicht minder rasches Verschwinden nach dem Tod Karls des Kühnen – die Forschung schon immer fasziniert. Eines der nicht nur in dieser Hinsicht Epoche machenden Werke ist sicherlich Johan Huizingas Herbst des Mittelalters (1919), das aber nicht am Anfang, sondern auf dem Gipfel einer Beschäftigung mit der burgundischen Geschichte während des 19. und frühen 20. Jahrhunderts steht.44 Huizinga greift in großem Maße auf die burgundischen Chronisten zurück, um sein Bild eines zutiefst zerrissenen Zeitalters zu zeichnen.
Kaum mehr überschaubar ist die Literaturlage der Burgundforschung vor allem in Frankreich und den BeNeLux-Ländern, als den ehemaligen Herrschaftsgebieten der burgundischen Herzöge geworden.45 Hervorzuheben sind dabei insbesondere die Tätigkeiten des Centre européen d’études bourguignonnes, das durch die von ihm veranstalteten Konferenzen und den daraus hervorgehenden Publikationen große Strahlkraft besitzt. Unverzichtbar und daher für die Geschichte Burgunds, die westeuropäische Geschichte und die Erforschung höfischer Strukturen zu erwähnen, sind zudem die Annales de Bourgogne, die Revue du Nord sowie die Reihe Residenzenforschung. In der Schweiz sind – historisch nicht weiter verwunderlich – vor allem Arbeiten zu den eidgenössischburgundischen Beziehungen, vor allem also zu den Burgunderkriegen, entstanden.46 Dieses Interesse ist ungebrochen und hat sich noch 2008 in der großen Landesausstellung »Karl der Kühne« niedergeschlagen, die zunächst in Bern, in den Jahren 2009 und 2010 dann auch in Brügge und Wien zu sehen war.47 Vor allem in den 1990er und 2000er Jahren hat sich auch die deutsche historische Forschung wieder stark für das burgundische Spätmittelalter interessiert, wobei das Deutsche Historische Institut Paris unter der damaligen Leitung von Werner Paravicini sicher als ein zentraler Motor dieser Beschäftigung gelten darf. Auch im Umfeld seines Kieler Lehrstuhls sind eine Reihe von Qualifikationsarbeiten und andere Schriften entstanden; gleiches gilt für den Frankfurter Lehrstuhl von Heribert Müller und den Münsteraner Lehrstuhl von Martin Kintzinger. Aber auch jenseits dieser ›Zentralorte‹ der deutschen Burgundforschung hat man in den letzten Jahrzehnten starkes Interesse am burgundischen Spätmittelalter feststellen können.
Besonderes Forschungsinteresse galt in den letzten Jahren zudem wieder der starken Position der niederländischen Städte, die häufig in Opposition zu den Herzögen von Burgund standen und deren Rebellionen nicht selten durch französische Fürsten unterstützt wurden.48 Dies hat schon 1964 Christa Dericum in ihrer Heidelberger Dissertation interessiert und ist seitdem immer wieder aufgegriffen worden.49 Der Erforschung dieser und anderer stadtgeschichtlicher Aspekte widmet sich insbesondere die Reihe Urban History, aber auch zahlreiche weitere Sammelbände und Einzelpublikationen stützen dieses Forschungsinteresse. Ungebrochen ist schließlich auch die Motivation der Burgundforschung, sich mit dem Übergang des burgundischen zum habsburgischen Reich zu beschäftigen.50
Im Mittelpunkt der internationalen Burgundforschung stand und steht aber wohl die Erforschung der burgundischen Hofkultur,51 die geradezu eine Vorbildfunktion im spätmittelalter-frühneuzeitlichen Europa erfüllt habe.52 Das betrifft insbesondere Formen der künstlerischen Repräsentation – zumal auch von Politik.53 Kaum zu trennen von der Prachtentfaltung des burgundischen Hofes sind aber auch dessen politische Verflechtungen, die immer wieder das Interesse der Forschung auf sich gezogen haben: etwa das Verhältnis zum Reich54 und zu Frankreich,55 in geringerem Maße auch zu England.56 Martin Kintzinger hat versucht, diese Verbindungen in einen umfassenden Kontext europäischer West(ver)bindung(en) einzubetten.57 In den letzten Jahren schließlich ist in auffälliger Dichte die Rolle der Frauen am burgundischen Hof auf das Tableau der Forschung gerückt.58
1.2. Historische Hinführung
1.2.1. Zur burgundischen Geschichte im 15. Jahrhundert
Der in der Forschung vorherrschende Begriff des burgundischen Staates59 bezeichnet ein ungewöhnliches politisches Gebilde im ausgehenden Mittelalter.60 Es entstand im 14. Jahrhundert mit der Vergabe des Herzogtums Burgund durch den französischen König Johann II. (1350 – 1364) an seinen jüngsten Sohn Philipp (1363 – 1404), als eine Seitenlinie des Königshauses Valois. Dieser Herzog wurde später als Philipp der Kühne bekannt. Das zunächst vergleichsweise kleine Herzogtum schaffte es innerhalb weniger Jahrzehnte, zu einem der Zentren des westeuropäischen Machtgeschehens zu werden. Diese Entwicklung vollzog sich durch die schrittweise, aber beständige Ausweitung des burgundischen Besitzes durch Erwerb, Erbe, Heirat und Krieg, die aber durch einen steten Bezug zum französischen Königtum geprägt blieb. Das dadurch entstandene Gebiet, der état bourguignon, umfasste neben dem Herzogtum und der Freigrafschaft Burgund auch Herrschaften im heutigen Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Die Herzöge von Burgund waren dadurch nicht nur von Frankreich, sondern auch vom Reich her lehnsabhängig. Daneben war das Herzogtum, insbesondere während der Zeit des Hundertjährigen Krieges, auch durch Verbindungen zum englischen Königshaus geprägt.61
Die vorliegende Studie beschäftigt sich speziell mit Ereignissen in den letzten Regierungsjahren Herzog Philipps des Guten (1419 – 1467) zu Zeiten sich verschärfender Konflikte mit seinem Sohn, dem späteren Karl den Kühnen (1467 – 1477). Daher soll im Folgenden in einigen groben Zügen die historische Situation um die Mitte des 15. Jahrhunderts, in die sich die Fallstudie des Processus contra dominum de Stampis einfügt, umrissen werden.
Die Herrschaft Herzog Philipps des Guten begann mit einem Mord, der das Verhältnis zwischen Frankreich und Burgund nachhaltig beeinflussen sollte. In der Spätphase des Hundertjährigen Krieges kam es durch Konflikte zwischen den Burgundern und den Armagnacen auch zu starken innerfranzösischen Auseinandersetzungen.62 Im Zuge dessen waren Annäherungen zwischen Karl VI. (1380 – 1422), dem Dauphin und den Burgundern notwendig geworden.63 Eines der anvisierten Treffen zwischen dem zweiten Herzog von Burgund, Johann Ohnefurcht (1404 – 1419), und dem Dauphin endete jedoch am 10. September 1419 in Montereau-fault-Yonne mit der Ermordung Johanns Ohnefurcht.64 Der Mord an seinem Vater führte dazu, dass sich der neue Herzog von Burgund, Philipp der Gute, verstärkt England zuwandte, wenngleich der französisch-burgundische Kontakt nicht vollkommen abriss. Zu einer ernsthaften diplomatischen Annäherung und einem Friedensschluss zwischen Frankreich und dem Haus Burgund kam es im Jahr 1435 mit dem Vertrag von Arras.65 Dies bedeutete zunächst vor allem das vorläufige Ende der anglo-burgundischen Beziehungen; das burgundisch-französische Verhältnis blieb jedoch trotz des Friedensschlusses angespannt und wurde insbesondere durch den Konflikt Karls VII. (1422 – 1461) mit seinem Sohn Ludwig und der Flucht des Dauphins an den burgundischen Hof 1456 noch verschärft.66 Philipp gewährte dem jungen Ludwig seine Gastfreundschaft, die dieser bis zum Tode des Vaters 1461 annahm. Bereits zu dieser Zeit soll der Dauphin eine Abneigung gegen Prunk und Gepränge gehegt haben; eine Abneigung, die sich in der Nähe der burgundischen Macht- und Prachtentfaltung vergrößert haben mag.67 Bei der Krönung Ludwigs XI. (1461 – 1483) zum französischen König ist das Haus Valois-Burgund aber als angesehener Gast vertreten. Diese Vorgeschichte mag Philipp den Guten dazu veranlasst haben, auf ein gutes Verhältnis zu Frankreich und auf einen gewissen Einfluss auf dessen neuen Regenten zu hoffen. Seine Erwartungen wurden indes durch das ambitionierte machtpolitische Agieren des Königs enttäuscht. Ludwig XI. versuchte vielmehr seit Beginn seiner Regentschaft, den Einfluss Burgunds einzudämmen.68
Dieses Vorgehen war aus französischer Sicht nur zu verständlich, zählte Philipp der Gute doch durch die glänzende Entwicklung seines Herzogtums zu den mächtigsten Fürsten in Westeuropa. So hatte sich der Herzog zunächst in einem mehrere Jahre dauernden, durchaus auch kriegerischen Ringen mit seiner Cousine Jacqueline die Grafschaften Hennegau, Holland und Zeeland gesichert.69 In anderen Fällen verlief der Gebietszuwachs friedlicher. So konnte er die Grafschaft Nemours käuflich erwerben, während das Herzogtum Brabant als Erbschaft an ihn fiel.70 Hinzu kam der Erwerb des Herzogtums Luxemburg und der kleineren Herrschaften Mâcon und Auxerre.71 1461 befand sich Philipp zudem in der Position, mehrere Revolten von Städten seiner nördlichen Territorien niedergeschlagen zu haben, unter denen besonders der lange währende Krieg gegen Gent hervorzuheben ist.72
Die selbstbewusste französische Politik Ludwigs XI. führte zu weiteren Spannungen im burgundisch-französischen Verhältnis, da auch der Graf von Charolais als zukünftiger burgundischer Herzog ihr in Sorge um sein Erbe äußerst kritisch gegenüber stand. Insbesondere der Rückkauf der Somme-Städte im Jahr 1464 verschärfte die Abneigung Karls gegen den französischen König und erhöhte zugleich die Spannungen zwischen Herzog Philipp und seinem Sohn.73 Die königliche Politik rief allerdings nicht nur in Burgund Ablehnung hervor, sondern führte zu der Formierung einer Opposition französischer Fürsten, der Ligue du Bien Public. Die Unzufriedenheit mündete in die sogenannten Guerre du Bien Public, einen Krieg mehrerer französischer Fürsten gegen Ludwig XI., in dem Karl von Burgund faktisch die Führung gegen den König übernahm. Die berühmte Schlacht von Montlhéry am 16. Juli 1465 brachte aber keine Entscheidung. Ludwig musste nach Paris flüchten, wo er mehrere Monate von seinen Gegnern belagert wurde.74 Erst mit dem Vertrag von Conflans im Oktober 1465 konnten die Konflikte für einige Zeit unterdrückt werden. Die Auseinandersetzungen zwischen Karl und Ludwig brachen allerdings nach dem Tod Philipps des Guten wieder aus und führten zu weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen, die erst mit dem Vertrag von Péronne 1468 beigelegt wurden.75
Die herausragende Stellung, die die Herzöge von Burgund unter den französischen Fürsten einnahmen, führte nicht nur zu Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen mit Frankreich und den mit dem Königtum verbündeten Fürsten. Es ergaben sich zudem, insbesondere aus dem Bestreben, die burgundische Erbschaftsfolge zu sichern, zahlreiche inner-burgundische Konflikte, auf die an späterer Stelle noch einzugehen sein wird.76 Diese Konfliktsituationen bilden gleichsam den Rahmen für die vorliegende Studie.
Der Graf von Étampes nun war nicht nur als Familienmitglied dem Haus Burgund eng verbunden. Er stand Philipp dem Guten auch bei dessen militärischen Unternehmungen zur Seite. Jedoch wurden dem Grafen seitens des burgundischen Erben Karl schwere Vorwürfe gemacht, ein Komplott gegen ihn geplant zu haben. Diese Vorwürfe reichten dabei bis zu der Anschuldigung, der Graf von Étampes habe ihm, damals noch Graf von Charolais, mittels Wachsfigurenmagie schaden wollen. Der Fall Étampes reiht sich damit in die zahlreichen Prozesse des späten Mittelalters ein, die wegen Verrats, Illoyalität oder eines Anschlagsversuchs auf den König oder einen Fürsten geführt wurden. Unabhängig davon, ob solche Vorwürfe nun gerechtfertigt waren oder nicht, wurden diese Prozesse häufig dazu genutzt, um unliebsame Gegner aus dem Weg zu räumen.
1.2.2. Der politische Prozess und das Majestätsverbrechen im späten Mittelalter
Politische Prozesse begegnen dem Historiker in der Regel als besonderes Aufsehen erregende und skandalöse Verfahren, bei denen die hervorgebrachten Vorwürfe oft den eigentlichen, politisch motivierten Hintergrund zu verschleiern scheinen.77 Für das Frankreich des späten Mittelalters denkt man dabei unweigerlich an den von Philipp dem Schönen gegen die Templer angestrengten Prozess, der schließlich zur Aufhebung dieses Ritterordens führte. Auch der Prozess gegen Johanna von Orléans, die 1430 festgenommen und in einem kirchlichen Verfahren wegen Vergehen gegen die majesté divine zum Tode verurteilt wurde, wird in der Forschung, aber auch bereits von den Zeitgenossen gemeinhin als politisch motivierter Prozess angesehen.78 Neben diesen beiden Beispielen können noch zahlreiche weitere Fälle aufgezählt werden.79 Dabei muss allerdings konstatiert werden, dass der Begriff »politischer Prozess« kein zeitgenössischer gewesen ist, dass es keine justice politique gegeben hat. Auch die Elemente, die einen solchen Prozess prägen, stimmen nicht in allen Fällen überein, obgleich man oft dem Vorwurf des Verrats, des Treuebruchs, der Rebellion, der Zauberei oder des Majestätsverbrechens begegnet. Dementsprechend können die gerichtlichen Formen der Verfolgung dieser Vorwürfe sehr unterschiedlich sein, sodass sich keine festgeschriebenen Regeln beobachten lassen.80 Allein der Hochverrat gegen den König bekam dabei im Laufe der Zeit die Bedeutung eines regelrechten Sakrilegs.81 Gemeinsam ist aber fast allen politischen Prozessen, dass sie oftmals in als krisenhaft beschriebenen Perioden in einer Herrschaft zustande kamen. Mit Friedrich Battenberg soll daher der »politische Prozess als dasjenige forensische Verfahren angesehen werden, das Konflikte um Grundlegung, Stabilisierung, Ausweitung und Verteidigung der Herrschaft lösen sollte.«82 Die Herrschaftssicherung, aber auch die Ausweitung von Macht oder die Eliminierung von potentiellen Gefahren finden sich in zahlreichen als politisch deklarierten Fällen wieder. Insbesondere zu Zeiten des Hundertjährigen Krieges und den sich anschließenden krisenhaften Jahren kam es daher im französischsprachigen Raum zu zahlreichen politischen Prozessen. Diese Prozesse sind dabei als zusätzliche Felder in einem erodierenden machtpolitischen Umfeldes zu begreifen, die sich durch innere Spannungen auf der einen und äußere Gefahren auf der anderen Seite aufbauten.
In einigen Fällen konnte daher das Verhalten einzelner Fürsten in kriegerischen Auseinandersetzungen direkt zu Anschuldigungen führen, wie beispielsweise im Falle der Konflikte um das Herzogtum Guyenne. Bis zum Ende des Hundertjährigen Krieges befand es sich noch in englischem Besitz, weswegen der französische König dem englischen König gegenüber den Lehnseid hätte schwören müssen. Karl V. weigerte sich allerdings, dies zu tun. In diesem Zusammenhang musste sich auch der (englische) Herzog von Guyenne Ende 1368/ Anfang 1369 vor Karl V. verschiedener Vorwürfe erwehren. In der Bretagne traten die französisch-englischen Konflikte offen zutage, als sich Jean IV., Herzog von Montfort, gegen den französischen König die Unterstützung Eduards III. sicherte und dafür auf französischer Seite der Rebellion und des Verrates angeklagt wurde.83 Die Register des Parlaments von Paris weisen zudem zahlreiche Prozesse aus, bei denen den Angeklagten – durchaus auch gesammelt – schwere Delikte vorgeworfen wurden. So soll es – folgt man Contamine – im Januar 1383 nach dem Einzug Karls VI. in Paris aufgrund der Aufstandsbewegung der Maillotins zu zahlreichen Festnahmen und auch Sammelexekutionen gekommen sein. Unter den Angeklagten befand sich auch der Advocat des Königs, Jean de Marès, der als einer der Anführer der Revolte verdächtigt und letztlich auch hingerichtet wurde.84 Einer der bedeutendsten Prozesse unter Ludwig XI. war der gegen den Grafen von Saint-Pol und connétable von Frankreich, Louis de Luxembourg, im Jahr 1475.85 Dieser gut situierte Graf hatte während des Hundertjährigen Kriegs zunächst die burgundische, dann auch die französische Seite unterstützt, bevor man ihn im Krieg gegen die Stadt Gent wieder auf burgundischer Seite fand. Auch in der Guerre du Bien Public kämpfte er auf burgundischer Seite und erhielt im Gegenzug die Unterstützung des Grafen von Charolais bei seiner Ernennung zum connétable von Frankreich 1465, einem Amt, das ihn wieder näher an den französischen König rückte.86 Wegen eines Komplottes im Jahr 1475, das er mit Herzog Karl geschmiedet haben soll, fiel Saint-Pol aber in Ungnade bei Ludwig XI. und wurde des crime de lèse-majesté, des Majestätsverbrechens, bezichtigt. Der Prozess gegen ihn endete mit dem Todesurteil.87 Dass dieser Prozess nicht der einzige war, den der französische König mit Bezug auf den Vorwurf eines Majestätsverbrechens angestrengt hat, zeigen die Beispiele Alençon, Armagnac und Nemours.88
Dieser Vorwurf war auffallend oft – nicht nur bei Ludwig XI. – Gegenstand von Verfahren, denen die Ausrichtung eines politischen Prozesses zugeschrieben werden kann. Seine Ursprünge wurzeln im römischen Recht, im Konzept des crimen maiestatis. Er wurde aber insbesondere durch den Kampf gegen die Häresie als Majestätsverbrechen an Gott in das kanonische Recht aufgenommen, mit dem man auf kirchlicher Seite später auch gegen die Zauberei vorging. Auch das spätmittelalterliche französische Recht bezog sich auf die römische Gesetzgebung hinsichtlich des Hochverrates. Die Vereinnahmung dieser Anklage von der weltlichen Gerichtsbarkeit ließ daher nicht lange auf sich warten, sodass spätestens zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Verknüpfung von Verrat und Majestätsverbrechen unbestritten war.89 Ähnlich wie der Begriff des politischen Prozesses weist der Vorwurf des Majestätsverbrechens – obgleich ein zeitgenössischer Begriff – keine eindeutig abgrenzbaren Elemente auf. Es können Übereinstimmungen zu und Assimilation von einer Reihe anderer Verbrechen festgestellt werden, etwa Verrat, Aufruhr, Rebellion, Mord, Verstöße gegen die Sicherheit, aber auch Zauberei, Häresie oder dem Handeln wider der Natur. Der Vorwurf eines Majestätsverbrechens konnte sowohl bei nur einem dieser Verbrechen als auch im Zusammenschluss mehrerer auftauchen. Es ist daher offensichtlich, wie einfach es für einen König im 14. und 15. Jahrhundert war, aus einer krisenhaften Situation heraus den Vorwurf des Majestätsverbrechens zu erheben.90 Cuttler grenzt zwar deutlich den Verrat oder Treuebruch eines Untertanen gegenüber seinem Fürsten zu dem Majestätsverbrechen gegenüber dem König ab,91 doch zeigt sich, dass der Vorwurf gerade auch von den burgundischen Herzögen erhoben wurde. Das prominenteste Beispiel ist hierbei die Ermordung Herzog Johanns Ohnefurcht. Sein Sohn Philipp der Gute erhob angesichts dieses Verbrechens den Vorwurf des Majestätsverbrechens – eine Anschuldigung, die von französischer Seite nicht geteilt wurde.92 Mercier sieht sogar im Zusammenhang mit den städtischen Unruhen der Jahre 1450 – 1458, die hauptsächlich Gent betrafen, Ansätze von Verschwörungen gegen den Fürsten, die sich als Majestätsverbrechen klassifizieren ließen.93 Auch unter Karl dem Kühnen lässt sich verschiedentlich die Äußerung dieses Vorwurfs feststellen,94 was wiederum auf das Selbstverständnis der burgundischen Herzöge des 15. Jahrhunderts als souveräne Herrscher schließen lässt.95 Der Vorwurf des Majestätsverbrechens diente als eine aus dem römischen Recht entlehnte Rechtsfigure, die als Argument herangezogen werden konnte, aber durchaus nicht immer musste. Deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass auch die burgundischen Herzöge sich dieser Figur bedienten – möglicherweise, aber nicht zwingend, auch, um ihre Stellung gegenüber dem Königtum zu unterstreichen.96 Andererseits ist – darauf hat Blanchard zurecht hingewiesen – die Idee herrschaftlicher Souveränität um die Mitte des 15. Jahrhunderts noch nicht so ausgeprägt, das mit einer juristisch auch nur einigermaßen zwingenden Argumentation zu rechnen wäre.97
Die Tendenz von Fürsten im Spätmittelalter, Prozesse zu politischen Zwecken zu instrumentalisieren, hatte zugleich Einfluss auf die Bedeutung dieser Prozesse. Zum einen wirkten sie sich auf die Ausformung der fürstlichen Souveränität aus, denn ein Angriff auf ebendiese Souveränität hätte Konsequenzen auf der Ebene der öffentlichen Ordnung nach sich ziehen können.98 Zum anderen wurde die Öffentlichkeit gerade bei Verbrechen gegen hohe Fürsten instrumentalisiert, um vor eben dieser Verfahren zu begründen oder zu rechtfertigen und um die Vergehen des Angeklagten bekannt zu machen, wie dies auch bei einigen Fällen zu zeigen sein wird, die den burgundischen Erben und späteren Herzog Karl den Kühnen betreffen.99 Die Bedeutung eines politischen Prozesses wuchs dabei proportional zu dem Interesse, das dem Fall in der Öffentlichkeit zukam. Ein Verfahren etwa, das den Vorwurf des Majestätsverbrechens aufgrund der Ausübung von Zauberei gegen den König beinhaltete, konnte sich dabei eines öffentlichen Interesses nicht entziehen, wie die zahlreichen in der Chronistik überlieferten Fälle zeigen. Dazu gehören beispielsweise aus dem Umfeld König Philipps des Schönen (1285 – 1314) die Zaubereivorwürfe gegen Guichard, den Bischof von Troyes, dem der Umgang mit einer Zauberin und die Anwendung von Wachsfigurenmagie und Teufelsanrufung zur Schädigung der Königin nach deren plötzlichem Tod vorgeworfen wurden.100 Dem Vorwurf des Majestätsverbrechens folgte häufig die Verhängung der Todesstrafe. Der prominente Fall des Herzogs Jean d’Alençon zeigt aber, dass diese durchaus auch in Begnadigungen oder in Haftstrafen umgewandelt werden konnten. Jean d’Alençon sah sich durch den Vertrag von Arras 1435 um seine Ziele und Verdienste gebracht und begab sich in Opposition zu Karl VII. Er wurde mehrfach, sowohl unter Karl VII. als auch Ludwig XI., des Majestätsverbrechens beschuldigt und zum Tode verurteilt. Die Gründe für die harten Strafen lagen in der schwankenden Loyalität des Herzogs. Jean kollaborierte mit den Engländern und wurde 1456 von König Karl VII. eingekerkert. Die Todesurteile gegen ihn wurden aber nicht vollstreckt; unter Ludwig XI. wurde er sogar begnadigt. Gegen diesen paktierte Jean 1467 allerdings wiederum mit den Herzögen von Burgund und der Bretagne, entfernte sich aber aufgrund von Geldzahlungen des Königs von der Ligue du Bien Public. 1473 wurden eine weitere Verschwörung mit dem Herzog der Bretagne und Edward IV. aufgedeckt und er wurde ein weiteres Mal, diesmal von Ludwig XI., zum Tode verurteilt. Erneut wurde Jean d’Alençon begnadigt und seine Strafe in lebenslange Haft umgewandelt, in der er 1476 starb.101