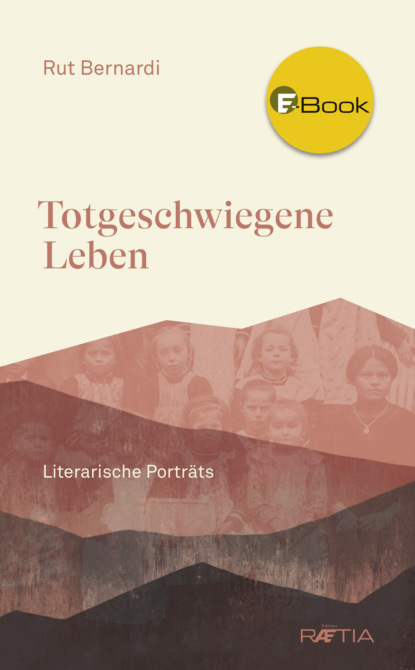- -
- 100%
- +
Maria Theresia war überwältigt, sie brachte kein Wort heraus. Die Äbtissin bemerkte dies und verabschiedete sich freundlich: „Sie müssen sehr müde sein. Der Tag war lang und anstrengend. Ruhen Sie sich aus, morgen sieht alles leichter aus. Sie werden sehen.“
Die Äbtissin sollte Recht behalten. Am nächsten Morgen, als Maria Theresia durch einen Glockenklang für die Laudes geweckt wurde, fühlte sie sich so ausgeruht wie schon lange nicht mehr. In ihrer Unkenntnis der Klosterregeln hatte sie auch nicht bemerkt, dass sie in ihrer ersten Nacht im Kloster nicht zur Matutin oder der Vigil, dem Nachtgottesdienst, geweckt worden war.
Voller Erwartung ging sie mit den anderen Schwestern in den Chor zum Morgengebet, um das aufgehende Licht am Peitlerkofel, der Pütia, im hinteren Villnößtal zu grüßen und preisen. Auf dem kurzen Weg durch den Gang des Schlafsaals bis zur Klosterkirche strich ihr plötzlich etwas Flauschiges um die Beine, sodass sie für einen kurzen Augenblick erschrak. Natürlich hatte Luzifer, der Lichtträger, Venus schon lange vor den Nonnen begrüßt und begleitete diese nun noch einmal zum Gebet. Maria Theresia setzte sich zuhinterst in eine Bank und der schlaue Luzi versteckte sich unter ihrem langen schweren Rock, den sie auch am Vortag auf ihrem Fußmarsch getragen hatte.
Die Kantorin stimmte den feierlichen Lobchoral Wie schön leuchtet der Morgenstern für den himmlischen Bräutigam an. Ergriffen von der Melodie und dem Text, kniete Maria Theresia bis zum Ende bewegungslos und andächtig und vergaß dabei völlig, dass Luzi immer noch auf ihren Unterschenkeln schlief. Dieser war indessen von der Wärme unter dem dicken Rock, wie man ihn nur in hochgelegenen Bergtälern trug, so begeistert, dass er es sich auch nach der Einkleidung Maria Theresias wie selbstverständlich jeden Morgen unter der dicken Kukulle aus Wolltuch bequem machte.
Den Laudes waren nach einer kurzen Pause die Meditation und die kleinen Horen, beginnend mit der Prim, gefolgt. Es wurde schweigend ein leichtes Frühstück eingenommen, bis es im Kapitelsaal mit der Lesehore zur geistlichen Vertiefung der Heiligen Schrift weiterging. Der 13. August war der Tag des Heiligen Kassian, des legendären ersten Bischofs von Säben. Daher wurde anschließend noch das Martyrium des Kassian von Imola, der im 3. Jahrhundert als Schulmeister in antiheidnischem Eifer das Christentum lehrte und von seinen wütenden Schülern mit ihren Schreibgriffeln erstochen wurde, vorgelesen. Zur Ankunft der Novizin wurden zudem noch einige Kapitel aus der Regula ora et labora et lege vorgetragen, die von Gehorsam, Schweigen und Demut handelten.
Dann ging jede Schwester an ihre Arbeit, und Maria Theresia wurde an ihrem ersten Morgen im Kloster in die Bibliothek geführt, wo Franziska Xaveria, die Bibliothekarin des Klosters, sie empfing. Die nur sechs Jahre ältere Chorfrau war schon seit zwölf Jahren auf Säben und hatte den Auftrag bekommen, Maria Theresia ins Klosterleben einzuführen. Diese sollte in den ersten sechs Monaten ihrer Postulatszeit die Ordensgemeinschaft und die Grundlagen des geistlichen Lebens kennenlernen, sich im Gemeinschaftsleben erproben und sich in die monastische Spiritualität einüben.
Notwendige Voraussetzung für ein kontemplatives Leben sei vor allem die inwendige Stille, hob Schwester Franziska hervor, wobei sie die Reaktion ihres Schützlings genau beobachtete, der ihr unerwartet erfreut zulächelte. Als junges Mädchen hatte Maria Theresia Deutsch, genauer gesagt, deutsche Dialekte, nur von den auswärtigen Waldarbeitern, die für Holzschlägerungen ins Tal gekommen waren, gehört. Sie hatte diese auch bald weitgehend verstanden, wie Kinder eben schnell und unbewusst fremde Sprachen verstehen. Doch das vornehmere Hochdeutsch der Chorfrauen jagte ihr Furcht ein, und sie war zunächst froh, schweigen zu dürfen. Für Maria Theresia war alles neu und fremd, und auch die vielen Bücher irritierten sie.
Es folgten die tägliche Konventsmesse und, da es ein Feiertag war, noch zusätzlich die Terz, das dritte Stundengebet mitten am Vormittag. Um nicht aufzufallen, beobachtete Maria Theresia genau, was die Mitschwestern taten, um es ihnen gleichzutun. Nach den Zeremonien und den Litaneien begann wieder die Zeit des labora, und die Schwestern machten sich an die Arbeiten, die ihnen zugewiesen waren.
Der Vormittag ging bis zur Mittagshore schnell vorüber. Nach der Sext versammelten sich die Schwestern wieder im Refektorium, wo nach dem Tischgebet schweigend zu Mittag gegessen wurde, wobei wie am Vorabend eine Schwester aus der Bibel vorlas. Danach konnten sich die Schwestern bis zur Non, der Todesstunde Christi, ein wenig ausruhen.
Vor dem Abendessen traf man sich nochmals in der Kirche zum Vespergebet, der letzten Tageshore, die mit einem Vaterunser abgeschlossen wurde. Die monoton-einschläfernden Wiederholungen des Ave-Maria ließen Maria Theresia in ein Wohlsein sorgloser Leere fallen. Auch daheim, das spürte sie, betete die Familie zur selben Zeit dasselbe Gebet zur Glorreichen, vielleicht ein wenig unaufmerksamer und flüchtiger, um dann die immergleiche Brennsuppe zu essen. Freilich, dort blieb nun ein Stuhl frei, aber man würde darüber kein unnützes Gerede vergeuden.
Die Zeit bis zur Komplet, dem tagesabschließenden Nachtgebet, war auf Säben der Lektüre vorbehalten. Das geistliche Buch auf dem Lesepult, aus dem einige angemerkte Kapitel vorgetragen wurden, war die Nachfolge Christi des Thomas von Kempen. Offensichtlich hatte jemand gerade solche Stellen, die zur Loslösung von den Nichtigkeiten des Weltlichen und zur Überwindung der Eigenwilligkeiten des Ichs ermuntern sollten, zur Vorlesung ausgesucht. Es waren durchwegs Sätze, die im Geheimen mit der friedvoll gelassenen Stimmung Maria Theresias übereinstimmten. Auch sie versprach sich im Einklang mit den nächtig besänftigenden Gedanken die schon seit Längerem ersehnte Loslösung von innerem Leid und Schmerz. Und dennoch vernahm sie inmitten dieser Stille zugleich eine verwirrende Nebenstimme, die das heilig Besänftigende in etwas dunkel Gefährliches zu verkehren suchte. Dieses Doppeldeutige würde sich allerdings erst einige Jahre später klären. Dann würde man ihr so viel Lateinisches angelernt haben, dass sie auf die allzu vereinfachenden Übersetzungen verzichten könnte. Sie würde in der dunkleren Urfassung blättern können und lesen: „ad patiendum et laborandum scias te vocatum … habitus … modicum confert; sed mutatio morum et integra mortificatio passionum …“7
Nach der Lektüre saßen die Schwestern noch gemütlich beisammen und verrichteten Handarbeiten, wobei auch das tagsüber heilige Stillschweigen gebrochen werden konnte. Die darauffolgenden Abendgebete waren die längsten und für Maria Theresia die mühsamsten. Ihr fielen dabei immer wieder die Augen zu.
Maria Theresia hatte ihren ersten Tag auf Säben empfunden, als sei es der längste Tag ihres Lebens gewesen. So viel Neues hatte sie gesehen und gehört. Zu Hause hatte sie nicht einmal in einer ganzen Woche so viel gebetet wie hier an einem einzigen Tag, obschon sie auch zu St. Maria ad Nives, zur Schneemadonna in Wolkenstein, täglich zur Messe gegangen war. Sobald sie auf ihrer Bettstatt lag, versuchte sie, ihre Gedanken zu ordnen und den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen. Doch ihre Gedanken schafften es nicht einmal bis zur Konventsmesse, als sie schon eingeschlafen war.
Das frühe Aufstehen war Maria Theresia von zu Hause gewohnt. Sie war jeden Morgen mit dem Vater in den Stall gegangen, aber niemals, ohne zuvor gefrühstückt zu haben. Umso mehr staunte sie schon nach einer Woche über die Wirkung des Betens im nüchternen Zustand. In diesen Morgenstunden hatte sie das Gefühl, vollkommen klar und im Einklang mit sich selbst denken zu können. Sie empfand ihren Zustand als stimmig und spürte so etwas wie Glück. Es war ein starkes Gefühl, das sie jeweils einige Sekunden lang ansprang, aber Maria Theresia konnte sich nicht erklären, woher es kam. Sie schloss die Augen, ließ es durch sich hindurchfließen und dachte an ihre Tiere zu Hause, die sie so sehr vermisste, wobei sie das leichte Schnurren Luzis an ihren Beinen unter dem schweren Chormantel fühlte.
Tag um Tag verging immer rascher auf Säben und Maria Theresia bemerkte gar nicht, wie schnell sie sich an das neue Leben gewöhnte und es liebgewann: die Tagesordnung, die Stille, das Gebet, die regelmäßige Arbeit, die Schwesterngemeinschaft, die neue Sprache und natürlich Luzifer. Es war tatsächlich erstaunlich, wie schnell für Maria Theresia die deutsche Sprache vertraut wurde. Die Bibelgeschichten, die sie zu Hause bereits in ihrer Muttersprache Ladinisch gehört und auf Italienisch gelesen hatte, konnte sie in kürzester Zeit ohne Mühe auch auf Deutsch lesen. Sie verbrachte so viel Zeit, wie die Äbtissin es ihr erlaubte, in der Bibliothek und freute sich auf die Lesezeit am Abend, wobei sie bald auch lateinische Bücher las. Sie vertiefte sich selbstverständlich immer wieder in die Bibel, doch vor allem liebte sie die Lektüre im Stundenbuch, dem Gebets- und Andachtsbuch für das Stundengebet. In der Bibliothek wurde ein außergewöhnlich schönes Exemplar mit handkolorierten Bildern aufbewahrt.
Sobald die Bibliothekarin Franziska Xaveria die Freude Maria Theresias an den Büchern bemerkt hatte, erzählte sie Maria Theresia vom Reichtum einer untergegangenen Bibliothek, der allerersten und einzigen Bildungsstätte Tirols, und zwar der Domschule, die schon vor dem Jahr 1000 n. Chr. auf Säben durch Erlass Karls des Großen existiert hatte. Diese Schule zur Vorbereitung für den geistlichen Stand genoss ein so hohes Ansehen, dass die Schüler von weither kamen. Gelehrt wurde das Trivium (Grammatik, Dialektik und Rhetorik) und das Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik), wobei speziell die Musikpraxis gut organisiert gewesen sein musste. Doch als Bischof Richpert in den 60er-Jahren des 10. Jahrhunderts den Bischofssitz schrittweise vom felsigen Säben auf das ebene Gebiet von Brixen verlegte, was durch die Schenkung des Meierhofs Prihsna von König Ludwig dem Kind an Bischof Zacharias von Säben ermöglicht wurde, übersiedelte auch die Domschule nach Brixen.
Bedingt durch Maria Theresias Bildungseifer und ihr außergewöhnliches Erinnerungsvermögen war ihr trotz nichtadeliger oder bürgerlicher Herkunft der Weg zur Chorfrau bestimmt. Doch zunächst wurde sie während der gesamten Postulats-, Noviziats- und Professzeit, wie alle Laienschwestern, einem täglich zu verrichtenden klösterlichen Arbeitsbereich zugeordnet. Gemäß ihrer Neigung und Fähigkeit hatte die Äbtissin Marie Theresia einen Aufgabenbereich in der Landwirtschaft als sogenannte Ökonomin zugeteilt. Die schwere und aufwendige Arbeit im klösterlichen Stall wurde zwar von Laienschwestern und Viehmägden geleistet, doch die Chorschwester hatte die Aufgabe, sie so gut sie konnte zu unterstützen. Neben den Ämtern im Bereich des Gartens war dies ein Amt von hohem Stellenwert, da die Landwirtschaft nicht nur zur eigenen Grundversorgung diente, sondern auch ein wirtschaftliches Standbein war: Die Tierökonomin hatte die Aufgabe, für die Stallung der Nahversorgung und das in der Klausur gehaltene Kleinvieh an Geflügel, Katzen und Bienen zu sorgen.
Während die anderen Schwestern sich in der kurzen Pause nach den Laudes wuschen oder lasen, lief Maria Theresia jeden Tag rasch durch den Garten nach Bethlehem hinunter, wo die Tiere schon sehnsüchtig, besser, hungrig auf sie warteten. Luzifer flitzte immer schon voraus und wartete am Eingangstor des Stalles, bis Maria Theresia endlich kam. Sie beeilte sich, den Kühen, Ochsen, Pferden und Ziegen aus dem Futterloch ein wenig Heu in die Krippe hinunterzuwerfen und den Schweinen den Kübel Küchenabfälle, den Schwester Magdalena jeden Morgen bereitstellte, in den Trog zu schütten, um sofort wieder hinauf in die Kirche zur Prim zu laufen, denn sie wusste, dass dem gemeinsamen Beten nichts vorzuziehen war. Sie hatte gelobt, mit all ihren Kräften Gott zu suchen, auch wenn ihr die Tiere mehr am Herzen lagen. Luzi, der die Fütterung genau verfolgte, wusste, dass gleich darauf die Viehmagd kommen würde, die Kühe zu melken, und er ein wenig Milch bekommen würde, deshalb begleitete er Maria Theresia nicht mehr hinauf ins Kloster.
Die Hennen im Gehege vor der Küche wurden inzwischen von der Geflügelmagd versorgt. Doch nach der Konventsmesse schaute Maria Theresia trotzdem immer auch im Hühnergehege vorbei, ob auch alle Hennen noch da seien. Fuchs, Marder, Iltis und Dachs konnten den Hennen auf Säben, vor allem der Klausurmauer wegen, nichts anhaben. Doch die Habichte, und zwar die größeren Weibchen, konnten im Winter, wenn Nahrungsmangel herrschte, den Hennen durchaus eine Gefahr werden. Maria Theresia fürchtete sich auch vor den anderen Greifvögeln, dem Bussard, dem Sperber und dem Turmfalken, die mit den warmen Aufwinden über dem steilen Säbener Felsen kreisten und im richtigen Moment blitzschnell einen Vogel, eine Maus oder ein anderes kleines Tier erbeuteten.
Wenn Maria Theresia am Morgen durch den Garten lief, sah sie immer wieder Insekten, die sie noch nie gesehen hatte. Trotz Eile blieb sie stets einen Augenblick stehen und bewunderte erstaunt die Geschöpfe Gottes, ja, für sie waren sie dem Menschen gleichwertig und sie verstand nicht, wie es zur Herabsetzung des Tieres zur Ware hatte kommen können. Die Natur unterwerfen und über die Tiere herrschen, das kam für sie einfach nicht in Frage. Sie konnte das von der Religion überlieferte Gesetz, dass nur der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen worden sei, einfach nicht beachten. Ihr deuchte eher, der Mensch habe seinen Gott als Ebenbild seiner selbst geschaffen und dabei die Tiere vergessen. Und den Menschen seiner Sprache wegen dem Tier als überlegen zu erachten, erschien ihr mehr als fragwürdig und lächerlich.
Sprache war für Maria Theresia nicht lediglich eine Reihe aufeinanderfolgender Wörter. Sprache bedeutete für sie viel mehr, und das Spektrum der Kommunikation reichte bei ihr von einer Palette vieler nonverbaler Ausdrücke, wie Blicken, Gesten oder Berührungen, bis hin zu unzähligen Tierlauten, die sie mit der Zeit zu deuten gelernt hatte. Sie behandelte alle Geschöpfe mit Würde und sprach mit allen, Menschen wie Tieren, auf gleicher respektvoller Ebene. So begrüßte sie alle kleinen Tiere, denen sie auf ihrem Weg durch den Garten begegnete, und sprach leise ein paar nette Worte zu ihnen. Die Schweigepflicht galt für Maria Theresia nur für Menschen, denn das Sprechen mit Tieren bedeutete für sie gegenseitigen Gefühlsaustausch der Zuneigung mit Lauten.
Besonders beeindruckt war sie von den Smaragdeidechsen. Nach den Wintermonaten beobachtete sie bei der Lacerta viridis, der großen grünen Smaragdeidechse, die erste Häutung, wobei sich deren Kinn-, Kehl- und Halsregion im schönsten Kornblumenblau verfärbte. Doch auch Luzifer fand an allen Eidechsenarten großen Gefallen und jagte sie wie wild umher. Er erwischte meistens nur ihren Schwanz, der sich sofort vom Körper löste, wobei sie selbst ihm entwischen konnten. Er spielte und tobte sich dann mit dem Eidechsenschwanz aus, der sich noch ganze vier bis fünf Minuten lang heftigst bewegte, und Maria Theresia war froh, dass er nicht die Eidechse folterte. Blindschleichen fing er noch leichter, aber Maria Theresia schaffte es für gewöhnlich, ihn mit anderen Spielen abzulenken und die Schleichen zu verjagen, sodass er sie nicht mehr finden und misshandeln konnte.
Unter den unzähligen Käfersorten, von denen Maria Theresia viele auf Säben zum ersten Mal sah, mochte sie den Hirschkäfer oder den Donnergugi, wie die Bauern ihn nannten, am liebsten. Doch auch der Alpenbock mit seinen langen Fühlern und dem wunderbaren blauen Gewand hatte es ihr angetan. Und wenn sie ein wenig Zeit hatte, ging sie zum Ameisenhaufen, den sie eines Tages am Rand des Klostergartens unter einem Baum entdeckt hatte. Es waren kleine rote Waldameisen, mit denen Luzi weniger Freude als mit den Eidechsen hatte. Er beschnupperte meist kurz die Ameisenstraße und suchte sich dann schnell ein sicheres höhergelegenes Plätzchen, von wo aus er alles im Blick hatte und nicht in die Pfoten gepikst wurde.
Schon zu Hause hatte sie oft in den Wäldern von Juac oberhalb des elterlichen Hofes wie hypnotisiert den Ameisen bei ihrer emsigen Arbeit zugesehen. Sie verstand nicht, wie jede einzelne Ameise bei solch einem Gewimmel Bescheid wusste, wohin sie gehen und was sie tun musste. Sie müssen sich untereinander verständigen können, sonst würde ein solcher Staat nicht funktionieren, dachte sie und war überzeugt, dass die Ameisen, genauso wie alle anderen Tiere, miteinander sprachen. In ihre Gedanken vertieft, sah Maria Theresia die Ameisen in ihrem Bau wie die Nonnen und sich selbst im Kloster, wo eine Einzelne verloren wäre, aber alle gemeinsam unbezwingbar waren, wie sich in den Folgejahren herausstellen sollte. Plötzlich spürte sie ein Kribbeln und Jucken an den Beinen. Sie sprang auf und lief Hals über Kopf davon, gefolgt von Luzi, der dann schnell vorausstürmte.
Etwas zurückhaltender war sie bei den Skorpionen. Nicht dass sie vor ihnen Angst gehabt hätte, aber sie waren durch ihre geschickte Gangart nach allen Richtungen so flink, dass sie unberechenbar waren, und die vielen Augenpaare – genau hatte sie sie nie gezählt – machten einen unheimlichen Eindruck auf sie. Wenn sie einen davon ausgetrocknet fand, nahm sie ihn mit, hängte ihn mit einem Bindfaden am Schwanz neben ihrer Bettstatt auf und bestaunte immer wieder dessen schönen filigranen Körper. Doch seit jenem Tag, an dem Maria Theresia erfahren hatte, wie die Klosterapothekerin Schwester Karitas Skorpenöl herstellte, jagte sie alle Skorpione, die sie im Garten sah, die steile Felsenwand hinunter, damit sie nicht eingesammelt und lebend ins heiße Olivenöl geworfen werden konnten, wo sie in Todesangst ihr Gift freisetzten. Das Skorpenöl wurde gegen Koliken, Gicht, Ohrenschmerzen, Harnbeschwerden und gegen die Pest eingesetzt. „Lebend bringen sie uns den Tod und tot schenken sie uns das Leben“, sagte Schwester Karitas.
Die Gottesanbeterin oder das Maringgele, wie sie von den Bauern genannt wurde, liebte Maria Theresia über alles. Es war das erste Lebewesen, das sie auf Säben willkommen geheißen hatte. Damals hatte sie sich vor der großen eigenartigen Sechsfüßlerin und Neuflüglerin noch gefürchtet, doch mit der Zeit waren sie Freundinnen geworden. Die langanhaltende Reglosigkeit – die Gottesanbeterin verharrte oft stundenlang unbeweglich, um dann blitzschnell mit den langen ausklappbaren Fangbeinen in der Luft eine Fliege zu fangen – faszinierte Maria Theresia genauso, wie die Gottesanbeterin als Tarnung ihre Farbe und Gestalt an die Umgebung so genau anpassen konnte, dass man sie nur selten sah. Wenn Maria Theresia eine entdeckte und sie leise ansprach, drehte diese ihren Kopf mit dem kleinen spitzen Mund in ihre Richtung, schaute sie mit den großen Marsmännchenaugen verwundert an und hörte aufmerksam zu, wie Maria Theresia ihre Schönheit lobte, ihre Bewunderung für die meditative Fähigkeit, im Jetztzustand auszuharren, bekundete und ehrfürchtig beichtete, auf ihrem Gottesweg noch lange nicht so weit zu sein.
Seltener sah Maria Theresia Eichhörnchen, denn sie lebten im angrenzenden Wald. Aber ab und zu huschten einige über die Klostermauer, um auf den Obstbäumen herumzuklettern und zu spielen oder um ein paar Beeren, Nüsse oder Früchte zu suchen. Wie verhext beobachtete Maria Theresia die kleinen flinken Akrobaten mit ihren buschigen Schwänzen und den aufrechten Ohrpinseln. Zu Hause in Wolkenstein hatte sie in den Wäldern schon öfters hell- oder dunkelbraune Eichhörnchen mit weißen Brustlätzchen gesehen und wunderte sich, dass hier auf Säben so viele völlig schwarz waren. „Diese Eichhörnchen, wir nennen sie Kätzchen, leiden an Melanismus, einer Art genetischer Schwarzfärbung der Haut und des Fells, da sie auf Säben einer erhöhten Sonneneinstrahlung und im Winter niederen Temperaturen ausgesetzt sind. Und weil sie so andersartig sind, werden sie – gerade wie schwarze Murmeltiere – von den eigenen Artgenossen oft ausgeschlossen und suchen deshalb gern die Gesellschaft der Menschen“, klärte Schwester Karitas Maria Theresia auf.
So oft Maria Theresia konnte, lief sie die Treppe hinauf, die zur Heilig-Kreuz-Kirche führte. Im beinah rechteckigen, am Morgen lichtdurchfluteten Kirchenschiff überkam sie ein Gefühl von Leichtigkeit und Ruhe. Nur bei Wallfahrten zum wundertätigen Kruzifix der Heilig-Kreuz-Kirche – wie zum Beispiel jene der Gadertaler, die seit Jahrhunderten nach Säben pilgerten, um Beistand gegen Rübenwürmer, Heuschrecken und andere Katastrophen, wie Sonnenfinsternisse, Erdbeben oder den Schwarzen Tod, zu erbitten – füllte sich die Kirche bis auf den letzten Platz. Doch gerade in den ersten Jahren Maria Theresias auf Säben wurde den Gadertalern das Jí en Jeunn, der Gang nach Säben, untersagt. Erst nach dem Tod Josephs II. wurde die Wallfahrt 1792 wieder aufgenommen, und in den Folgejahren wurde sie nur noch im Jahr 1804 durchgeführt. Die Schwestern freuten sich immer so sehr auf den 13. Juni, den Tag des heiligen Antonius, und konnten die Ankunft der Gadertaler kaum erwarten. Maria Theresia war so ergriffen, die Wallfahrer – seit einiger Zeit waren nur noch Männer zugelassen – in ihrer Muttersprache beten zu hören. Sobald sie am Morgen die Pilger auf der orografisch linken Eisackseite aus dem Villnößtal kommen sah, betete sie, wie sie es für sich immer leise tat, auf Ladinisch mit, bis alle die Heilig-Kreuz-Kirche erreicht hatten. Die Schwestern saßen während der heiligen Messe in einem über dem Eingang abgeschirmten Raum, wo man sie nicht sah.
Am liebsten verweilte Maria Theresia allein im breiten Kirchenraum. Hier, auf dem höchsten Punkt des Berges, hatte sie das Gefühl zu schweben, ähnlich wie zu Hause, als sie durch Wald und Wiesen, über Felsstufen in Serpentinen bis auf Stevia hinaufgestiegen war, um sich bei den Tieren frei und sicher zu fühlen. Die Wände und die Decke der Kirche waren 100 Jahre zuvor, noch bevor die ersten Nonnen aus Nonnberg ankamen, vom Kulissenmaler Johann Baptist Hueber aus Neustift im Auftrag des Klausner Pfarrers Matthias Jenner vollständig ausgemalt worden. Die Säulenhalle mit den drei zum Grab eilenden Frauen und dem mahnenden Engel sowie der Kalvarienberg und die Grablegung mit den bewaffneten Soldaten weckten in Maria Theresia, speziell durch die Bodenmuster, eine solch illusionistische Raumerweiterung, dass sie immer wieder die Perspektivbilder berühren musste, um sich zu vergewissern, dass es nur flache Wände waren. Ebenso hinterließ die flache Holzdecke, die mit einer Leinwand überzogen und vollständig mit Scheinornamentik einer Balustrade und Darstellungen der Geißelung Christi, der Kreuzigung und der Himmelfahrt bemalt war, in ihr den Eindruck, sie würde durch die Wolken bis in den Himmel blicken. Diese raffinierte Architekturmalerei, die dem Domkapitel seinerzeit äußerst missfallen hatte, war tatsächlich mit der Absicht gemalt worden, den Blick durch die Wände und durch die Decke ins Freie zu leiten, und wurde von der maßgebenden Stelle in Brixen nicht gern gesehen, da sie nur auf Schein und nicht auf Beständigkeit beruhte. Die perspektivische Sicht in die Ferne bewirkte in Maria Theresia tatsächlich einen luftigen Durchblick in die Unbeschwertheit. Nur hier fühlte sie sich ruhig, frei, schmerzlos und bisweilen sogar glücklich. Es waren Augenblickszustände der Freiheit, die ihr viel Kraft schenkten und mit dem klösterlichen Gehorsam ein wohltuendes Gleichgewicht herstellten.
Maria Theresia hatte auch gleich bemerkt, dass der Maler erstaunlich viele Tiere in seine Malerei eingeschmuggelt hatte. Sie versuchte, alle Tiere ausfindig zu machen. Es waren vor allem Vögel im weitesten Sinne: Tauben als Symbole für den Heiligen Geist, eine Schwalbe, ein Papagei, ein Pfau, ein Adler, ein Hahn, ein Fasan und ein fliegender Drache. Gerade dieser fliegende Drache beschäftigte Maria Theresia sehr, denn es war im Grunde gar kein Drache, sondern vielmehr eine Mischung aus Hahn, Vogel, Schlange und Echse, die feuerspeiend ein beflügeltes Wesen – wohl Christus – in die Hölle verjagte. Es war ein Basilisk, der eine sonderbare Wirkung auf sie ausübte. Sie fühlte sich von diesem Tier gleichermaßen angezogen wie abgestoßen. Sein winziges Auge im verdrehten Kopf schaute den Betrachter mit einem stechenden Blick, dem man sich nicht entziehen konnte, direkt ins Gesicht. Maria Theresia fürchtete sogar, er könne sie mit seinem Gift anhauchen und versteinern. Aus Angst nahm sie manchmal einen kleinen Spiegel mit in die Kirche und hielt ihn dem Basilisken vor, damit er gegebenenfalls selbst versteinert würde.