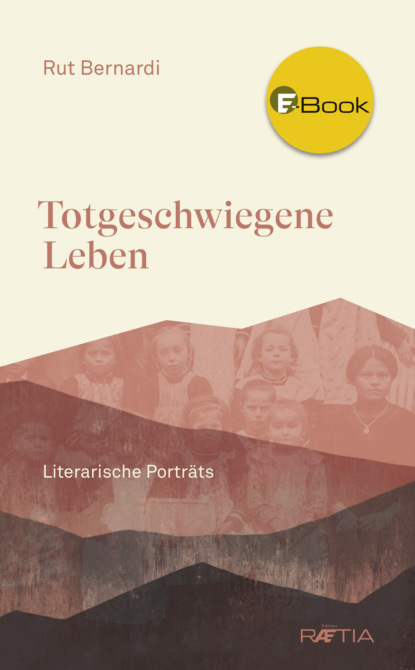- -
- 100%
- +
Andere Tiere, die sie in der Kirche entdeckte, waren Bären, die sie aus den Wäldern in Gröden gut kannte, Löwen, als Begleiter des Evangelisten Markus und des heiligen Hieronymus, ein Lamm im Diözesanwappen der Bischofsstadt Brixen, ein großer Fisch, der gerade den heiligen Jonas verschlang, ein Stier als Begleiter des Evangelisten Lukas, eine Schlange, die gebändigt wurde, und kleine Hunde, von denen der Maler einige hinter Säulen und einer Balustrade hervorspähen ließ. Über diese Hündchen freute sie sich außerordentlich, denn sie hatte sich immer einen eigenen Hund gewünscht. Aber ganz besonders angetan war sie von der Darstellung eines Vogels, der eigentlich einen Adler darstellen sollte, denn er stand zu Füßen des Evangelisten Johannes. Er sah aber einer Gracula religiosa, einem großen Beo mit orangen Füßen und Schnabel, viel ähnlicher, hielt ein Tintenfass mit einer Schreibfeder im Schnabel und saß auf einem Buch. Maria Theresia kannte nur die Alpenkrähe mit rotem Schnabel und die Alpendohle mit gelbem Schnabel, die die Berggipfel umflogen und um ein Stückchen Brot bettelten. Sie wusste auch nicht, dass der Beo aus der Familie der Stare eine ausgesprochene Sprachbegabung hatte und der Maler vielleicht deshalb diesen Singvogel gewählt hatte. Sie empfand dieses Bild jedenfalls als Aufforderung zum Schreiben, denn sie hatte schon lange diesen Wunsch gehegt, es hatte ihr nur immer an Mut und Selbstvertrauen gefehlt, in einer ihr fremden Sprache zu dichten. Und in ihrer Muttersprache zu schreiben, wäre ihr nie im Leben in den Sinn gekommen.
Unter all den Tieren, die das Kirchenschiff verzierten, fehlten die Katzen. So oft Maria Theresia auch danach suchte, nie fand sie eine. Leider war das heilige Tier seit dem Spätmittelalter in Ungnade gefallen und wurde von der Kirche gemeinsam mit den Hexen dämonisiert und verbrannt. Maria Theresia konnte sich wenigstens mit Luzifer trösten, der sie mittlerweile überallhin – wenn sie niemand beobachtete, sogar in die Kirche – begleitete, außer er war gerade zum Betteln in die Küche zu Schwester Magdalena geflüchtet.
Im Gegensatz zur Freude, die sie im Kirchenschiff empfand, stand die Beklemmung, die die vier Tafelbilder in der Vorhalle der Heilig-Kreuz-Kirche in ihr hervorriefen. Jeder, der die beglückende Kirche betreten wollte, musste auch an den mahnenden Bildern der Vier letzten Dinge – dem Tod, dem Jüngsten Gericht, der Hölle und dem Himmel – vorübergehen. Entweder stammten die einwandfreien Kopien der vier originalen Miniaturbilder des Franziskanerpaters Frère Luc – Claude François aus Amiens, der später nach Neufrankreich in Nordamerika ausgewandert war – von ihm selbst, oder sie wurden vom malkundigen Oratorianerbruder Franz Metz aus Bayern, der bereits vor der Erbauung des Klosters als Einsiedler in den Ruinen der alten Burg auf Säben gelebt hatte, angefertigt.
Die vier Tafelbilder entstanden noch im Geiste mittelalterlichen Denkens, in dem man nur durch die Tugenden und nicht wie später durch die Wissenschaften Weisheit erlangte. Auf jedem Bild war dementsprechend am Bildrand auch ein Täfelchen mit einem Mahnspruch auf Latein und Französisch gemalt:
Der Tod wird durch den Sensenmann dargestellt. Der Schädel mit seinen Öffnungen, die linke Hand mit den Armknochen und die rechte Hand, mit der das Skelett das Täfelchen mit der Aufschrift Temperamentum Deliciarum hält, sind sichtbar. Auf dem Kopf trägt der Knochenmann ein weißes Tuch und um die Schultern einen schwarzen Umhang mit weißen Punkten. In Erinnerung an das Memento mori ruft das Bild zur Bändigung und Maßhaltung im Leben auf.
Das Jüngste Gericht stellt der Maler als tröstlichen Läuterungsort nach dem Tod dar. Es zeigt einen von Flammen umringten nackten Mann in Ketten, der mit flehend erhobenen Händen im Fegefeuer betet. Trotz Tränen schaut er uns angstfrei und zuversichtlich an. Der Leitspruch lautet Stimulus Poenitentium als Hoffnung, durch die Buße vor das Jüngste Gericht treten zu können und gerettet zu werden.
Das Höllenbild mit dem Libidinum Remedium als Mittel gegen die Leidenschaft stellt die verdammte Seele durch einen nackten Mann mit funkelnden Augen und struppigem Haar dar, der sich aus Reue selbst in den Arm beißt und von zwei langen Schlangen bedrängt wird.
Schlussendlich das Himmelsbild mit der glücklichen Seele als Votum Christianorum, bestem Christenwunsch, mit einem verklärt in den Himmel schauenden Jüngling in hellblauem Mantel: Durch die Helligkeit des Bildes, die blonden Locken, den Haarschmuck als Krone und die Strahlen um den Kopf sieht er wie eine Heilige aus.
Maria Theresia gefielen aber die zwei angsteinflößenden Bilder am besten. Beim Tod liebte sie die dunklen Farben und den Lichteinfall auf den Schädel. Außerdem gefiel ihr der Gedanke, dass der Tod alle Menschen gleich behandelt und es von jedem selbst abhängt, was anschließend mit ihm geschehen würde. Bei der Hölle mochte sie die intensive rote Farbe des Bildhintergrunds und die Schlangen, die Köpflein wie kleine Rehkitze hatten. Sie hatte sich vor Schlangen nie gefürchtet, denn sie hatten ihr nie etwas getan und waren außerdem wunderschön.
Franz Metz war mit Pfarrer Jenner befreundet gewesen und hatte nach der Errichtung des Klosters auch Altarbilder für die Klosterkirche und Dekorationen in den Zellen gemalt. An den Wänden des Innenhofs bzw. des Blumengärtleins mit Brunnenhaus zwischen der Klosterkirche und dem Wohntrakt der Schwestern schuf Franz Metz ein emblematisches Kunstwerk aus Wort und Bild zu alttestamentarischen Texten, wie zum Beispiel dem Hohelied Salomos. Diese Szenen entzückten Maria Theresia dermaßen, dass sie bei deren Anblick in eine Art Trance verfiel. Hierzu wurde in der Klosterbibliothek ein Exemplar des Werkes Pia Desideria des Jesuiten Hermann Hugo aufbewahrt, worin Holzschnitte mit Motiven des mystischen Verlangens der geweihten Jungfrauen nach ihrem Bräutigam abgebildet waren. Dieses Buch wurde für Maria Theresia zum Quell all ihrer frommen Wünsche hinsichtlich ihres geliebten Bräutigams: des Sehnens, Suchens, Findens und Lobpreisens. Sie wollte wie die heilige Kümmernis alles auf sich nehmen, um einzig und allein ihrem Bräutigam zu gefallen. Gleich dem armen Spielmann kniete sie oft vor dem kleinen Bild mit der gekreuzigten Heiligen, das auf Säben im Innenhof etwas versteckt hing, da die zum Christentum bekehrte Tochter des heidnischen Königs von der Kirche nie anerkannt wurde. Doch Maria Theresia verehrte die bärtige Frau und fühlte die sinnliche Kraft, die sie ausstrahlte. So wie Maria Theresia zwischen Tier und Mensch keinen Unterschied machte, gab es für sie auch zwischen den Geschlechtern keine Grenze.
Als für Maria Theresia das Postulat vorüber war, bat sie um Aufnahme ins Noviziat. Trotz angekündigter Aufhebungen der Frauenklöster schien auf Säben das Dekret der fürstbischöflichen Kanzlei von Brixen nicht allzu streng gehandhabt zu werden. Das aufklärerische Denken Josephs II. konnte 1786 auch die Feierlichkeiten zum ersten Jahrhundert des Bestehens von Kloster Säben nicht vereiteln. Noch weilten an die 50 Chorfrauen und Laienschwestern auf Säben.
Maria Theresia wurde im selben Jahr 1786 ins Noviziat aufgenommen, und in einem feierlichen Ritus während der Vesper fand die Einkleidung statt, an der ihr die benediktinische Ordenstracht, der Habit, überreicht wurde. Sie bekam als Untergewand eine Tunika, die mit dem Zingulum, einem Gürtel, zusammengebunden wurde, und ein Skapulier als Überwurf, das auch als Arbeitsschürze fungierte. Dazu kamen eine große schwarze Kukulle bzw. ein Chormantel mit Kapuze, dem Klima entsprechend aus grobem schwerem Wolltuch, für die Stundengebete und festlichen Anlässe. Zuallerletzt wurde ihr noch der weiße Velan, der Schleier, übergeben. Wie alle Verlobten mussten natürlich auch diese Jungfrauen als Novizinnen und später als Bräute Christi einen Schleier zum Zeichen der menschlichen Begrenztheit, die Größe Gottes zu erkennen, tragen. Abgesehen davon hatte sie bereits zu Hause zum Zeichen der Trauer mehrfach die napla getragen, ein weißes Kopftuch, das die Stirn vollständig verdeckte.
Während der zeremoniellen Aufnahme ins Noviziat erhielt Maria Theresia auch ihren Ordensnamen: Maria Benedikta von St. Kassian. Darin lag ein Verweis auf den Heiligen Benedikt, den Gründer des Nonnenordens auf dem Säbener Berg, der sich radikal von der Welt abgewandt hatte und dessen Regel die Grundhaltung des Horchens an den Anfang setzte und die Tugend des Schweigens hervorkehrte. Nach eingehender Lektüre der Heiligen Schrift und der Regeln des Heiligen Benedikt hatte sie sich diesen Namen innigst gewünscht, sodass die Äbtissin ihrem Wunsch nachgekommen war. In Gröden wurde zudem in St. Ulrich eine Reliquie von Benedikt von Nursia8 aufbewahrt, die Maria Theresia einige Male bestaunt hatte. Obwohl Benedikt in einer Zeit der Unzuverlässigkeit und Angst lebte, hatte er es gewagt, an das Gute im Menschen zu glauben.
Maria Theresia hatte ebenso Vertrauen in den barmherzigen Kern des Menschen, obwohl auch sie in einer durchwegs unsicheren Zeit lebte. Sei es durch die Gefahr der Aufhebung der Klöster, sei es durch die ständigen Bedrohungen der bayerischen und französischen Soldaten. Die zusätzliche Bezeichnung von St. Kassian hatte die Ehrwürdige Mutter für Maria Theresia ausgesucht, da sie mit dem Namen des legendären ersten Bischofs auf Säben ihre rätischen Wurzeln und ihren Wissenshunger in Erinnerung rufen wollte.
Bedenken hatte Maria Theresia, nun Schwester Benedikta, keine gehabt, sich nach dem Probejahr endgültig für das Klosterleben zu entscheiden. Der Gedanke an den Makel, der ihr im Fall eines Abspringens in den Augen ihrer Verwandtschaft haften geblieben wäre, hatte sie dabei keinen Augenblick lang beeinflusst. Sie verspürte bereits nach einem Jahr das Verlangen, nie mehr von der Welt draußen beunruhigt zu werden. Als obligatorische Aussteuer, die schon einige Tage nach ihrem Eintritt von einem Fuhrwerk herbeigebracht worden war, dienten eine Bettstatt, ein Tisch, ein Stuhl und ein kleiner Schrank sowie Bettwäsche, Handtücher und ein silberner Löffel. Nach dem Probejahr hatte die Familie dem Kloster als Mitgift noch 1500 Florentiner ausbezahlt. Das war für einen Bauern aus Gröden eine hohe Summe, die rund drei Jahresgehälter betrug. Doch Giuani Demëine Sanoner hatte mittlerweile eingesehen, dass dieser Weg für seine Tochter der richtige war, und die Familie war stolz auf Maria Theresia und froh, eine Fürbitterin zu haben.
Bis zur feierlichen Profess, dem Versprechen, für immer in der Gemeinschaft Säbens Gott zu suchen, musste Maria Theresia zunächst ein dreijähriges Gelübde ablegen. Während dieser zeitlichen Profess nahm sie an den Gottesdiensten teil, vertiefte sich in den Grundsätzen des Ordens, übte sich in Selbstständigkeit und Ausgeglichenheit, verrichtete täglich ihre Arbeit als Ökonomin, kurz gesagt mit den Tieren, las die Heilige Schrift und meditierte. Doch am liebsten von allem sang Schwester Benedikta. Während der Stundengebete und der heiligen Messe erfolgte der einstimmige, unbegleitete gregorianische Choral in lateinischer Sprache, was ihr überhaupt nicht schwerfiel, da sie diese Sprache viel mehr an ihre Muttersprache erinnerte als das Deutsche.
Aufgrund der nun umfangreicheren Gebetsverpflichtungen als Novizin, die im Chor täglich bis zu sieben Stunden umfassten, konnte sie nicht mehr so viel Zeit ihrer Arbeit bzw. den Tieren widmen. Die Äbtissin bewilligte ihr aber trotzdem jährlich das Amt der Ökonomin, wenn es einer Chorfrau auch nicht entsprach, in den Stall zu gehen, denn Chorschwestern verrichteten Näh- und Stickarbeiten, erteilten Unterricht oder arbeiteten in der Bibliothek als Kopistinnen.
Die ersten Jahre verliefen für Schwester Benedikta auf Säben trotz bewegter und unruhiger Zeiten relativ ruhig und unerwartet rasch. Zwischen den Gebetsstunden in der Klosterkirche, den Lesungen im Kapitelsaal, den Essenszeiten im Refektorium, der Erholung im Schlafsaal und der Arbeit im Stall blieb für Schwester Benedikta, gemeinsam mit Luzifer, nur mehr wenig Zeit für kleine Spaziergänge im Blumengärtlein oder im Klostergarten und für Besuche bei den Tieren auf den Höfen des Klosters.
Bereits vor Schwester Benediktas Eintritt ins Kloster hatte Joseph II. 1782 im Namen der Aufklärung mit der Aufhebung der Klöster begonnen. Betroffen waren Klöster, die dem Staat keinen Vorteil verschafften und nur ein beschauliches Dasein fristeten. Dies waren vor allem Frauenklöster mit strenger Klausur, wie zum Beispiel die benediktinische Frauenabtei Sonnenburg in St. Lorenzen im Pustertal, die 1785, im Eintrittsjahr Maria Theresias auf Säben, nach fast 800 Jahren ihres Bestehens, aufgehoben wurde. Nur Klöster, die auch weltliche Aufgaben, wie Krankenpflege, Unterricht oder Pfarrseelsorge, erfüllten, wurden nicht aufgelassen. Da die Schwestern auf Säben auch Unterricht erteilten und das Kloster zudem innerhalb der Hochstiftsgrenze von Brixen lag, blieb es verschont. Und auch wenn der Bischof von Brixen viele Jahre hindurch die Aufnahme von Novizinnen zu verbieten versucht hatte, waren ab 1785 trotzdem immer wieder Nonnen ins Kloster Säben aufgenommen worden.
Eine davon war 1790 Maria Dominica Senoner aus Wolkenstein, die ihrer Landsfrau gefolgt war. Maria Dominica Senoner legte bereits 1791 die einfache Profess ab und erhielt als Laienschwester den Namen Clara. Trotz ihrer Schwindelanfälle übte sie die Aufgabe der Glockenmeisterin aus. Sie verstarb 1824. Nach dem Klostersturm von 1787 sollte 1791 noch eine Aufhebungswelle folgen, die jedoch durch den Tod des Kaisers zum Erliegen kam.
Inzwischen war auch für Chorfrau Benedikta das Triennium der zeitlichen Profess vorbei, und nach der Novene, dem neuntägigen Gebet zur sorgfältigen Vorbereitung, konnte sie 1788 die feierliche Profess auf Lebenszeit ablegen. Am großen Tag, der ihr Hochzeitstag mit Christus wurde, erneuerte sie während der heiligen Messfeier in Anwesenheit des Fürstbischofs Joseph von Spaur und der Äbtissin Maria Candida Mayr sowie einiger Geistlicher, aller Chorfrauen und Mitschwestern, ihrer Eltern, ihrer Schwester und ihres Bruders die Ordensgelübde Beständigkeit, klösterlicher Lebenswandel, Gehorsam und gottgeweihte Jungfräulichkeit. Den Gelübden folgte die Umkleidung des Habits, indem ihr weißer Novizinnenschleier mit dem schwarzen Nonnenschleier ersetzt wurde, wobei die Bedeckung von Haaren und Hals weiß blieb. Als Braut Christi erhielt sie als Insigne auch einen Ring und zusätzlich ein Stundenbuch, die ihre einzigen Besitztümer bleiben sollten. Doch während der ganzen Feier musste sie stets daran denken, dass ihr eigentlicher Hochzeitstag mit Christus erst an ihrem Sterbetag sein würde, denn nicht eher würde die wahre Begegnung mit dem Bräutigam erfolgen.
Es waren ohne Zweifel besorgniserregende Jahre. 1796 wurden die ersten österreichischen Soldaten auf Säben einquartiert, die die anrückenden Franzosen aufhalten sollten. Die Schwestern fingen mit täglichen Kriegsgebeten an, aber das große Opfer waren die enormen Unkosten, die das Kloster hatte, um alle zu verpflegen. Sogar Nonnen, die vorgaben, aus Paris geflohen zu sein, wurden rundum versorgt, bevor sie nach Brixen zum Fürstbischof weiterzogen; dort entdeckte man, dass sie sich rasierten, und entlarvte sie als Spione.
Schon ein Jahr darauf fiel am heiligen Lichtmesstag Mantua. Die Klosterfrauen wurden gebeten das Kloster zu räumen, denn Säben sollte zu einer Festung ausgebaut werden. Die für diese Arbeiten abkommandierten Bauern von Latzfons weigerten sich jedoch, die Kirchen zu verwüsten, und wenn das Militär nicht nachgegeben hätte, wäre es zu einer Rebellion gekommen.
Am Tag nach der heiligen Benediktfeier des Jahres 1797, am 22. März also, hörte man die Kanonen vor Klausen donnern. Schreckerfüllt flohen einige Schwestern über Feldthurns in Richtung Brixen, wo sie die flüchtende Bevölkerung mit weinenden Kindern in fürchterlicher Not, Kälte und Elend sahen. Schwester Benedikta wurde von Schwester Magdalena gezwungen, nach Latzfons auf den klostereigenen Grienberghof zu ziehen, da sie sich weigerte, nach Hause zu gehen. Bis ins hintere Tal folgte ihr Luzifer brav wie ein Hündchen und wich ihr am Hof nicht von der Seite.
Nachdem die Franzosen in Klausen alle Häuser geplündert hatten, drangen Soldaten bis zum Kloster hinauf und in die Kirchen hinein, wo sie Kelche und den Opferstock raubten. Mit Erstaunen stellten sie fest, dass einige Schwestern im Kloster geblieben waren. Sie versprachen, ihnen nichts anzutun, und zogen bald darauf über die Felsen in Richtung Pardell weiter. Dort erwartete sie aber eine Überraschung. Auf einem Hügel von Pardell sahen sie eine große Truppe in weißen Mänteln, die auf sie zukam. In der Annahme, es handle sich um österreichische Soldaten, die den Bauern zu Hilfe geeilt waren, zogen sie rasch über den Torgglhof wieder ins Tal hinunter. Die Frauen von Latzfons und Verdings hatten zu diesem Trick gegriffen, da viele Männer fort waren, um die Franzosen bei Franzensfeste aufzuhalten.
In der Gegend war auch ein Landsmann Schwester Benediktas, der mit den Mannen aus Gröden nach Spinges gezogen war, um die Franzosen zu schlagen. Schwester Benedikta kannte Matie Ploner vom Hörensagen. Sie hatte von seinen Verdiensten um den Kirchenbau in St. Ulrich und der ein Jahr zuvor erfolgten Kirchenweihe gehört. Doch getroffen hatte sie ihn nie, denn es widerstrebte ihr, an solchen Anlässen teilzunehmen, obgleich sie dafür mit einer Spezialermächtigung der Äbtissin und der Dispens des Bischofs für kurze Zeit das Kloster hätte verlassen können.
Kurz darauf kam der kommandierende Obrist Chavardes mit einigen Offizieren auf Säben und ein paar Tage später wurden 400 Mann und 40 Offiziere im Kloster einquartiert. Doch schon am nächsten Morgen zogen auch sie wieder ab, und bis Ende April kehrten – bis auf eine – alle geflüchteten Schwestern wieder ins Kloster zurück.
Es folgte eine schwere Zeit für die Schwestern. Es herrschte Not und Mangel an lebensnotwendigen Dingen, was jedoch mit der angestrebten Askese nichts zu tun hatte, und es musste ständig mit weiteren Belagerungen des Klosters gerechnet werden. Die Männer des Klosters, der Kaplan, der Zimmermann, der Gärtner und die Bauarbeiter, mussten immer wieder ins Feld ziehen, und die Nonnen mussten auf den klostereigenen Höfen Wachen einsetzen, die auch rundum zu versorgen waren. Aber für Chorfrau Benedikta, die seit ihrem Klostereintritt nicht bessere Jahre gekannt hatte, war das Wegschauen bzw. das sich Ausklinken aus der materiellen Welt schon zur Routine geworden. Durch die Technik des Eintauchens in eine eigene Welt hatte sie bereits zu Hause im Dorf gelernt, sich vor Enttäuschungen und Schmerzen zu bewahren. Das Kloster war für sie noch eine zusätzliche Hilfe geworden, diesen Schutzmechanismus zu verfeinern. Es gelang ihr immer besser, die reale Welt mit ihren Vorstellungen zu ersetzen. Die imaginierte Welt in ihren Gedanken wurde immer stärker zur täglichen Wirklichkeit und schaffte es, Not und Grauen zu vermindern. Die Jahre der Gründungszeit des Klosters, die reich an Malerei, Musik und Theater waren, lebten somit in der Vorstellung Schwester Benediktas weiter und beflügelten ihre Fantasie.
An einem wunderschönen Altweibersommertag, als sich Schwester Benedikta nach der Versorgung der Tiere in der Laube ein wenig ausruhte, sah sie die Ehrwürdige Mutter, die gerade im Garten einen Spaziergang machte, und setzte sich zu ihr. Eine ganze Weile lang schwiegen sie und hörten in die Stille hinein. Es waren nur das Rauschen des Tinnebaches aus der Schlucht bis auf den Säbener Berg hinauf und das beruhigende Schnurren Luzifers auf dem Schoß Schwester Benediktas zu hören.
Da fragte die Äbtissin plötzlich, ob sie wisse, wieso sowohl das Tal als auch der Fluss Tinne hießen. Dass sie diese Geschichten, wie sie von den neuen Gelehrten genannt wurden, einer jungen Nonne eigentlich nicht erzählen dürfte, kam ihr gar nicht in den Sinn. Als Gläubige unterschied sie nicht Mythen von historischen Ereignissen, die sie beide gleichermaßen als wahr erachtete.
Schwester Benedikta verneinte die Frage und die Äbtissin erzählte ihr von Tinia, dem Hauptgott der Etrusker. Er sei deren Wettergott gewesen und habe besonders mit Blitzen seine gewaltige Zerstörungskraft gezeigt. Nach Murenabgängen habe der Tinnefluss im wilden Tinnetal schon oft ganze Höfe mitgerissen. Doch Tinia sei auch der Gott des Lichtes gewesen, das dürfe sie nie vergessen.
Schwester Benedikta kannte das Tinnetal, denn so oft sie konnte, ging sie der Tiere wegen zu den zinspflichtigen Pachthöfen des Klosters nach Pardell, Latzfons und Villanders. So verstand sie die Worte der Äbtissin nur zu gut, wenn sie an die steilen Wiesen und Felder bis zuhinterst im Tal, wo sich die Ruine des Schlosses Gernstein des Kammermeisters des Hochstiftes Brixen, Ludwig Lindner von Gerrenstein, befand, dachte.
Die Ehrwürdige Mutter hatte schon lang die Wissbegierde Schwester Benediktas bemerkt und fand, es wäre an der Zeit, ihr Genaueres über die Geschichte ihrer Vorfahren mitzuteilen: „Liebe Schwester Benedikta. Sie sollen wissen, dass auf unserem Felsen – auf dem Sonnenberg, wie er dazumal hieß – einst der Räterkönig Arostages seine Burg hatte, und auf dem Gipfel, wo heute unsere Heilig-Kreuz-Kirche steht, befand sich ein Tempel zu Ehren des Gottes Tinia. Das Land des Königs Arostages war nicht sehr groß – es umfasste nur 17 Gehstunden im Umkreis –, doch er häufte gewaltsam Reichtum an Gold und Schätzen auf seiner Burg an, die er in Kellern und Verliesen im Fels versteckte, sodass sie bis heute nicht gefunden wurden. Seine einzige Tochter Larthia liebte er über alles, nachdem seine zwei Söhne im Kampf gegen die angreifenden Römer gefallen waren. Daraufhin hatte er seine Burg zu einer uneinnehmbaren Festung ausbauen lassen. Doch zwei Söhne seines Bruders hatten sich verräterisch auf die Seite der Römer geschlagen und verschafften sich durch eine List Einlass in die Burg. Sie gaben vor, dem Onkel bei der Schlacht gegen die Römer beiseitestehen zu wollen. Am Abend, bevor es zur Entscheidungsschlacht kommen sollte, wurde im Festsaal fröhlich gespeist und getrunken. Nur Larthia hatte eine Vorahnung. Als es Nacht wurde, schlichen die Brüder zum Mäuseturm, wo die Waffen aufbewahrt wurden, drangen ins Schlafgemach des Königs Arostages ein und töteten ihn. Larthia fesselten sie an eine Säule des Tempels, um sie am nächsten Tag den Römern auszuliefern. Den Schatz wollten sie natürlich für sich behalten. Als Larthia dies vernahm, bat sie ihre Vettern um eine letzte Gunst. Sie würde so gerne noch einmal für den toten Vater zu Tinia beten. Als man sie losband, entschlüpfte sie den Aufsehern, floh zur Hinterseite des Tempels und stürzte sich über den Felsrand in die Tiefe. Die Römer nahmen die Burg in Besitz, die Verräter wurden verjagt und die Gebeine Larthias vermoderten am Fuße der steil abfallenden Säbener Bergwand. Wo der Tempel für Tinia stand, errichteten die Römer einen Tempel zu Ehren der Göttin Isis.“
Die Äbtissin und Schwester Benedikta saßen noch eine ganze Weile still beieinander. Die Sonne stand schon knapp über dem Ritten und schickte die letzten warmen Strahlen zu ihnen herüber. Die Blätter der Reben leuchteten im Abendlicht je nach Sorte blutrot, weinrot, rostbraun, goldgelb oder orange. Gerne hätte Benedikta etwas gesagt, aber wie so oft schwieg sie. Sie war in Gedanken noch mitten in der Geschichte. Sie verstand Larthias Tat nur zu gut und bewunderte deren Mut. Es fiel ihr der lateinische Vers in hac lacrimarum valle9 der Antiphon im Salve Regina ein, den sie oft sangen. Schwester Benedikta liebte die klangvollen lateinischen Texte, die dem Ladinischen so ähnlich waren.
Der Gang des Irdischen außerhalb der Klostermauern war in der Tat zu einem tristen Ziel gelangt. Hier auf dem Säbener Berg hoffte sie dagegen, den Ort einer höheren Freiheit gefunden zu haben. Die benediktinischen Grundsätze des Gehorsams, der Besitzlosigkeit und der ehelosen Keuschheit standen für sie nicht im Widerspruch zu ihrem Wunsch nach einem glücklichen Leben und bedeuteten weder Verzicht noch Opfer. Im Gegenteil. Im geschützten Raum der klösterlichen Gemeinschaft verspürte sie zunehmend, wie ihre Unsicherheit verschwand und sie jener Unbeschwertheit näherkam, nach der sie von Kind an unbewusst gestrebt hatte. Indem sie sich dem sich ausbreitenden aufgeklärten Individualismus entzog, würde sie auch dem daraus resultierenden Leid und Schmerz des Einzelnen in der neuen Weltordnung entfliehen. Es war ein Weltgesetz, das Freiheit und Toleranz vortäuschte und, durch das Scheinideal der Eigenmächtigkeit, dem völlig unmündigen Menschen noch für lange Zeit unvorhersehbare Zwänge, gesellschaftlichen Druck und Armut verursachen würde. Echte Freiheit konnte sie nur durch den Verzicht auf die gesellschaftlichen Verstrickungen erlangen. Die Zeit für den neuen Menschen war noch lange nicht reif, und Schwester Benedikta zweifelte sogar, ob sie es jemals sein würde. Sie sah sich jedenfalls in der Klausur bei ihren Mitschwestern aufgehoben und versorgt. Sie verhielt sich im Kloster wie ihre Ameisen, die sie oft beobachtete und die sich als Individuen nicht wichtig nahmen.