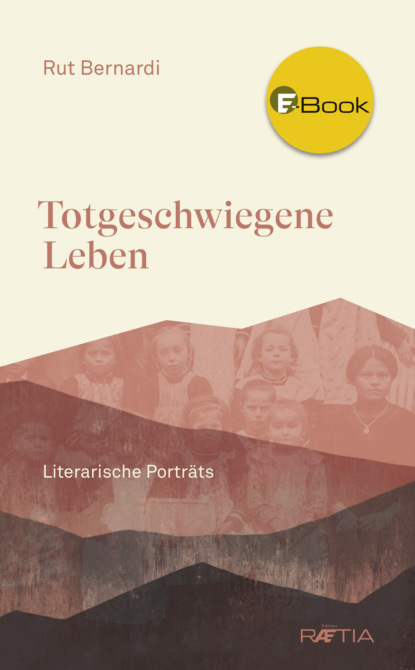- -
- 100%
- +
Plötzlich brach das Vesperläuten die Stille. Die Chorschwestern erschraken – auch die Äbtissin war in ihre Gedanken versunken gewesen – und sie beeilten sich, um rechtzeitig in die Stiftskirche zu gelangen.
Der Frieden im Land hielt nicht lang an. 1805 fiel das Hochstift Brixen zusammen mit dem Land Tirol an das neu geschaffene Königreich Bayern und es folgte das Schicksalsjahr 1808. Nachdem das Kloster vollständig ausgeplündert worden war, wurde es am 25. August von der bayerischen Regierung aufgehoben. Gleichzeitig wurden auch die Klosterhöfe zum Verkauf freigegeben. Die meisten Schwestern zogen nach Hause oder zu Verwandten und nur wenige verblieben im Kloster, darunter Schwester Magdalena, Schwester Benedikta und die Äbtissin Maria Candida. Diesmal hatte die Toldin Benedikta nicht überreden können, das Kloster zu verlassen.
Bei den Plünderungen im Februar und März 1809 wurde alles von den Soldaten mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest war. Nur Schwester Magdalena hatte den Mut gehabt, sich zu widersetzen. Wutentbrannt riss sie den bayerischen Räubern den letzten Kessel wieder aus der Hand und rettete durch eine List auch die Klosterchronik und weitere Schriften des Archivs. Das gesamte Klosterinventar – Mobiliar und Kirchenparamente – wurde zu einem Spottpreis in Klausen versteigert.
Doch schon im April rückten wieder die Österreicher bis nach Klausen vor, die alles, was noch nicht verkauft worden war, erneut auf Säben hinaufbringen ließen. Sie blieben bis November, als auch wieder die Franzosen vorrückten. Diesmal griffen sie wutentbrannt von allen Seiten die Bauern an und drangen am 5. Dezember bis nach Säben hinauf. Sie überfielen die Klosterfrauen im Chor, als sie gerade die heilige Kommunion empfingen. Die Soldaten zerrten die Frauen an ihren Kutten und an den Haaren in den Vorhof.
Schwester Benedikta saß wie immer in der hintersten Kirchenbank im Dunkeln, so konnte sie in diesem aufgeregten Durcheinander unbemerkt durch die Sakristei hinaus zur Apothekerküche entkommen. Sie hätte sich hier verstecken können, aber die Apotheke war schon seit Jahren aufgelassen und verschlossen. Nun stand sie allein am Abhang des Säbener Felsens und schaute auf Klausen hinunter. Jener Abhang, der die Nonnen von der Welt abschirmte und das Glück bedeutete, war für so manches Kirchenoberhaupt schon lange ein Dorn im Auge, da er durch die abgeschiedene Lage die Macht der Äbtissin unkontrollierbar machte.
Es war ein klarer Wintertag mit wenig Schnee. Schwester Benedikta wurde plötzlich ganz ruhig und dachte voller Erbarmen an ihre Mitschwestern. In all den Jahren der Belagerungen hatten sich noch keine Soldaten so brutal verhalten. Für Schwester Benedikta war der Gedanke, in jedem Augenblick selbst entscheiden zu können, wann die Zeit für das Abschiednehmen gekommen wäre, stets eine tröstliche Überlebensstütze gewesen.
Während ihrer letzten Jahre auf Säben litt sie – wie mehr oder weniger alle Schwestern, mit Ausnahme der kräftigen Toldin – unter Beschwerden. Ihr Anliegen, sich vor körperlichen und seelischen Schmerzen zu schützen, hatte sie mit radikalem Rückzug und Schweigen zu erreichen versucht. Doch die Jahre vergingen auch für sie. Schwester Benedikta hatte gerade ihren 50. Geburtstag hinter sich, und ein unaufhaltsamer Kräfteverfall, der sie sehr beunruhigte, hatte sich schon seit einigen Jahren bemerkbar gemacht. Es waren vor allem das tägliche stundenlange Knien in der Kirchenbank und die ständige Kälte, die sich rächten. Zusätzlich hatte sie Kreuzschmerzen und der Nacken plagte sie oft so sehr, dass sie tagelang kaum den Kopf wenden konnte. Trotzdem musste sie sich als vom Glück begünstigt erachten, wenn sie an die vielen und schweren Gebrechen ihrer Mitschwestern dachte, die von gehbehinderten Füßen, periodischen Nervenschwächen, rheumatischem Armleiden, schmerzhaften Leibschäden, Wassersucht, Engbrüstigkeit, Blindheit bis hin zur Lungenkrankheit gingen.
Die entbehrungsreichen Jahre der Belagerungen und Plünderungen hatten den Nonnen viel Leid gebracht. Somit war für Schwester Benedikta der Freitod in dieser schweren Zeit immer eine offene Option gewesen, gleichwohl ihre Obrigkeit den Suizid als Verbrechen gegen die Gesellschaft, das Gesetz und gegen Gott verurteilte. Ihr lag es jedoch fern, jemanden damit zu verletzen. Im Gegenteil. Ihre Liebe zum Klosterleben und zu den Mitschwestern war stets so groß gewesen, dass sie sich vor einer Verurteilung nicht fürchtete. Nur hätte sie nie geglaubt, den Freitod eines Tages nutzen zu müssen, um einer fremden Vereinnahmung zu entkommen.
Sie erinnerte sich an Larthia. Seit ihrer Aussprache mit der Ehrwürdigen Mutter verspürte Schwester Benedikta eine gewisse Verwandtschaft mit ihr. Und diese Vision verwirrte sich mit den Gestalten der Vier letzten Dinge auf den Tafelbildern an der Heilig-Kreuz-Kirche. Sie zeigten ihr noch einmal das Entscheidende, worum es in diesem Augenblick ging: den Tod, das Widerspiel zwischen Höllenqual und Paradiesesglück und den Urteilsspruch beim Jüngsten Gericht. Es war also eine schwache Ahnung vom möglichen Ende der schweren Zeiten und von der Vollendung der gesamten Schöpfung, die sich schließlich in ihr öffnete und ihr eine letzte Zuversicht gab. Nicht zuletzt wusste sie den inzwischen uralten Luzifer bei Schwester Magdalena gut aufgehoben und versorgt.
Nach einer Hitzewallung, die durch ihren Körper lief, und im Wohlgefühl der nachlassenden Wärme, noch bevor der anschließende Schüttelfrost sich breitmachen konnte, überkam sie die Gelassenheit und die Gewissheit, dass sie das Richtige tat. Wie eine Filadrëssa, ein Turmfalke, glitt sie mit dem Aufwind, der winters über den Säbener Felsen steigt, fort.
Als die bestürzten französischen Soldaten sie am späten Abend des darauffolgenden Tages schließlich an einer schier unzugänglichen Stelle auf einem Felsvorsprung fanden – wo sie, gleich dem falschen König von Fanes auf dem Falzarego, noch heute neben dem König Arostages versteinert zu sehen ist – wurde sie vorerst nach Klausen hinuntergebracht. Der Arzt stellte fest, dass sie durch den Sturz tödliche Verletzungen davongetragen hatte, aber noch stundenlang gelitten haben musste.
Hatte nicht auch ihr Bräutigam fürchterliche Qualen durchleiden müssen, um die Welt zu retten? War dessen widerstandslos hingenommene Kreuzigung nicht auch eine Art Selbsttötung gewesen? Den Selbstmord Schwester Benediktas als altruistische Tat zu rechtfertigen, wäre dem Bischof nie in den Sinn gekommen. Aber mit der Begründung, der Suizid sei eine Folge von Besessenheit durch den Teufel und dass Schwester Benedikta die ewigen Höllenqualen bereits vor dem Tod erlitten habe, wurde sie von ihrer Verantwortlichkeit enthoben, sodass eine kirchliche Bestattung stattfinden konnte.
Unter großer Anteilnahme wurde sie auf Säben in die Stiftskirche hinaufgetragen, und am nächsten Morgen fand sich eine große Menge Bauernvolk ein. Zum Erstaunen aller drängten sich der Brigadier Severoli und sein Adjutant mit zehn Reitern nach vorne. Sie stellten sich vor dem Sarg auf und begannen den tröstenden Text des 23. Psalms anzustimmen:
Durch tiefe Täler
schickte dieser Hirte mich
verzweifelt schrie ich oft:
Mein Gott, mein Gott,
ich schaff es nicht allein!
Ich ging, ich lief,
ich kroch so manches Mal;
durch finstre Schluchten
über steile Höhn
fand ich mein Ziel.
Es stellte sich heraus, dass der Brigadier Severoli vor der Französischen Revolution Erzbischof und sein Adjutant Mönch gewesen waren. Chorfrau Benedikta hatte es geschafft, die Zeit für einen kurzen Augenblick zurückzudrehen und zugleich den Frieden auf Säben zurückzubringen. Sie wurde in der Gruft unter der Klosterkirche beigesetzt.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.